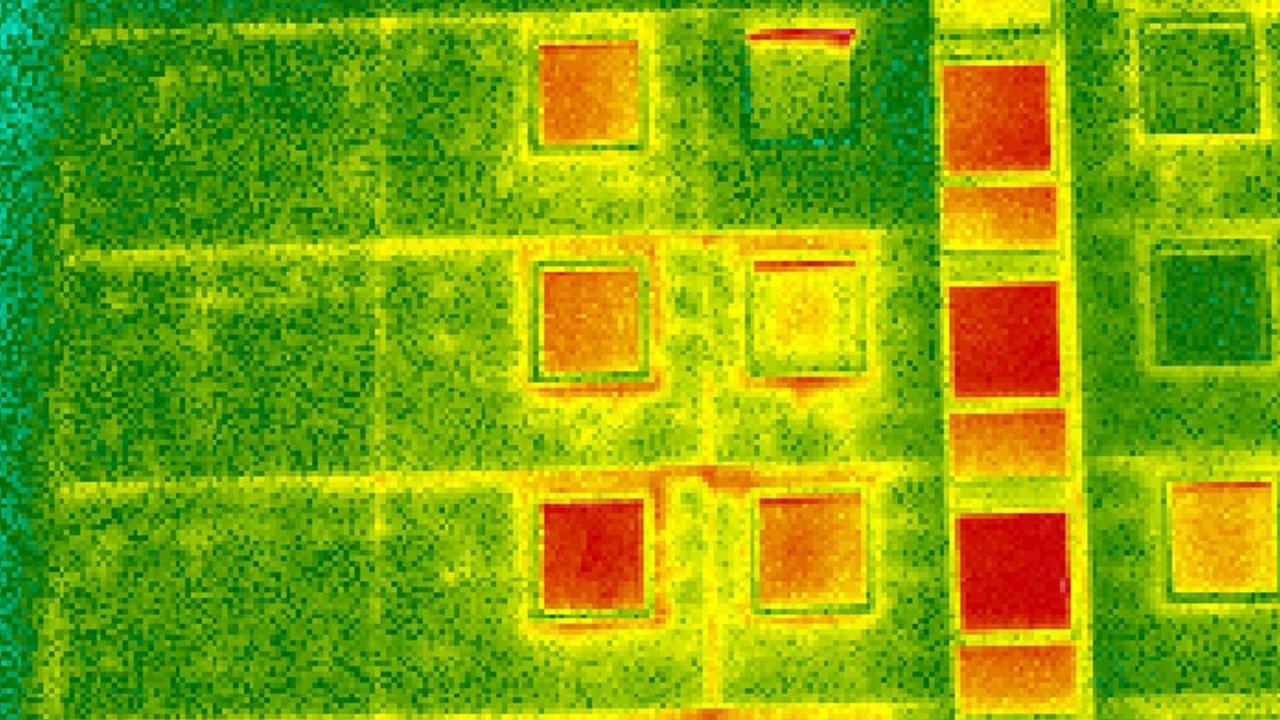Seit vier Jahren lebt Sabine Schlüter nach dem Zero-Waste-Konzept. Inzwischen käme ihre Familie mit fünf gelben Säcken im Jahr aus, auch die Menge des Restabfalls sei deutlich zurückgegangen. Ihre Kleidung kauft sie überwiegend Second Hand. Irgendwann fragte sich Schlüter, wie sich der Zero-Waste-Gedanke auch auf ihre Arbeit als Architektin übertragen ließe. Denn die Baubranche verbraucht besonders viel Ressourcen und Energien:
"Und da fand ich halt einfach wichtig, ein Statement zu setzen."
In Zusammenarbeit mit der Kieler Muthesius Kunsthochschule hat sie einen Prototypen entwickelt. Zusammengebaut wurde er in der Slowakei, mit einem Güterwaggon kam er nach Norddeutschland. Nun steht das fast vollendete Werk aufgebockt in einer Werfthalle. Form und Ausmaße ähneln einem Container.
Drei Zutaten für das Klimahaus: Stroh, Holz, Lehm
An der Längsseite zieht sich eine Glasfront entlang. Im Inneren gibt es einen etwa zwölf Quadratmeter großen Raum, daran angeschlossen ist noch ein kleiner Raum in dem später die Küche eingebaut werden soll. Als Baustoffe hat Sabine Schlüter die Materialien Stroh, Holz und Lehm ausgewählt.
"Im Grunde ist es jetzt ein Modul, in dem wir stehen, das heißt, wir könnten mehrere Module aufeinander stapeln oder nebeneinander stellen. Und könnten jetzt auch mehrgeschossig weiterbauen. Und das ist das wichtige an dem Gebäude: Es ist skalierbar, es soll in den Hochbau übertragen werden. Und ich hoffe, dass sich weitere Kollegen inspirieren lassen."
Tatsächlich werden die Baumaterialien schon seit vielen Jahrhunderten weltweit zur Errichtung von Häusern eingesetzt, zum Beispiel bei Fachwerkbauten. Doch eine Renaissance sei gerade jetzt attraktiv, wirbt Schlüter.
"Lehm hat den großen Vorteil, dass wir ihn einfach weltweit in sehr viel Mengen verfügbar haben. Und er kann quasi wieder eins zu eins zu seinem Rohstoff verfallen. Das heißt, man kann ihn sozusagen nehmen und irgendwann zerkleinern und dann kann es quasi später wieder verwendet werden. Beim Holz ist so ein bisschen die Problematik, dass wir nicht genau wissen, wie viel Holz wir wirklich aus der nachhaltigen Forstwirtschaft ziehen können, deshalb habe ich mich jetzt nicht für eine Vollholzbauweise entschieden."
Ein weiterer Vorteil sei, dass natürliche Materialien wie Holz und Lehm auf Feuchtigkeit reagieren könnten und es daher nicht zu Schimmelproblemen wie beim normalen Putz kommen könne.
Quadratmeterpreis ähnelt dem konventionellen Bau
In den nächsten Monaten soll Schlüters Prototyp im Kieler Wissenschaftspark ausgestellt werden, geplant ist, dass Neugierige dort tageweise auch mal "probewohnen" können. Den exakten ökologischen Fußabdruck kann Schlüter noch nicht beziffern. Doch die Erfahrungen des österreichischen Unternehmens, das den Prototyp gebaut hat, geben Grund zu Optimismus: Die von der Firma seit 20 Jahren mit Lehm und Holz errichteten Passivhäuser würden im Vergleich zu einem konventionellen Wohnhaus etwa nur ein Sechstel der Ressourcen und Energie verbrauchen. Der Bau des Prototypen hätte rund 50.000 Euro gekostet, sagt Firmenchef Roland Meingast.
"Es ist sicher arbeitsaufwendiger, als in Betonfertigteilen zu bauen. Und dann Polystyroldämmplatten an die Fassade zu kleben. Die Naturmaterialien selbst, also der Lehm ist recht kostengünstig und das Stroh ohnehin auch. Gut, das Konstruktionsholz hat natürlich seinen Preis. Und die Hauptkosten sind die Arbeitszeit und da versuchen wir es eben ins Werk zu verlagern, um mit den Kosten runterzukommen."
Meingast ist überzeugt, dass der Prototyp durchaus massentauglich ist. Durch die Vorfertigung seiner Häuser in der Slowakei nähere sich der Preis den Quadratmeterkosten im konventionellen Bauen.
Die Klospülung wird zum Problem
Auch Sebastian Etter ist zu der Hausvorstellung nach Kiel angereist. Der Schweizer hat für den Prototypen einen geschlossenen Wasserkreislauf entwickelt, der es ermöglicht, auch das Abwasser zu nutzen. Dafür wird eine Trockentoilette benutzt mit mechanischer Klospülung, die ganz ohne Wasser auskommt.
"Das neue an dieser Toilette ist, dass sie sehr sauber Kot und Urin voneinander trennt. Also, der Kot wird zu Kompost und der Urin wird zu Dünger. Das ist ein Förderband, das in die Toilette eingebaut wird mit einer gewissen Neigung. Und damit fließt der Urin eigentlich entgegen der Laufrichtung nach unten und der Kot der fährt hoch mit dem Förderband in den Kompostrahmen."
Doch in Deutschland schreibe das Gesetz bisher vor, jedes Wohnhaus an die Kanalisation anzuschließen. Nur eine von vielen Hürden auf dem Weg, das bisherige Bauen umweltfreundlicher und nachhaltiger zu machen. Der Kieler Prototyp ist immerhin ein Versuch zu zeigen, wohin die Reise gehen könnte.