
Emerthe Mukamana biegt von der Hauptstraße in einen schmalen Weg ein. Er führt in eines der Armenviertel von Ruandas Hauptstadt Kigali - jenseits der Hochhäuser und gepflegten Viertel. Hier in Gatsara leben die, die noch nicht an Aufbruch und Fortschritt der ostafrikanischen Nation teilhaben. Aber man habe sie deshalb nicht vergessen, betont Mukamana. Zum Beispiel bei der Gesundheitsversorgung. Darauf hat in Ruanda jeder Bürger und jede Bürgerin Anspruch. So erhalten etwa HIV-Positive, also Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, kostenlos antiretrovirale Medikamente. Sie halten die Funktion ihres Immunsystems aufrecht und verhindern damit, dass Aids, die Krankheit, ausbricht. Außerdem stehen ihnen sogenannte „peer educators“ zur Seite. Mukamana ist eine von ihnen, sie kümmert sich ehrenamtlich um die Versorgung von Sexarbeiterinnen.
Peer educators sorgen für Aufklärung und Hilfe
„Ich sorge dafür, dass sie regelmäßig ihre Medikamente einnehmen. Und ich bringe sie ihnen, wenn sie sie nicht abholen können. Ich kläre auch auf: Ich sage ihnen, dass eine HIV-Infektion kein Todesurteil mehr ist. Wie wichtig es ist, seinen HIV-Status zu kennen, Kondome zu benutzen, sich regelmäßig untersuchen und die Viruslast testen zu lassen, also die Anzahl der Viren im Blut. Und ich ermutige sie, zu einer unserer Selbsthilfegruppen zu kommen, damit sie nicht allein bleiben und in eine Depression verfallen.“
Die Frau im Armenviertel, die Mukamana besucht, wohnt in einem der vielen kleinen Häuser. Vor der Tür spielen Kinder, drinnen kochen Kartoffeln auf einer Feuerstelle - die einzige Mahlzeit des Tages. Die beiden Frauen umarmen sich, setzen sich dann auf Plastikstühle.
Die 35-Jährige reicht Mukamana ihre Gesundheitskarte. Darauf trägt sie ein, wann sie ihre Medikamente einnimmt. Seit sie erfahren hat, dass sie HIV-positiv ist, tut sie es regelmäßig.
„Vor fünf Jahren bin ich für einen Schwangerschaftstest in die Klinik gegangen. Dort habe ich nicht nur erfahren, dass ich HIV-positiv bin, sondern schon Aids hatte, die Krankheit also bereits ausgebrochen war. Noch am selben Tag habe ich Medikamente bekommen. Es waren die Ärzte, die Emerthe zu mir geschickt haben. Seitdem kümmert sie sich um mich, bringt mir Medikamente und beantwortet meine Fragen. Ich weiß nicht, was ich ohne ihre Hilfe getan hätte. Ich fühle mich gesund und meine beiden Töchter wurden HIV-negativ geboren.“
Geringe Übertragungsraten von Schwangeren mit HIV auf ihre Babys
Die Übertragung des Virus von Müttern auf ihre Kinder ist in Ruanda heute nur noch selten. Sie liegt bei unter zwei Prozent. Das ist einer der Erfolge des landesweiten HIV-Programms. Eric Remera erinnert sich an die Anfänge. Der Arzt leitet die HIV-Abteilung des Rwanda Biomedical Centre, einer Behörde, die die Pläne des Gesundheitsministeriums in die Praxis umsetzt.
„Das nationale Programm gegen Aids wurde in Ruanda 1987 gestartet - vier Jahre, nachdem der erste Fall bekannt wurde. Aber alle Bemühungen wurden infolge des Genozids gegen die Tutsis im Jahr 1994 zunichte gemacht. Fast eine Million Menschen wurden dabei getötet, geschätzte 500.000 Frauen vergewaltigt. Sie müssen wissen, dass HIV auch als Waffe gegen Tutsi-Frauen eingesetzt wurde. Fast zwei Millionen Menschen waren damals auf der Flucht, nahezu 25.000 Kinder wurden zu Waisen. Nach dem Völkermord stand erst einmal der Wiederaufbau im Mittelpunkt. Es gab damals viele Infektionen und Tote, weil es keine HIV-Medikamente, keine Behandlung gab.“
Zugang zu Medikamenten für alle Infizierten seit 2016
In afrikanischen Ländern waren Medikamente erst wesentlich später erhältlich als in den Industriestaaten. Zudem stellten die hohen Preise fast unüberwindbare Hürden dar. So konnte Ruanda erst 2004 mit der antiretroviralen Behandlung beginnen und zunächst nur in einem knappen Dutzend medizinischer Einrichtungen. Seit 2016 hat jede und jeder Infizierte jedoch Zugang zu den lebensrettenden Medikamenten. Ein Meilenstein. Vor allem deshalb, weil Ruanda Medikamente und Behandlung in großen Teilen selbst finanziert. Die Kindersterblichkeit ist seitdem drastisch gesunken, die Lebenserwartung um Jahrzehnte gestiegen. Die Behandlung mit den Medikamenten sei jedoch nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg, betont Remera.
„In den ersten Jahren ging es um Aufklärung. Wir haben eine Kommission zur Bekämpfung von HIV eingesetzt, Forscher haben Richtlinien erarbeitet. Alle Maßnahmen wurden dezentral in den Kliniken vor Ort umgesetzt. Ruanda war eines der ersten Länder, in dem nicht nur Ärzte, sondern auch Krankenschwestern für die Behandlung ausgebildet wurden. Dazu kommen die peer educators, die dafür sorgen, dass sich die Leute testen lassen und ihre Behandlung fortsetzen. Das führt zu einer unterdrückten Viruslast, also einer geringen Anzahl von Viren im Blut, womit wiederum das Infektionsrisiko sinkt. Entscheidend ist auch der politische Wille - die Zusammenarbeit des Gesundheitssektors mit der Zivilgesellschaft und den lokalen Behörden.“
Aufgrund dieser gemeinsamen Anstrengung zählt Ruanda heute zu den Ländern weltweit, die besonders große Fortschritte bei der Bekämpfung der Infektionskrankheit gemacht haben. 2,3 Prozent der Erwachsenen sind in Ruanda HIV-positiv, mehr als 90 Prozent von ihnen kennen ihren Status, nehmen Medikamente und haben eine unterdrückte Viruslast. So sagt es das Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids, kurz UNAIDS.
Südafrika – weltweit die meisten HIV-positiven Menschen
Ein Rückblick: Im Jahr 1981 war Aids in den USA als eigenständige Krankheit anerkannt, das Virus wenige Jahre später nachgewiesen worden. Seitdem infizierten sich mehr als 84 Millionen Menschen weltweit mit HIV, mehr als 40 Millionen Menschen sind daran gestorben. Trotz vieler Bemühungen ist die Krankheit bis heute nicht heilbar, doch sie kann behandelt werden. Die mit Abstand meisten HIV-Positiven leben im östlichen und südlichen Afrika. In diesen Ländern ist auch die Zahl der Neuinfektionen höher als in anderen Regionen der Erde - Ruanda sticht daher als positives Beispiel heraus.

Bis 2030, so das Ziel der Vereinten Nationen, soll Aids für die öffentliche Gesundheit weltweit keine Gefahr mehr darstellen. Um das zu erreichen, müssten jedoch alle Länder ihre Strategie anpassen, betont Quarraisha Abdool Karim. Sie ist eine führende HIV-Wissenschaftlerin aus Südafrika – dem Land, in dem weltweit die meisten HIV-positiven Menschen leben – und sie sitzt im Lenkungsausschuss von UNAIDS.
“Wir müssen jetzt versuchen, all jene zu erreichen, die wir bislang noch nicht erreicht haben. Es ist wie bei einem Langstreckenlauf über 100 Meilen, die ersten 90 Meilen unterscheiden sich deutlich von den letzten zehn. Während wir also unseren Erfolg feiern, die größte Wegstrecke zurückgelegt zu haben, müssen wir überlegen, wie wir die verbleibenden Meilen schaffen. Die Lösungsansätze sind dabei von Land zu Land verschieden. Die Maßnahmen müssen an die lokale Situation angepasst werden, relevant und gezielter sein als bisher.“
HIV-Forscherin: Maßnahmen an die lokale Situation anpassen
In den USA, wo Schätzungen zufolge 1,2 Millionen HIV-Positive leben, sei das Risiko einer Infektion beispielweise in zwei Bevölkerungsgruppen besonders hoch: bei Menschen, die sich Drogen injizieren und bei Männern, die Sex mit Männern haben. Bislang hätten die Maßnahmen vor allem weiße Männer erreicht, sie müssten jetzt auch stärker People of Colour einbeziehen.
„Die Typologie der Epidemie ist weltweit sehr verschieden. In Subsahara Afrika, wo wir 70 Prozent der weltweiten Infektionen verzeichnen, ist es eine generalisierte Epidemie. Sie betrifft also alle, aber es gibt Teile der Bevölkerung, Schlüsselpopulationen, in denen die Zahl von Neuinfektionen und Toten besonders hoch ist, weil sie von den Gesundheitsangeboten nicht erreicht werden.“
Länder wie Ruanda konzentrieren ihre Maßnahmen zur Prävention und Versorgung deshalb nun vor allem auf diese Bevölkerungsgruppen. Ein wichtiges Instrument ist laut Eric Remera die sogenannte Prä-Expositions-Prophylaxe, kurz PrEP. Diese Medikamente schützen HIV-Negative vor einer Infektion.
„Wir geben diese Prophylaxe den Schlüsselpopulationen: Sexarbeiterinnen, Männern, die mit Männern Sex haben und Paare, von denen einer positiv und der andere negativ ist. Aber auch junge Frauen, die ein höheres Risiko haben, sich anzustecken, können diese Prophylaxe einnehmen. Mindestens 80 Prozent derer, die diesen Schutz brauchen, bekommen ihn auch. Die Einnahme ist freiwillig, schließlich sprechen wir von einem Medikament, das lebenslang eingenommen werden muss.“
Netzwerk aus peer educators kümmert sich um Betroffene
Nicht weit von Remeras Büro hat das zivilgesellschaftliche Netzwerk für Menschen, die mit HIV leben, kurz RPP+, sein Zentrum eingerichtet. Hier, inmitten von Ruandas Hauptstadt Kigali, kommen die peer educators regelmäßig zusammen, um sich auszutauschen. Während der Covid-Pandemie sei ihre ehrenamtliche Arbeit besonders wichtig gewesen, betont Sage Semafera, die Leiterin des Netzwerks. Während des Lockdowns haben sie nicht nur Medikamente und Selbsttests verteilt, sondern auch Konflikte entschärft.
„Es gab Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt, weil in Familien bislang verheimlichte HIV-Infektionen bekannt wurden. Auch in Internaten und Studentenwohnheimen gab es Probleme, wenn der HIV-Status unfreiwillig bekannt wurde. Eine weitere Gruppe die Unterstützung benötigt, sind Mitglieder der LGBTI-Community. Lesbische Frauen, Männer, die Sex mit Männern haben oder Transgender leiden ohnehin unter einem Stigma und das verstärkt sich durch eine HIV-Infektion.“
Damit auf den letzten Meilen im Kampf gegen HIV und Aids wirklich alle erreicht werden, hat das Netzwerk eine anonyme Hotline eingerichtet, die jeden Tag von sieben Uhr morgens bis sechs Uhr abends erreichbar ist. Zwei junge Ehrenamtliche beantworten Fragen: Etwa was bei der Einnahme der antiretroviralen Medikamente zu beachten ist, oder welche Kliniken empfehlenswert sind. Sie wollen ebenso anonym bleiben, wie die Menschen, die sie beraten.
„Mich motiviert der Wunsch, dass es hier in Ruanda irgendwann keine Neuinfektionen mehr gibt. Und dass HIV-Positive nicht mehr stigmatisiert werden. In Hinblick auf LGBTI hat sich schon viel verändert. Wir können uns frei in der Öffentlichkeit bewegen, ohne offen angefeindet zu werden. Die Leute halten sich zurück, weil die Regierung jegliche Diskriminierung untersagt. Aufgrund traditioneller und religiöser Ansichten gibt es aber weiterhin ein Stigma. Deshalb ist unser Netzwerk so wichtig: wir klären auf, wir haben peer educators in der LGBTI-community, gehen in die Familien und versuchen, den anderen zu zeigen, dass wir Menschen sind wie sie.“
Teenagern und junge Frauen sind weltweit besonders betroffen
Wer keine Angst hat, angefeindet oder ausgegrenzt zu werden, wer sich nicht selbst stigmatisiert, also für seine eigene Infektion verantwortlich macht, hat weniger Hemmungen, eine Klinik aufzusuchen. Damit steigt der Anteil derer, die ihren Status kennen und sich behandeln lassen und damit sinkt auch das Infektionsrisiko. Das ist nicht nur in Ruanda so, sondern in allen Ländern der Welt. Diskriminierung und soziale Ungleichheit gelten dagegen als Treiber der HIV-Pandemie. Davon besonders betroffen seien junge Frauen unter 25 Jahren, so die HIV-Wissenschaftlerin Quarraisha Abdool Karim aus Südafrika. Im Jahr 2021 hat sich laut UNAIDS weltweit alle zwei Minuten eine Teenagerin oder junge Frau mit HIV angesteckt.
„Wir befinden uns jetzt im vierten Jahrzehnt der Pandemie. Und wir sollten uns eingestehen, dass sich hier auch fundamentale strukturelle Probleme auswirken, grundlegende Ungleichheit und Ungerechtigkeiten. Sie sind dafür verantwortlich, dass Frauen unverhältnismäßig oft betroffen sind. Es geht hier um Themen wie Gender-Normen, um geschlechtsspezifische Gewalt, um patriarchale Machtstrukturen. Es ist kein Zufall, dass noch immer eine von vier Infektionen in Subsahara Afrika junge Frauen trifft.“
Junge Frauen bräuchten mehr Zugang zur Prävention und mehr Auswahl an Methoden, sich zu schützen, fordert Abdool Karim. Als Wissenschaftlerin an Südafrikas führendem Forschungsinstitut Caprisa war sie maßgeblich an der Entwicklung eines antiretroviralen Vaginal-Gels beteiligt. Für die Unterbrechung der Infektionskette sei es aber ebenso wichtig, junge Männer dafür zu gewinnen, sich testen und behandeln zu lassen.

„Vor ein paar Jahren haben wir den Übertragungskreislauf nachgezeichnet, indem wir das Erbgut von Viren Neuinfizierter sequenziert haben. Wir konnten nachweisen, dass Männer über 25 jüngere Frauen anstecken – das ist ein Merkmal der Epidemie in Sub-Sahara Afrika. Durch eine Test-Kampagne haben wir herausgefunden, dass etwa ein Drittel der Männer neu mit HIV infiziert ist. Das bedeutet, dass die Viruslast und die Ansteckungsgefahr besonders hoch sind. Aber diese Männer lassen sich normalerweise nicht testen, weil sie sich gesund fühlen. Sie fallen durch das Raster der Gesundheitssysteme. Das ist eine große Herausforderung, die neue Strategien erfordert. Denn, wenn diese Männer ihren Status kennen, dann wirkt sich das auch auf die Infektionsraten unter jungen Frauen aus.“
Soziale Ungleichheit verstärkt Ansteckungsraten
Die Covid-Pandemie, die weite Teile der Welt in einen Ausnahmezustand versetzte, stellte für die Bekämpfung von HIV einen herben Rückschlag dar: Wesentlich weniger Menschen haben währenddessen einen HIV-Test gemacht oder eine Behandlung begonnen. UNAIDS zählte 2021 weltweit 1,5 Millionen Neuinfektionen, jede Minute ist ein Mensch infolge der Aids-Pandemie gestorben. Auch die soziale Ungleichheit sei noch offensichtlicher geworden, betont Abdool Karim.
“Während Corona zunehmend ein endemisches Niveau erreicht und es Impfungen gibt, besteht noch immer ein ungleicher Zugang dazu. Im Schatten der Covid-Pandemie wirkt sich auch der Klimawandel massiv auf die Gesundheit aus. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht und unterbrechen dabei oft ihre HIV-Behandlung. Covid sollte uns vor Augen geführt haben, dass wir alle voneinander abhängig sind, dass eine jede Pandemie nur gemeinsam besiegt werden kann. Wir müssen die Gesundheitssysteme weltweit stärken und dürfen niemanden zurücklassen. Sonst bleibt es bei einem „wir und sie“ und wir werden dieses Gespräch noch in Jahrzehnten führen. Wir haben die Werkzeuge, um das Ziel 2030 mit Blick auf HIV zu erreichen. Die Frage ist, ob auch der politische Wille dazu besteht.“
Hoffnung auf eine Impfung gegen HIV - aus Afrika
Eine Hoffnung aber wurde durch die Covid-Pandemie genährt: Die auf eine Impfung, angesichts des Durchbruchs bei der mRNA-Technologie. Wissenschaftlerin Abdool Karim warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen.
„Es gibt viele Herausforderungen bei der Entwicklung einer HIV-Impfung. Es gibt zwar Hoffnungen angesichts der mRNA-Technologie, aber ich verspreche mir mehr von den sogenannten breitneutralisierenden Anti-HIV-Antikörpern. Sie schützen gegen unterschiedliche HIV-Stämme und wurden weltweit bei einigen Menschen nachgewiesen. Wir erforschen noch, wie sie sich entwickeln, in welchem Umfang sie schützen und wie wir diesen Prozess nachahmen können. Das ist ein wesentlich klügerer Ansatz für eine Impfstoffentwicklung.”
Die Corona-Pandemie hat die Staaten Afrikas etwas Weiteres gelehrt: Der Impfstoff wurde global ungleich verteilt, sie sind daher heute dabei, eine eigene Vakzin-Produktion aufzubauen. Von zentraler Bedeutung ist für sie, künftig auch einen HIV-Impfstoff herzustellen. Eric Remera vom Rwanda Biomedical Centre:
„In der Epidemiologie gibt es unterschiedliche Präventionsmaßnahmen, aber die primäre ist die Impfung. Mit einer HIV-Impfung könnten wir das Ziel, Aids zu beenden, schneller erreichen. Es wäre eine große Errungenschaft für unser Aids-Programm und für die Welt.“





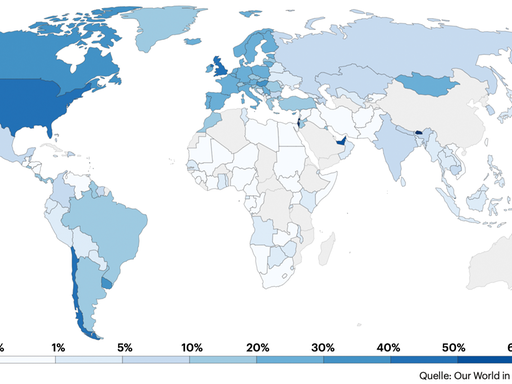








![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


