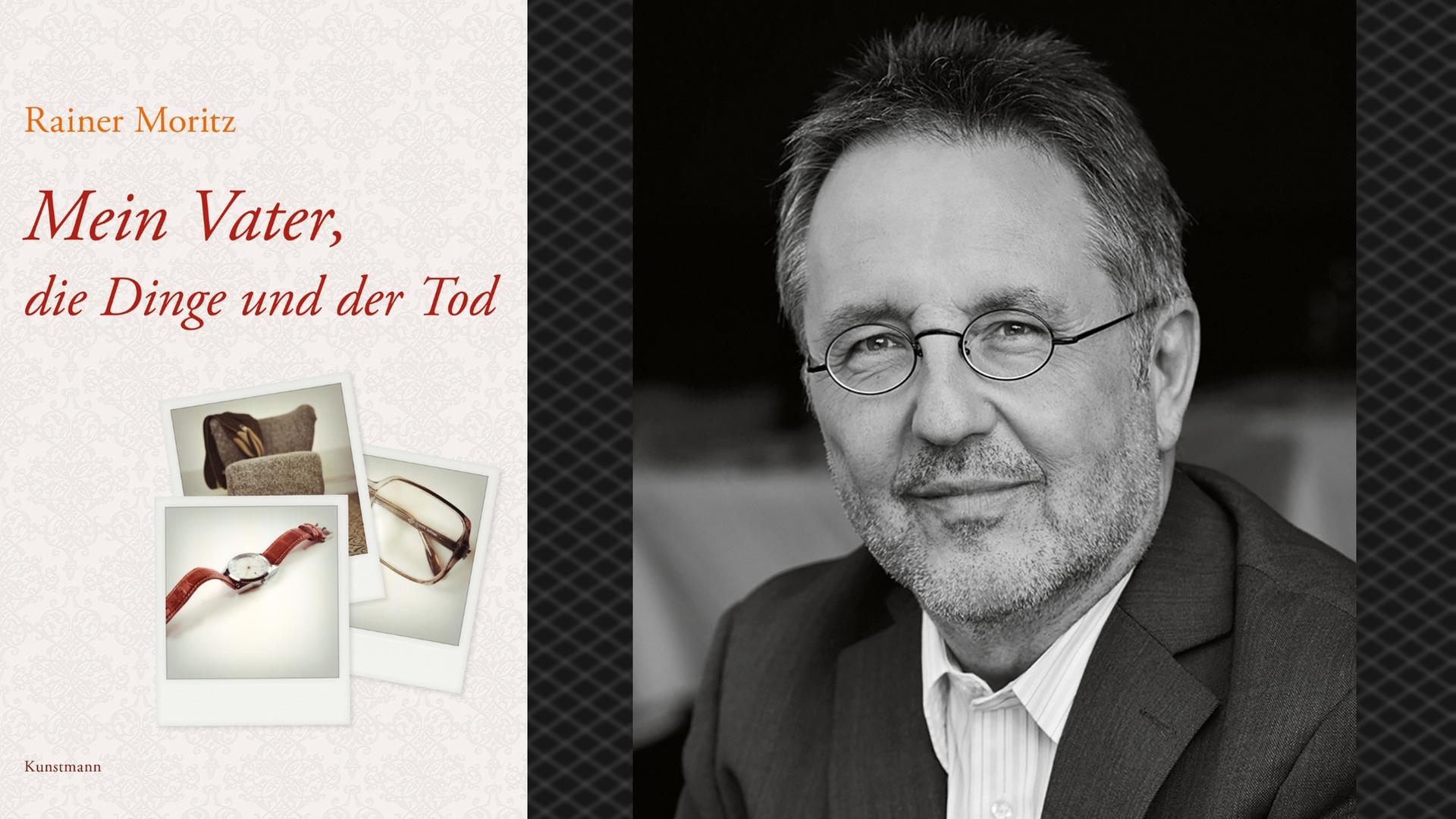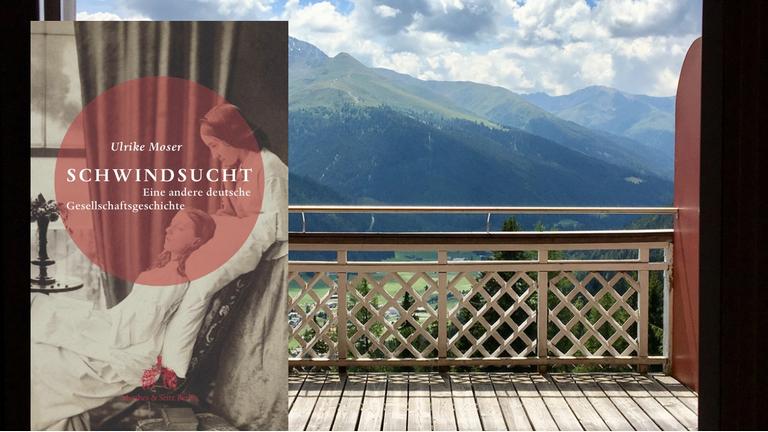Der versagende Körper ist seit jeher ein Topos in der Literatur. Zahllos sind die Krebsbücher auf dem Buchmarkt und die Auseinandersetzungen mit der eigenen Sterblichkeit, die zwangsläufig den eigenen und den Tod anderer umkreisen. Die Schriftstellerin Ruth Schweikert stellt sich jetzt in diese Tradition. Am 9. Februar 2016 erhält sie den Befund, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Was tun mit so einer Nachricht?
Literaten gehen damit in der Regel um, indem sie sich selbst erkunden, die Krankheit gegen das Licht halten wie einen ungeschliffenen Stein, indem sie sich selbst inspizieren und indem sie aufschreiben, was sie denken, aber natürlich auch lesen, was andere mit ihren Krebserkrankungen angefangen haben. Selbst die unsinnigste Studie im Internet saugt Ruth Schweikert auf und die Krebsbücher der Kollegen sowieso. Sie liest etwa Walter Matthias Diggelmanns "Tagebuch einer Krankheit" oder Péter Esterházys "Bauchspeicheldrüsenkrebstagebuch". Beiden dient das Schreiben als Möglichkeit, etwas auszudrücken, über das man nicht reden kann oder nicht reden mag.
"Als ich am 9. Februar 2016 erfuhr, dass ich an einer hochaggressiven Form von Brustkrebs erkrankt war, wusste ich sofort, dass ich darüber schreiben würde – auch wenn ich noch keine Ahnung hatte, wie, unter welchen Umständen, und welche Form dieser Text dereinst haben könnte; diese sofortige, unmittelbare Gewissheit ging jedem Gedanken voraus, jedem Versuch, wenigstens halbwegs zu ermessen, zu begreifen, was diese Diagnose bedeutete."
Aufsaugen von eigenem und fremdem Leid
Das Schreiben als Ausweg für das nicht Reden können. Von der Scham, die mit der Krankheit einhergeht, weiß Ruth Schweikert ebenso viel wie von dem Leid um sie herum. Ihre eigenen Erfahrungen kontrastiert sie mit denen anderer, erzählt von Krankheits- und Todesfällen, Fehlgeburten und Beerdigungen in der eigenen Familie, im Bekanntenkreis, in der Gegenwart. Mehrmals schaut sie sich etwa ein Interview mit Roger Willemsen an, der im Februar 2016, keine sechs Monate nach seiner Krebsdiagnose, im Alter von 60 Jahren stirbt.
Schweikerts Buch hinterlässt dabei den Eindruck eines Tagebuchs, ungeordnete Gedanken finden sich darin, aber auch Textnachrichten, von denen nicht immer klar ist, ob sie oder andere sie geschrieben haben. Es ist ein Hin- und Herschweifen, ein sich Wälzen in Gedanken über den Tod.
Mal angstvoll, mal trocken und schnoddrig
Ihr Vater ist im Alter von 91 Jahren gestorben, was Anlass gibt, sich mit ihm zu beschäftigen. Die Frage 'Wohin gehe ich?' führt nun einmal unweigerlich zur Frage 'Woher komme ich?'. Ruth Schweikert erzählt von Familienbanden und den vielfältigen Formen der Angst. Und im nächsten Moment schon wieder sehr trocken und schnoddrig vom eigenen Überlebenskampf:
"ich bin seit sonntag in edenkoben, bis übermorgen montag noch, dann immer mal wieder, hoffentlich! bis mitte dezember; plage mich mit dem büchelchen herum, und segne zugleich schon das cover ab, das gut kommt, aber der text? Ich bin so fahrig leider, und auch voller ängste, voller bobochen und wehwehchen, und dann jogge ich wieder bis mir die zunge aus dem hals hängt, bloss damit ich wieder dran glaube, dass ich noch nicht gleich sterbe, nicht übermorgen, und auch nicht morgen; ich werde eines Morgens beim Joggen zusammenkrachen, krebsfrei und kerngesund"
Alltagston einer Krebspatientin
Die Autorin durchlebt schon sprichwörtlich gewordene Wechselbäder der Gefühle, die wohl zum Krankheitsbild gehören, wenn nicht zum Menschsein allgemein. Dabei versucht sie, einen Zugang zum eigenen kranken Körper zu finden, um zu begreifen, was sich nicht begreifen lässt. "Warum ich?" fragte der Theaterregisseur Christoph Schlingensief immer wieder in seinem Tagebuch einer Krebserkrankung mit dem Titel "So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein!" Das wäre nicht der Stil von Ruth Schweikert, zu weinerlich, zu egoman, zu naiv. Die Frage nach Zufall und Schicksal streift sie am Rande. Ihr eigenes Leiden betrachtet sie bei allen Gefühlsschwankungen eher nüchtern, mit nur wenigen poetischen Ausschlägen. Dabei leiten ihre Stimmungen geradezu ihr Schreiben, mal herrscht Depression vor, dann Sarkasmus, mal Forscherdrang, dann Galgenhumor.
Derweil durchläuft die erzählende Autorin die immer gleichen Stationen einer Krebserkrankung, wie sie überall um uns herum andauernd durchlaufen werden und wie sie natürlich auch in der Literatur schon unzählige Male beschrieben wurden: Von der Diagnose und dem ersten Schock über Chemotherapie und Portkatheter bis zu Übelkeit und Haarverlust. Ein unwürdiger Kampf. Doch Ruth Schweikert fügt dem bereits vielfach Gesagten einen neuen Ton hinzu, es ist ein Alltagston. Nah am Leben. Feinfühlig und sich der eigenen und der Fähigkeiten der Literatur stets bewusst.
"Wenn wir erzählen, beschreiben wir die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie sie uns vorkommt; das gilt natürlich genauso für die Literatur; sie beschreibt die Welt nicht, wie sie ist – das ist ihre Schwäche und ihre große Stärke zugleich, indem sie zuweilen jene Räume eröffnet, die diese Welt erst bewohnbar machen für die ungewisse Dauer eines Lebens."
Ein Buch zum Trost
So ist dieses Buch nicht nur eines über die Krankheit, das Sterben und den Tod geworden, sondern auch eines über das Schreiben. In der eigenen Literatur ist die Schriftstellerin Ruth Schweikert dem Tod natürlich schon begegnet, allein deswegen, weil sie manch eine ihrer eigenen Figuren sterben sah. Diesmal schreibt sie auch, um zu verstehen, was ihr und uns geschieht. Herausgekommen ist ein sehr leises, zwangsläufig auch persönliches, beinahe intimes Buch. Ein Buch, das von der Gewissheit handelt, sterben zu müssen und von der Zuversicht, es noch nicht bald zu tun. Die Autorin spricht sich darin Mut zu, und ihr neues Buch trägt diesen Mut weiter an all diejenigen, die ihn brauchen.
Ruth Schweikert: "Tage wie Hunde"
S. Fischer, Frankfurt am Main, 198 Seiten, 20 Euro.
S. Fischer, Frankfurt am Main, 198 Seiten, 20 Euro.