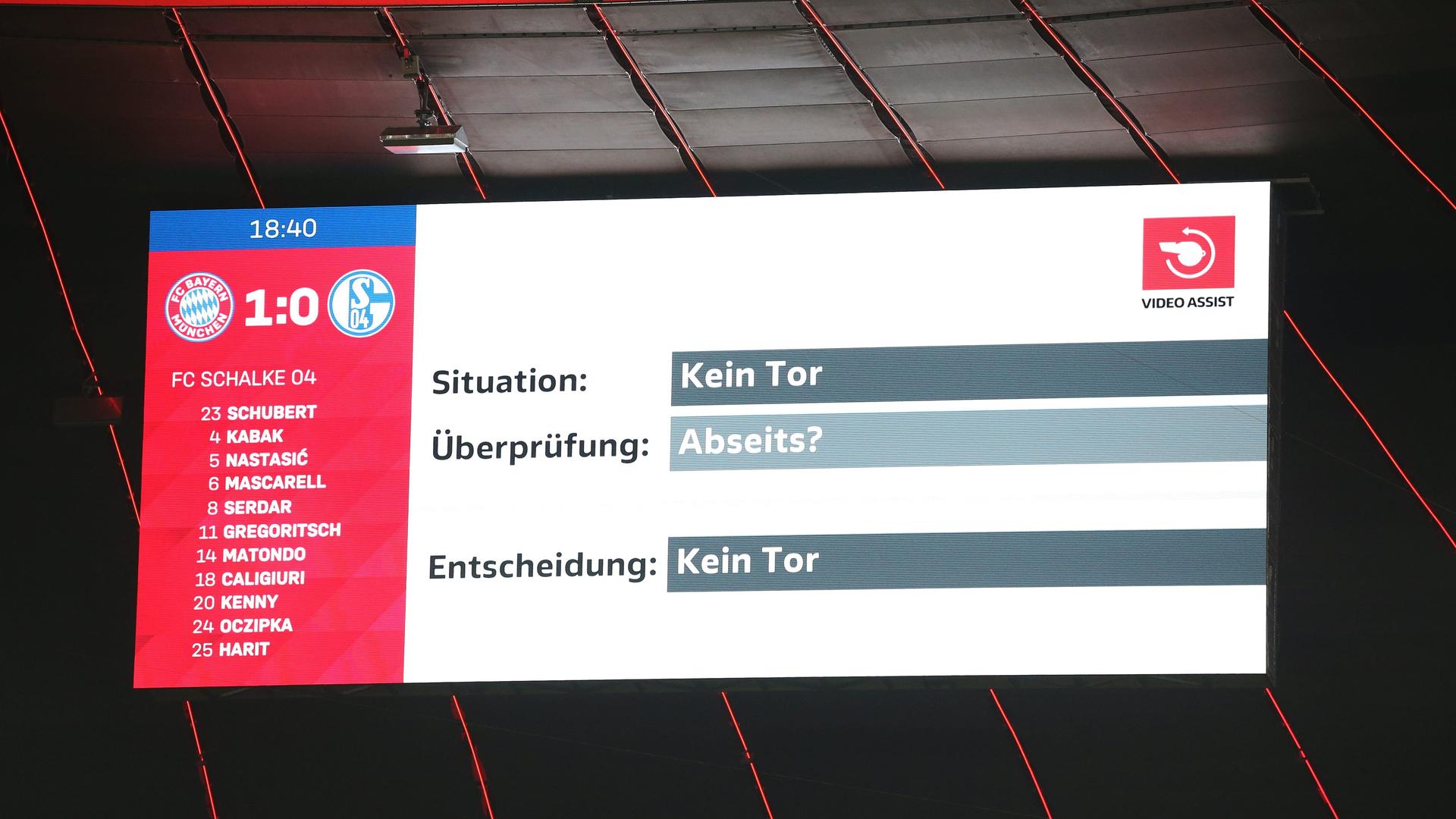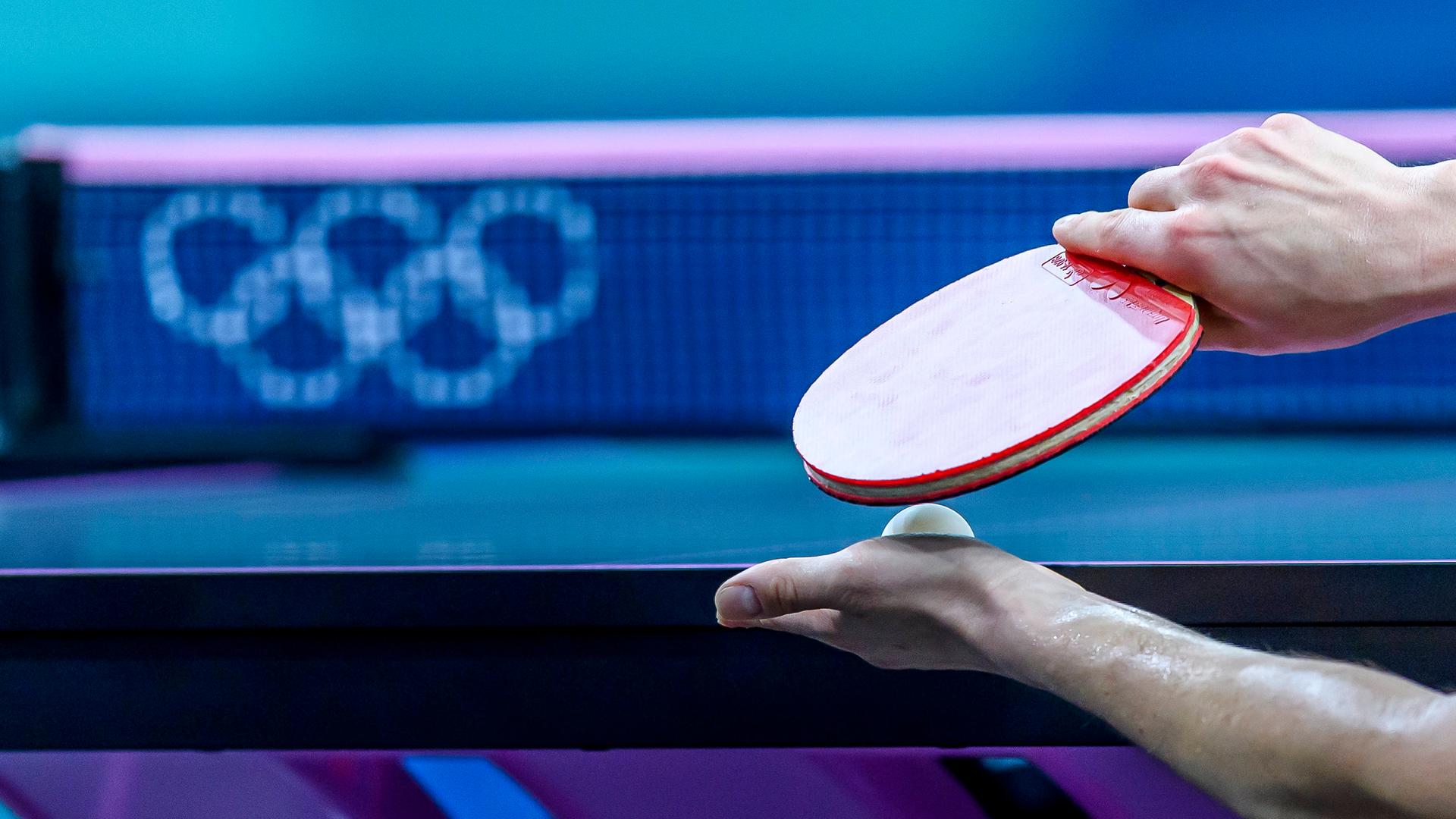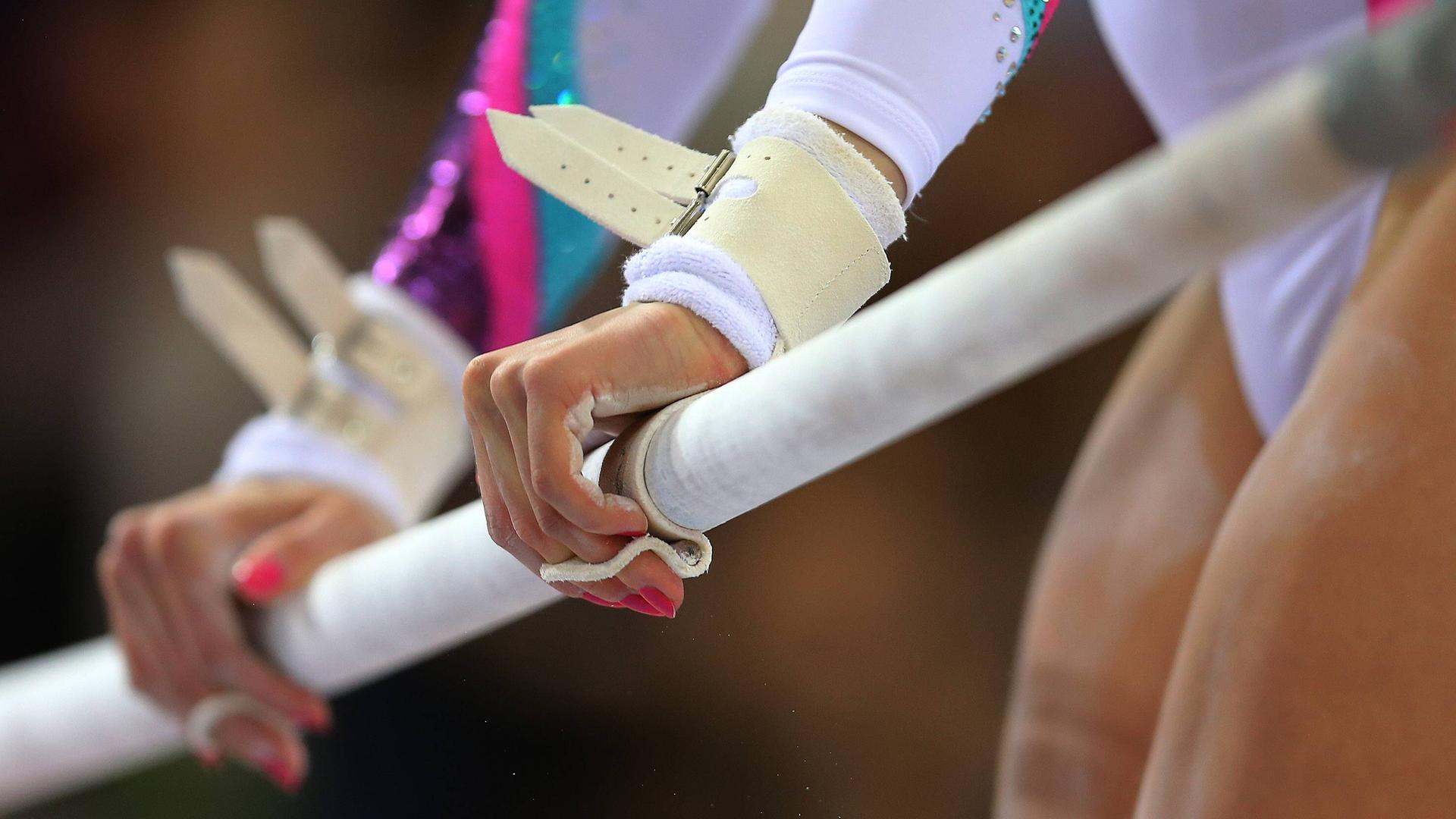Nun liegen zwei Regelwerke vor. Mit unterschiedlichen Ausgangspositionen, aber letztendlich mit dem gleichen Ziel: "Jeder möchte interpersonale Gewalt verbieten und ahnden", stellt Caroline Bechtel von der Sporthochschule Köln fest. Sie hat gemeinsam mit Martin Nolte, dem Leiter des Instituts für Sportrecht einen Muster-Safe-Sport-Code für Spitzensportverbände erarbeitet.
Ein Forschungsprojekt, im September 2022 beantragt, ein halbes Jahr später ging es los. Das Ziel: „Eine rechtssichere und funktionierende Rechtsgrundlage zu schaffen, damit man zum einen Verstöße erst einmal definiert und auch feststellen kann - und dann diese auch zu ahnden, zu sanktionieren.“
Turnerbund und Reiterliche Vereinigung als Kooperationspartner
Ein Forschungsprojekt für die Praxis. Denn es gab zwei Kooperationspartner: den Deutschen Turnerbund und die Deutsche Reiterliche Vereinigung. Zwei der zehn mitgliederstärksten Spitzensportverbände in Deutschland. Mit insgesamt mehr als fünfeinhalb Millionen Mitgliedschaften in ihren Vereinen repräsentieren sie etwa ein Fünftel des organisierten Sports in Deutschland.
Constanze Winter ist Justiziarin der FN, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Die hat in den vergangenen Jahren ihr Regelwerk mehrfach angepasst in Bezug auf die Sanktionierung von sexualisierter Gewalt im Pferdesport und dabei erkannt: "Dass das nicht das gesamte Thema sein kann, sondern dass es andere Gewaltformen gibt, die im Sport auch nichts verloren haben und für die wir auch geeignete Regeln brauchen.“
Ganz allgemein sind das diejenigen Verstöße im Sport, die möglicherweise nicht strafrechtlich relevant sind, aber durch das Sportregelwerk erfasst und geahndet werden können: Etwa, wenn Personen im Sport ihre Macht ausnutzen und seelische Gewalt ausüben, indem sie Athletinnen und Athleten zum Beispiel anschreien, beschimpfen mit Worten erniedrigen. Oder durch körperliche Gewalt etwa in Form brutaler Trainingsmethoden, Essens- und Wasserentzug oder Ähnlichem.
Umsetzung des Regelwerks ist eine Herauforderung
Was er als Verstoß auffasst muss jeder Verband für sich selbst festlegen und so sportartspezifische Einzelheiten berücksichtigen. Ist das geschehen, geht es an die Umsetzung des Regelwerks. Justiziarin Constanze Winter sieht da eine große Herausforderung: "Pferdesportlerinnen und Pferdesportler, die Trainerinnen und Trainer, die Vereinsmitglieder, die Vereinsvorsitzenden, all diese müssen sich dem Regelwerk unterwerfen.“ Heißt: Das Regelwerk anerkennen.
Zusätzlich hält die FN fest, „dass man offen ist für das Tätigwerden anderer, dritter, neutraler Stellen wie dem Zentrum für Safe Sport, das ist explizit in dem Code auch angelegt.“
Constanze Winter weist aber auch darauf hin, dass sich dann alle Mitglieder in Reitvereinen zusätzlich auch noch dem Code eines Safe Sport Zentrums unterwerfen müssten.
Also etwa dem Safe Sport Code, mit dessen Entwurf die Interessenvertretung Athleten Deutschland und der Deutsche Olympische Sportbund eine Frankfurter Anwalts-Kanzlei beauftragt haben. Es ging um Antworten auf Fragen, die aufgetaucht waren im sogenannten „Stakeholder-Prozess“. Ein vom Bundesinnenministerium moderiertes Diskussionsverfahren mit zahlreichen Beteiligten in vielen Runden auf dem Weg zu einem unabhängigen, übergeordneten „Zentrum für Safe Sport“. Das soll nach aktueller Planung vielfältige Aufgaben zum Schutz von Athletinnen und Athleten im Leistungs- und Breitensport übernehmen.
Safe-Sport-Codes unabhängig voneinander entwickelt
Nun hat die Anwaltskanzlei ein knapp 300 Seiten umfassendes Gutachten vorgelegt, mit rechtlichen Grundlagen und Verfahrensregeln, wie ein geplantes Zentrum für Safe Sport mit welchen Aufgaben rechtssicher an den Start gehen kann. Und auch einen auf das Zentrum ausgerichteten Safe Sport Code.
Caroline Bechtel von der Sporthochschule stellt fest: Als sie vor anderthalb Jahren ihr Forschungsprojekt beantragt hätten, hätte das Diskussionsverfahren, der sogenannte „Stakeholder-Prozess“, über ein Zentrum für Safe Sport noch gar nicht begonnen: „Wir haben das völlig unabhängig davon entwickelt, sind innerhalb der Strukturen und Regelwerke der Verbände eben geblieben, unserer Kooperationspartner.“
Dass Athleten Deutschland und DOSB in einem Gutachten rechtliche Grundlagen für die diversen Aufgaben und Verfahren eines Zentrums für Safe Sport geklärt haben wollten, ist für die Wissenschaftlerin nachvollziehbar. Ihr geht es um den Auftrag für den Safe Sport Code: "Wir haben nie so richtig verstanden, warum dieser zweite Code überhaupt beauftragt wurde in dem Wissen, dass unserer ja schon erarbeitet wird.“
Maximilian Klein von Athleten Deutschland, einem der Auftraggeber des zweiten Codes hat vor einigen Tagen in Richtung Forschungsprojekt gesagt: „Wir hatten unsererseits immer die Notwendigkeit gesehen und auch die Bereitschaft signalisiert, sich da frühzeitig abzustimmen, das war im Laufe des Prozesses nicht möglich. Aber wir halten es weiterhin für wichtig, dass man jetzt die Ergebnisse im weiteren Verlauf würdigt und übereinanderlegt“.
Innenministerium im "Gespräch mit allen Beteiligten"
Ihr Forschungsprojekt sei zunächst den beiden Kooperationspartnern verpflichtet gewesen, betont Caroline Bechtel. Und bei einem Austausch mit dem Kanzleiteam sei die unterschiedliche Aufgabenstellung und die unterschiedliche Konzeption schnell klar geworden: "Die Arbeit, die sie geleistet haben – das erkennen wir alles an. Das ist gar nicht die Frage. Wir fragen uns: Wie soll es jetzt weitergehen und was ist unsere Aufgabe dabei? Und wir wollen nicht, dass wir als wissenschaftliches Alibi für irgendeine Lösung, hinter der wir nicht stehen, verwendet werden."
Jetzt gibt es also zwei Safe Sport Codes: Und nun? Das muss nach Ansicht vieler jetzt das Bundesinnenministerium beantworten. Wir haben das BMI kontaktiert und auf insgesamt zehn Fragen zum weiteren Vorgehen diese Antwort bekommen: "Wir sind derzeit im Gespräch mit allen Beteiligten, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die beiden Vorschläge für Safe Sport Codes sind wichtige Diskussionsbeiträge, die jetzt mit allen Stakeholdern, insbesondere den Vertreterinnen und Vertretern der Betroffenen, erörtert werden. Für die Gründung des Zentrums für Safe Sport halten wir an der bisherigen Zeitplanung fest."
Der Plan des Bundesinnenministeriums sieht vor: Das Zentrum soll im kommenden Jahr in die Startphase gehen. In welchem Rahmen und mit welchen Aufgaben scheint angesichts der aktuellen Situation völlig unklar.
Laut Sportjuristin Caroline Bechtel hat der Deutsche Turnerbund bereits entschieden, den Safe Sport Code des Forschungsprojekts umsetzen zu wollen.