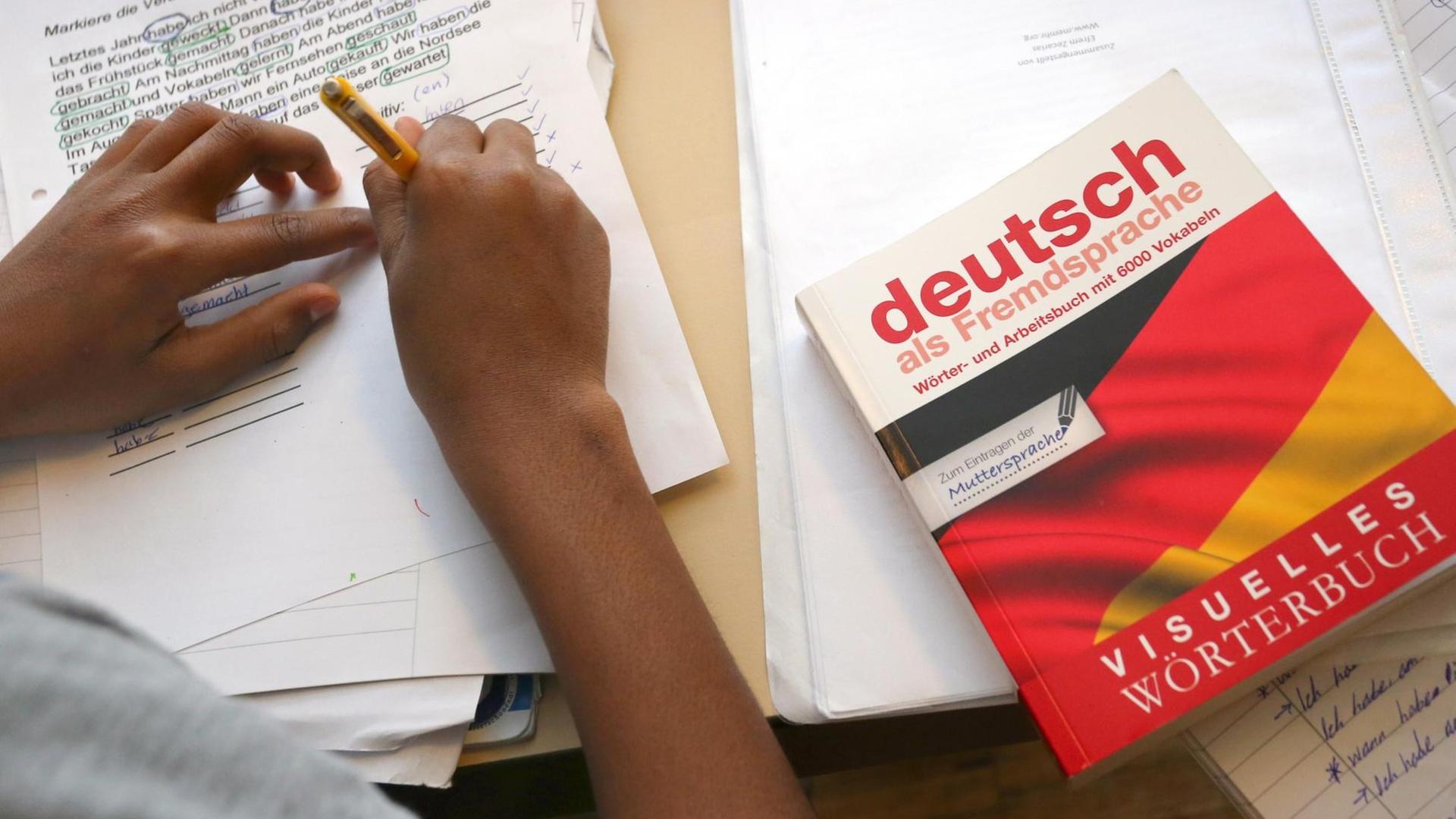Gisa Funck: Herr Trojanow, Sie haben Ihr Buch Ihren Eltern gewidmet – und zwar mit den Worten: "Meinen Eltern, die mich mit der Flucht beschenkten." Das klingt ungewöhnlich und auch provokant. Denn beim Wort "Flüchtling" oder "Flucht" denkt man heute eher an "Krise", "Problem" oder Katastrophe, aber nicht an "Geschenk". Warum empfinden Sie die Flucht mit ihren Eltern nach Deutschland vor über 35 Jahren heute als "Geschenk"?
"Entlassung in eine neue Existenz"
Ilija Trojanow: Ich glaube, die meisten Menschen, die geflohen sind, empfinden die geglückte Flucht als Rettung. Insofern ist "Geschenk" näher assoziativ als "Leid", "Not". Denn das hat man ja zurückgelassen. Aber es geht ja darum, dass das ganze Buch gängige Denkmuster in Frage stellt. Und eines von denen ist ja die Flucht als etwas Negatives zu sehen und die Folgen der Flucht relativ simpel auf bestimmte ökonomische Herausforderungen zu reduzieren. Und nicht zu sehen, dass es tatsächlich die Entlassung ist in eine neue Existenz, in eine Existenz, die per se sehr vielfältig, vielschichtig und komplex ist. Und das beschreibe ich in dem Buch.
Funck: Ihr Buch heißt "Nach der Flucht" und handelt von der Phase nach einer der Emigration, nach der Ankunft im neuen Heimatland. Allerdings klingt Ihre Diagnose erst mal ziemlich erschreckend für jeden Integrationsbeauftragten: Sie schreiben nämlich, die Flucht- oder Emigrationserfahrung würde für Migranten "ein Leben lang fortwirken". Beziehungsweise an anderer Stelle heißt es:
"Der Geflüchtete hat das Land seiner Geburt verlassen, aber er lässt es nie hinter sich." (Zitat)
Doch, wenn der Flüchtling lebenslang Flüchtling bleibt, der Migrant lebenslang Migrant: Wie soll, kann er dann überhaupt je heimisch werden in der Fremde?
"Monokulturelle Ansprüche"
Trojanow: Naja, Sie benutzen natürlich Begriffe, die ich absichtlich in dem Buch nicht benutze! Das Wort "Integration" kommt nicht vor. Es geht darum zu zeigen, dass man durchaus drei-, vierdimensional denken kann bei Menschen. Und nicht so wie der momentane Diskurs; alles immer nur eindimensional in Dichotomien.
Also, diese Dichotomie: "Alte Heimat – Neue Heimat" ist völliger Unsinn! Das kann absolut jeder, der eine ähnliche Biografie hat wie ich, Ihnen erzählen. Man ist aufgespannt zwischen sehr vielen verschiedenen Sehnsüchten, Verbindlichkeiten, Herausforderungen. Es ist genauso unmöglich, das Alte völlig ad acta zu legen, wie es unmöglich ist, das Neue hundertprozentig zu umarmen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass solche Menschen – und es sind ja zig Millionen auf der Welt – tatsächlich in einem Pluralismus leben oder in einem Kosmopolitismus. Das ist unsere Realität. Und anstatt diese Realität wegzuwischen mit irgendwelchen monokulturellen Ansprüchen, muss man sie erst einmal anerkennen.
Funck: Sie schildern den Einwanderer ja in einem spezifischen Dilemma. Im neuen Land bleibt er trotz erfolgreicher Anpassung für viele Einheimische sozusagen auf ewig der Fremde. Und in seiner alten Heimat wird bald auch schon als Fremder wahrgenommen – und fühlt sich auch selbst nicht mehr richtig zugehörig, wenn er irgendwann einmal wieder zurückkehrt. Woran liegt das? Warum kann jemand, der ausgewandert ist, der geflohen ist, so schlecht seine alte Heimat zurückzukehren?
"Das Land ist nie die Heimat"
Trojanow: Na, weil die alte Heimat einfach nicht mehr existiert. Sie haben ein Land verlassen. das Land entwickelt sich weiter, Sie entwickeln sich weiter. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass sie sich beide in dieselbe Richtung entwickeln. Insofern ist der Satz: "Dann gehen Sie doch zurück, wo Sie hergekommen sind!" Ein Ding der pragmatischen Unmöglichkeit. Das Land, das man verlassen hat, gibt es nicht mehr.
Und jeder, der lange lange Zeit ein Land oder einen anderen Menschen nicht gesehen hat, kennt ja das Phänomen. Man beginnt im Kopf natürlich ein relativ künstliches entfremdetes Bild zu bewahren, es ist sozusagen eine individuelle Musealisierung. Man verklärt das oft, manchmal aber verdammt man es, je nachdem, wie man voneinander geschieden ist. Und es gibt keine Aktualisierung. Wobei ich das Wort "Heimatland" ja auch nie benutze, ich glaube, das ist auch ein unsinniges Wort. Das Land ist nie die Heimat. Das ist reine Ideologie, wenn man behauptet, Deutschland ist meine Heimat.
Tatsächlich ist die Heimat natürlich ein bestimmter Flecken, bestimmter Sprachklang, vor allem aber die Menschen, die nächsten, diejenigen, die man liebt. Und wenn man irgendwo weit weg ist, gibt es keinen Moment der Erneuerung. Es gibt ja Passagen, in denen ich beschreibe, wie schwierig zum Beispiel die Gespräche sind mit den Daheimgebliebenen. Wie sehr man aneinander vorbeiredet. Insofern ist man in der vermeintlichen Fremde, die gerade dabei ist, zu etwas Neuem, Eigenen zu werden, auch isoliert von dem Ehemaligen.
Funck: Ist Ihnen das auch so ergangen? Sind Sie noch mal nach Bulgarien zurückgekehrt und haben sich da fremd gefühlt?
Heimatland: "Ein Wort der aggressiven Selbstbehauptung"
Trojanow: Absolut. Das ergeht jedem so. Ich bin im Dezember 1989 zurückgekehrt, und das war genauso, wie ich schreibe, ein völliger Kulturschock.
Funck: In der aktuellen Debatte um Flüchtlinge und Migranten spielt der Begriff des Heimatlandes immer wieder eine große Rolle. Ein Begriff, Sie erwähnten es gerade schon, den Sie in Ihrem Buch absichtlich vermeiden und überhaupt nicht mögen. Warum eigentlich nicht?
Trojanow: Weil Heimatland politisch instrumentalisiert wird. Das Wort "Heimatland" ist für mich eigentlich ein Unwort, weil es nur im Sinne einer Ausgrenzung gegenüber anderen benutzt wird. Das heißt: Es ist eigentlich ein aggressives Wort. Ein Wort der aggressiven Selbstbehauptung gegenüber anderen. Während das individuelle, persönliche Heimatgefühl ja etwas sehr Schönes ist. Das ist etwas Sinnliches, etwas Kulturelles, etwas zutiefst Emotionales.
Funck: Ja, Sie schreiben: Ihr Zuhause oder Ihre Heimat können auch in dem Klang eines Saxofons liegen oder zwischen zwei Buchdeckeln, bei Freunden oder beim Besuch in einem Café. Heißt das, dass Sie diesen Heimatbegriff gar nicht als geografische Kategorie sehen, sondern mehr so als ein Daseins- und Seelenzustand?
Trojanow: Das könnte man so beschreiben! Wobei ich glaube: So sehen das alle Menschen, wenn sie ehrlich sind! Das können Sie auch in Gesprächen, können Sie das gerne überprüfen: Wenn Sie dann die Leute fragen: Was ist denn wirklich Heimat? Dann kommen sehr konkrete Sachen. Dann kommen bestimmte Landschaften, bestimmte Gerüche, bestimmte Erinnerungen, bestimmtes Essen. Es ist immer sinnlich-konkret. Die Nationalstaatlichkeit als Grundlage einer Heimat ist meiner Ansicht nach eine reine Fiktion. Und ich kenne überhaupt niemanden, wenn er ehrlich ist, der das, was ihn zutiefst berührt, in dem Rahmen des geografischen Nationalstaates erlebt, erfährt.
Funck: Was mich verblüfft hat bei der Lektüre von "Nach der Flucht" war: Dass Sie die oft beklagte Misere der Flüchtlinge und Migranten, nämlich ihren Status, dass sie nirgendwo richtig dazugehören und der Heimatlosigkeit, dass Sie den ja im zweiten Teil Ihres Buches eigentlich radikal zu etwas Positivem umwerten. Also Sie schreiben: "Heimatlosigkeit muss nicht falsch sein." Und: "Wer nirgendwo dazugehört, kann überall heimisch werden." Das ist ja eine radikale Umwertung. Oder habe ich das falsch gelesen?
Trojanow: Also "radikal" ist ja ein Wort, das immer abhängt von der Perspektive des Betrachters. Ich finde das eher realistisch. Es ist eine der Optionen. Ich behaupte ja nicht, dass das allen Menschen gegeben ist oder dass das allen Menschen gelingt. Aber es ist tatsächlich eine der wesentlichen Optionen. Und ich beschreibe ja auch, wie man sozusagen zu dieser Befreiung kommt. Wie man sich von diesen Zumutungen und diesem Gefühl des Verloren-Seins und des Unglücklich-Seins, wie man sich davon befreit. Indem man tatsächlich die Situation seines Lebens im Dazwischen und in der Vielfalt umarmt und daraus eine positive und kreative Energie macht.
"Entfremdungen und Befremdungen als etwas Positives werten"
Funck: Meinen Sie damit, dass in der Heimatlosigkeit oder Im-Heimat-Aufgeben auch Chancen liegen?
Trojanow: Ich sage nicht, dass es eine Heimatlosigkeit ist. Ich sage ganz klar, dass man ganz konkrete Heimaten hat. Also, es geht darum, dass man seine verschiedenen Entfremdungen und Befremdungen durchaus als etwas Positives wertet. Denn: Das ist auch Leben. Leben bedeutet, dass man sich immer wieder herausfordert. Wenn man völlig bequem, kommod in einem abgelegenen Sessel liegt, sein Leben lang und nichts Neues, nichts Fremdes, nichts Herausforderndes oder Provokantes auf sich zukommen lässt, lebt man glaube ich weniger. Und insofern ist diese existenzielle Realität, die ich beschreibe, natürlich eine, die einen immer wieder fordert. Aber dadurch auch immer wieder bereichert.