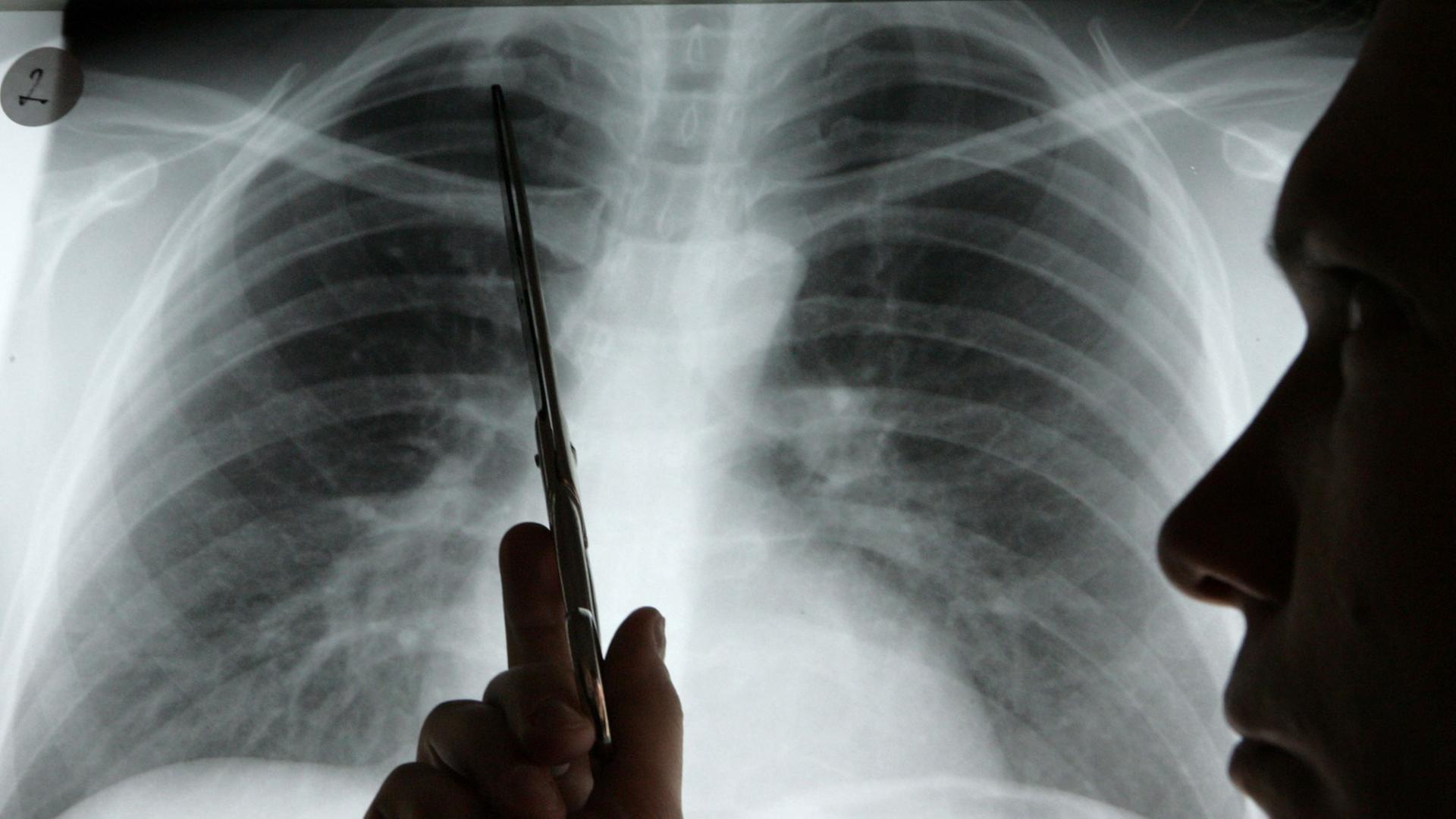Bis vor fünf Jahren waren Ärzte so gut wie machtlos, wenn ein Patient mit schwarzem Hautkrebs in die Klinik kam und schon Metastasen entwickelt hatte. Im Schnitt lag die Lebenserwartung dann bei acht Monaten, erinnert sich Dirk Schadendorf. Er leitet die Hautklinik der Universitätsklinik Essen. 2011 wurde dann die erste Immuntherapie für Melanome zugelassen. Es war das erste Medikament, das wirklich half:
„Die Aktivität des Immunsystems wird erhöht, was auf der einen Seite dazu führt, dass Tumorzellen besser vernichtet werden, auf der anderen Seite als Nebenwirkung mehr Autoimmunität auftritt.“
Die Nebenwirkungen dieser Therapie seien häufig stark, sagt er. 20 Prozent der Patienten entwickeln eine starke Darmentzündung, häufig ist auch die Leber betroffen. Das Medikament ist ein sogenannter Checkpoint-Inhibitor und greift tief ins Immunsystem ein.
„Eigentlich ist das Immunsystem ja nicht dafür gemacht, Tumoren zu erkennen und zu vernichten, sondern Bakterien, Viren und andere Eindringlinge quasi abzuwehren. Wenn diese Eindringlinge beseitigt sind, ist es so, dass das Immunsystem wieder normalisiert, runterreguliert wird.“
Genau hier greifen die Checkpoint-Inhibitoren ein: Sie verhindern das Herunterfahren des Immunsystems. Die Folge: Das Immunsystem ist dauerhaft aktiviert und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es auch die Tumorzellen bekämpft. Doch nur einer von fünf Patienten spricht auf die Behandlung an. Wenn die Therapie aber greift, leben die Patienten tatsächlich mehrere Jahre länger. Das Problem: Die Ärzte können nicht vorhersagen, wem die Therapie nutzen wird, und wem nicht.
„Wir haben keinen prognostischen Marker, wer von der Therapie profitiert oder wer zum Beispiel besonders starke Nebenwirkungen bekäme, auch das wäre eine klinisch wichtige Fragestellung. All das haben wir nicht, insofern müssen wir alle Patienten behandeln, in der Hoffnung, dass die Patienten, die davon profitieren, auch dabei sind.“
Die Ergebnisse sind ein Anfang
Für viele der sogenannten zielgerichteten Therapien dagegen gibt es inzwischen Marker, die zumindest helfen, die richtige Therapieentscheidung zu treffen. Es sind Medikamente, die ganz bestimmte Mutationen in den Tumoren ausnutzen. Deshalb ist auch klar, dass sie nur wirken können, wenn der Tumor diese Mutation auch hat. Das lässt sich relativ leicht mit einem Genprofil herausfinden. Ähnlich klare Zusammenhänge fehlen für Immuntherapien. Dirk Schadendorf sammelte deshalb Tumorproben und klinische Daten von mehr als 150 Patienten, und suchte mit Genanalysen nach Zusammenhängen. Das Ergebnis: Je mehr Mutationen ein Tumor hatte, je fremder er also dem Immunsystem erscheinen musste, umso eher griff die Therapie. Als Entscheidungshilfe für Ärzte taugt die Genomanalyse trotzdem noch nicht, sagt Bastian Schiller. Auch er war an der Studie beteiligt:
„Die Assoziation erlaubt nicht, zu sagen, ab einer bestimmten Anzahl von Mutationen spricht jemand an, oder unterhalb eines gewissen Schwellenwerts spricht man eben nicht an. Das geben die Daten nicht her.“
Im zweiten Teil ihrer Studie suchten die Essern Onkologen deshalb nach weiteren möglichen Biomarkern. Sie prüften, welche Proteine in den Tumorzellen von Patienten, denen die Therapie nutzt, besonders zahlreich vorhanden sind. Auch das lieferte erste Hinweise. Patienten mit reichlich Perforin und Granzyme A zum Beispiel sprachen eher auf die Therapie an. Das sind Proteine, die Immunzellen nutzen, um ihre Zielzellen zu zerstören. Dirk Schadendorf:
„Was es uns zeigt, ist dass mehrere dieser Dinge hier zusammen spielen, die wir quasi auf der Verdächtigenliste hatten. Also: das Immunsystem mit den T-Zellen und die genetische Ausstattung der Tumorzellen, diese hohe Mutationslast.“
Was die Forscher herausgefunden haben, ist ein Anfang. Es braucht noch viel Arbeit, bis sie daraus eine Entscheidungshilfe für Ärzte wird. Doch der Aufwand wird sich lohnen. Vor wenigen Wochen wurde ein zweiter Checkpoint-Inhibitor in Deutschland für die Melanombehandlung zugelassen. In absehbarer Zeit wird es auch für weitere Krebsarten zugelassen werden. Das heißt: Das Konzept, an dem Essener Ärzte arbeiten, wird vielen Patienten etwas nutzen.