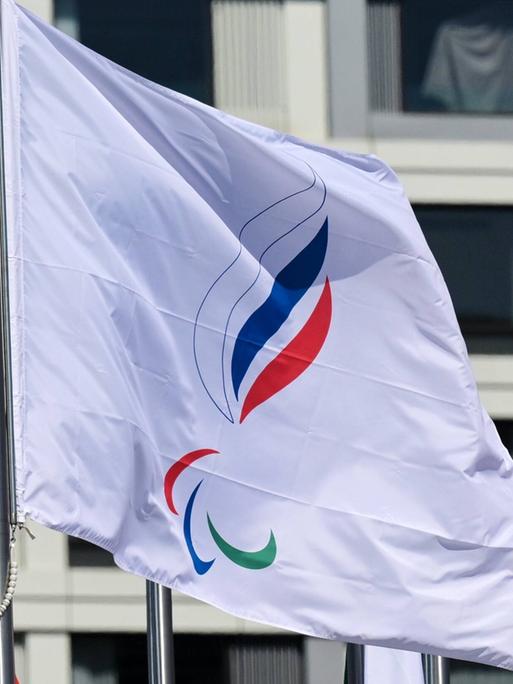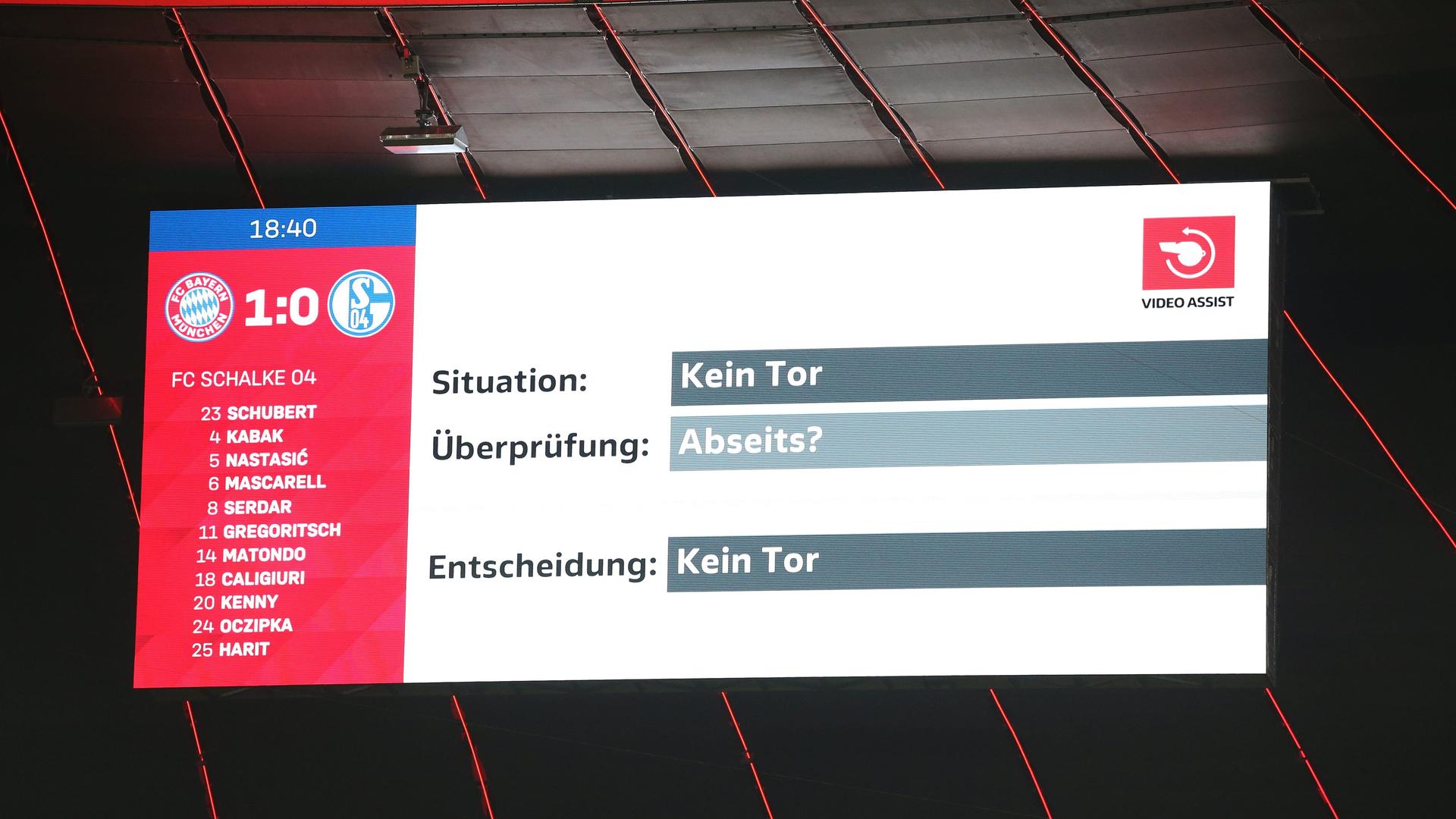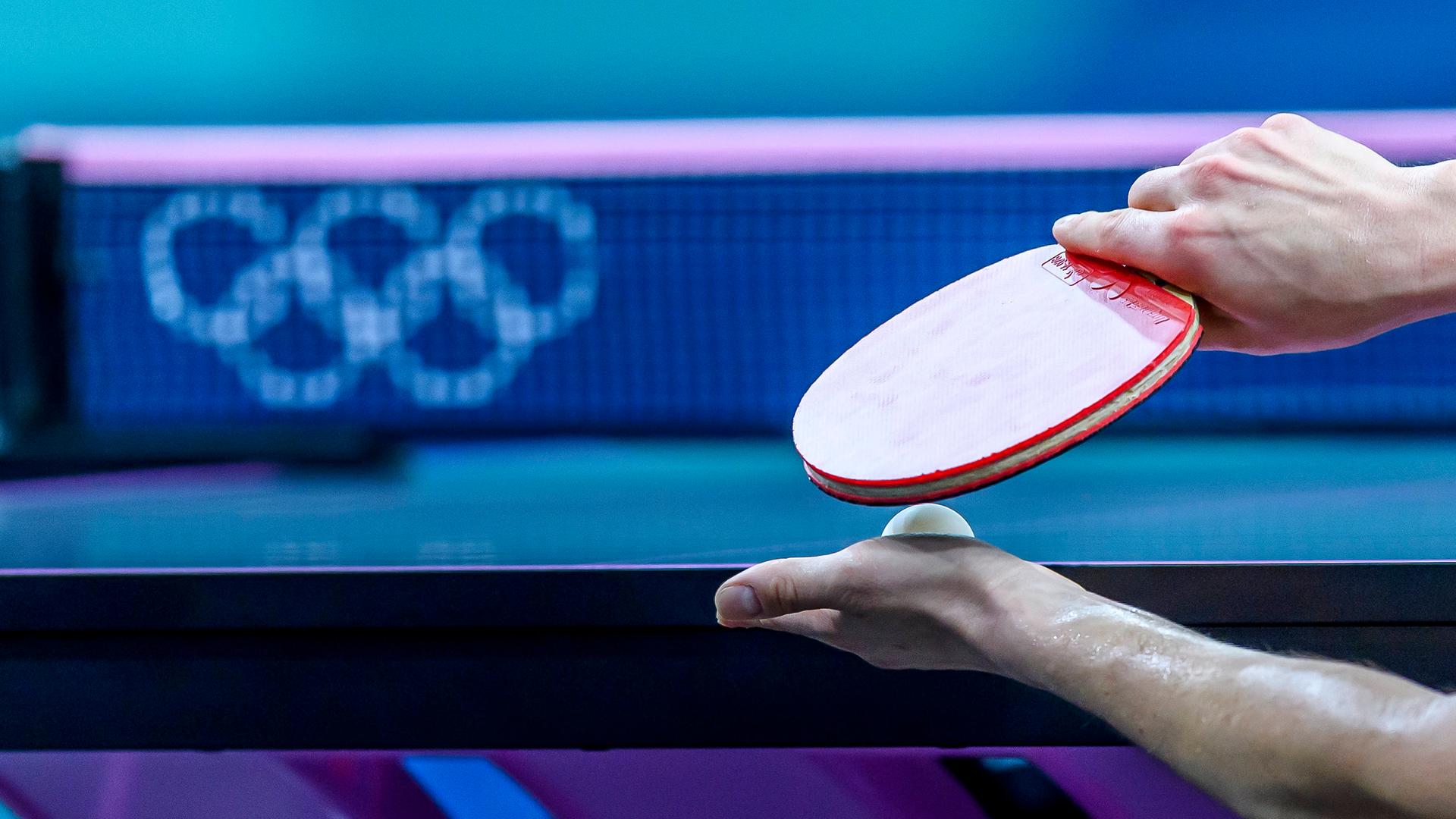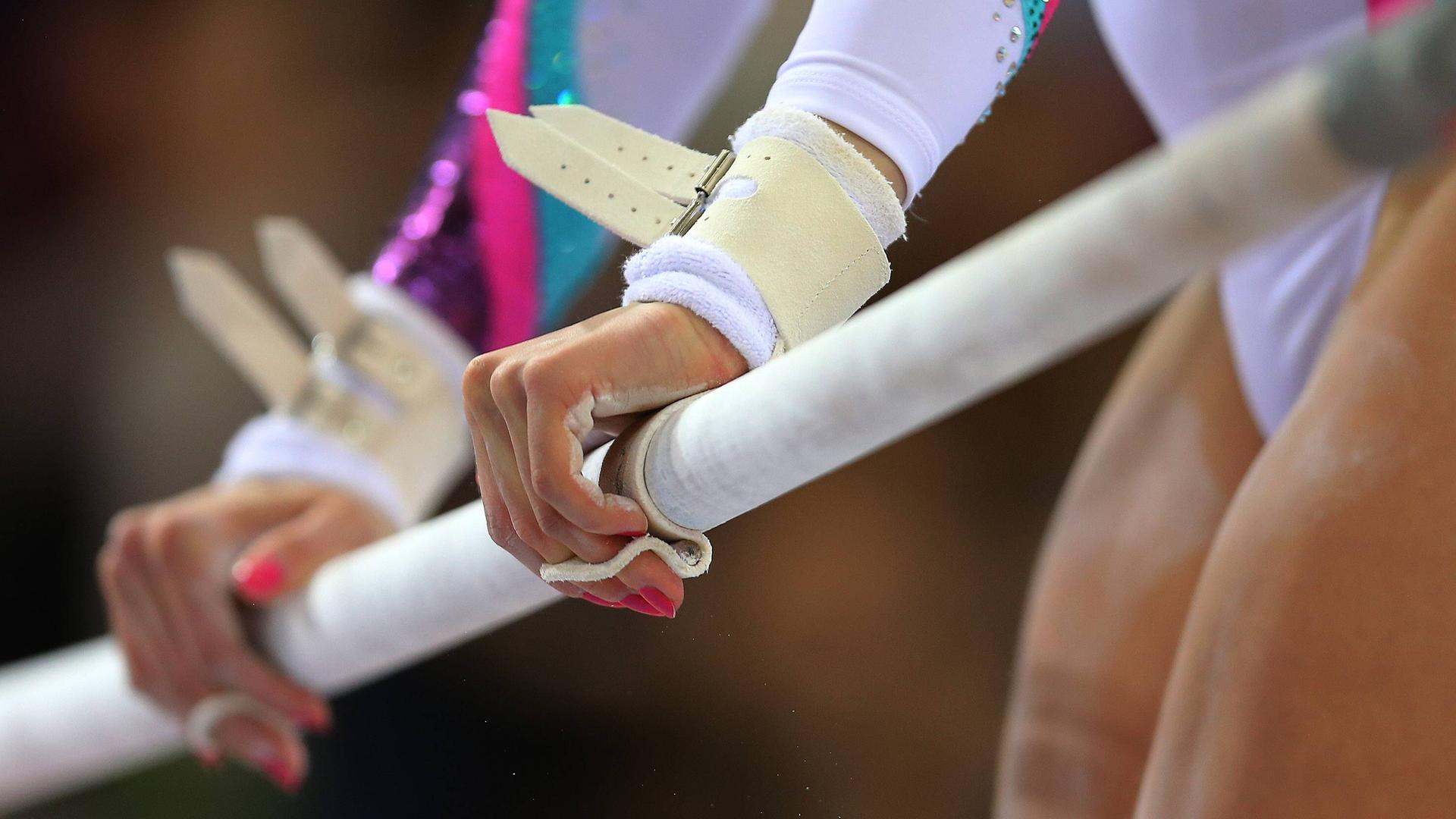Wer zur 50-Meter Schwimmhalle will, muss sich erstmal an einem kleineren Becken vorbeischlängeln, in dem ca. 20 Frauen Wassergymnastik machen. Vorbei an einem Regal, das bis obenhin mit Flossen, Brettern und Paddels vollgestopft ist. Und dann tritt man endlich ein, in die große Halle.
Im Sportbecken trainieren an diesem Morgen verschiedene Master-Teams. Master werden im Schwimmen alle Erwachsene genannt, die zu alt für den Leistungssport sind, aber trotzdem Ambitionen haben. Die einzelnen Schwimmbahnen sind mit blau-gelben Leinen abgetrennt. Auch hier hält man sich an die Nationalfarben der Ukraine.
1,2 Kilometer zum Warmwerden und anschließend 400 Meter Freistil auf Zeit hat der Trainer Ivan Perepelytsya heute für seine Schwimmer vorgesehen. "Mein Team sagt immer, Dein Training ist so hart, dass wir nur ans Schwimmen denken können und alle anderen Sorgen vergessen. Und anschließend fühlen wir uns besser. "
Schwimm-Team im Krieg auf ein Viertel geschrumpft
Früher bestand sein Team aus etwa 200 Schwimmerinnen und Schwimmern. Aber seit der russischen Großinvasion sind einige Teammitglieder zur Armee gegangen, andere ins Ausland oder in westliche Städte innerhalb der Ukraine, manche finden einfach keine Zeit mehr fürs Schwimmen, weil es jetzt wichtigere Dinge gibt, ein Mitglied gilt als vermisst.
Das Team ist auf 50 Leute geschrumpft – aber die, die kommen, sind motiviert, sagt Perepelytsya: "Viele wollen sich ihre mentale Gesundheit bewahren. Sie gehen zum Schwimmen, um zu trainieren, um sich zu erholen nach einer schlimmen Nacht, in der sie wieder die ganze Zeit im Luftschutzkeller waren und mal eine Pause für den Kopf brauchen. Also kommen sie."
Eine von ihnen ist Oksana Mamchenkova. Als Russland vor zwei Jahren seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen das gesamte Gebiet der Ukraine beginnt, flieht sie von Kiew ins westlich gelegene Lwiw.
An Schwimmen ist damals nicht zu denken. Aber schon einen Monat nach dem Angriff öffnen die Bäder in Lwiw wieder. Ihr erstes Mal im Wasser, nach dieser schwierigen Zeit, hat Oksana noch gut in Erinnerung:
"Ich habe diese große, moderne, lichtdurchflutete Schwimmhalle betreten, sie hat 50-Meter-Bahnen. Und ich konnte gar nicht glauben, dass wir mitten am Anfang eines wirklich großen Krieges stehen und ich hier bin, wieder schwimme, und versuche, mich daran zu erinnern, wie es geht, wie sich das Wasser anfühlt. Es war total surreal. Ich hatte diesen Moment ersehnt. Aber als ich das Training beendet hatte, war ich nicht glücklich, ich war verwirrt."
Schutzräume – aber nicht in allen Bädern
Inzwischen ist Oksana wieder in Kiew. Sie wollte wieder zurück in ihre Heimatstadt. Mit ihrem Coach Ivan trainiert sie für verschiedene Freiwasser-Wettbewerbe. Im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal den "Oceanman Kyiv", eine 10 Kilometer-Strecke im Fluss Dnipro, der durch die ukrainische Hauptstadt fließt. Da möchte Oksana in diesem Jahr wieder hin. Viermal pro Woche trainiert sie dafür. Zumindest, wenn es keinen Luftalarm gibt. Denn dann wird die Wasserfläche geschlossen. "Viele Schwimmhallen haben einen Schutzraum, man muss aus dem Wasser raus, aber nicht unbedingt das Gebäude verlassen. Man zieht sich also etwas an und geht in diesen Schutzraum."
Aber das gilt nicht für alle Schwimmbäder. Oksanas Teamkollegin Valia Naumenko erzählt von einem Morgen, als das Training nach nur fünf Minuten wegen Luftalarm abgebrochen werden muss. Ganz in der Nähe der Halle, die keinen Keller hat, hört sie Explosionen. "Das war sehr beängstigend und ich bin sehr schnell aus dem Wasser gegangen und aus dem Gebäude gerannt, weil diese Halle keinen Schutzraum und nur ein leichtes Dach hat. Wenn eine Rakete einschlägt, dann sterbe ich."
Training mit Veteranen – bis zum nächsten Luftalarm
Jedes Training ist also eine Risiko-Abwägung. Seit vier Monaten trainiert Coach Ivan Perepelytsya auch verwundete Veteranen, die Gliedmaßen verloren haben, meistens Beine, sagt er, durch Minen-Explosionen. "Die Veteranen sagen, dass sie das Schwimmtraining mögen, weil sie dann nicht den Phantomschmerz spüren. Sie vergessen ihn, wenn sie schwimmen."
Nach dem ersten oder zweiten Training fällt es den Veteranen noch schwer, sagt Ivan, aber dann wollen sie plötzlich weitermachen und immer mehr trainieren. Dann bessert sich auch der Phantomschmerz insgesamt: "Ich denke das ist super."
Das Training an die Bedürfnisse der Veteranen anzupassen, fällt dem Coach nicht schwer. Er tüftelt sowieso immer an neuen Übungen. Learning by doing. An diesem Morgen kann er das Training durchziehen. Am Nachmittag wird der nächste Luftalarm das Leben in Kiew wieder unterbrechen.