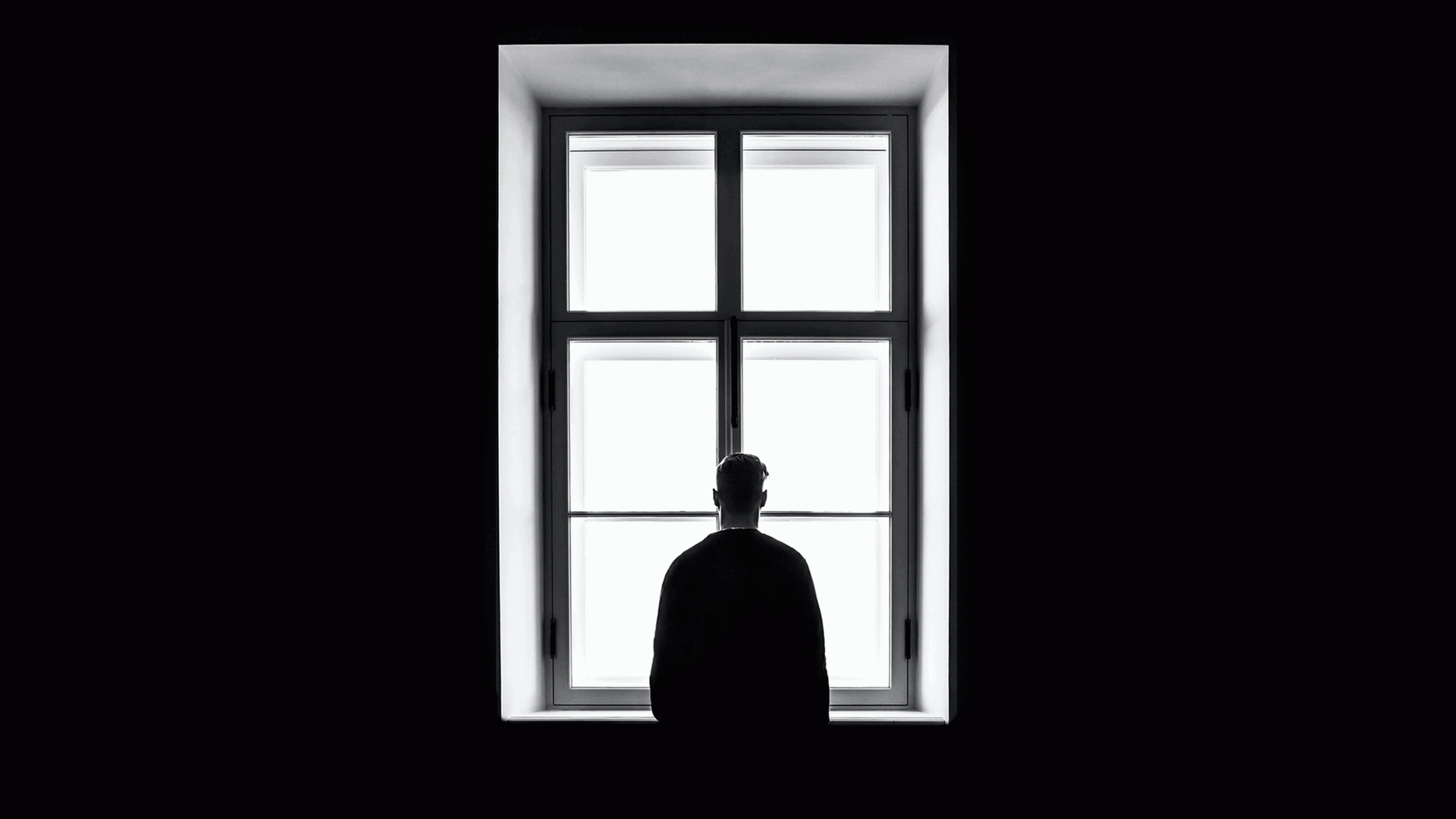Man solle das Thema Depression nicht zu ernst nehmen, weil man sonst nicht weiterkomme, so Nora Tschirner im Dlf. Auch eine Berührungsangst müsse vermieden werden, deshalb sei Humor "ganz hervorragend".
Betroffene sind nicht allein
Zwei Ebenen würden angesprochen in der Serie: Für Angehörige sichtbarer zu machen, was im Falle einer Depression vor sich geht und sich selbst verstanden fühlen. "Mit einem Depressiven zusammen zu leben, ist einfach wahnsinnig anstrengend. Das abgebildet zu sehen, ist einfach toll." Betroffene würden merken, dass die Krankheit ihren Schrecken verlieren könne, dass man nächste Schritte planen und mal durchatmen könne. Und Betroffene merkten, dass sie nicht allein seien. "Denn sonst würde es keine Serie darüber geben."
Die Schauspielerin versteht die Serie als Einladung, ohne Berührungsängste über diese Krankheit zu reden. Es gebe Nischen, in denen das Thema behandelt werde, aber als Gesellschaft stehe uns das noch bevor. Depression und psychische Gesundheit stünden seit Corona mehr im Fokus, da es für viele Menschen nachvollziehbarer werde. "Jetzt plötzlich gibt es eine Gesprächskultur darüber. Und das ist eine große Chance."
Positives Feedback als unbeschreibliches Gefühl
Nora Tschirner hat in einigen Interviews über ihre eigene Depression gesprochen. Dadurch sei sie angreifbarer geworden. Es hätte Zeiten gegeben, wo sie nicht darüber hätte reden können. Aber es gebe immer mäkelnde "Schlaumischlümpfe". "Da muss ich dann irgendwann sagen, ja, dann macht ihr halt nichts in der Zeit. Wir würden jetzt gerne einfach weiter mitgestalten." Natürlich mache man sich angreifbar, aber das Feedback von Menschen, denen sie geholfen habe, ihr Leben proaktiv zu verändern, sei ein unbeschreibliches Gefühl.
Sie habe Abstand gebraucht, um diese personifizierte Depression zu spielen, weil es sie sonst zu sehr gefährdet hätte. Durch den Abstand könne sie auch eine "gesellschaftspolitische Forschung" hereinfließen lassen. "Sonst bleibt es immer aus einer Subjektivität heraus und man übersieht auch leichter Sachen."
Düstere Stimmungen nicht erkennen
Sie bezweifelt, dass man sich als Nichtbetroffener Tage vorstellen könne, an denen man "supersauer" wäre und der Betroffene sich wundere, dass Mitmenschen diese Stimmung nicht an den Augen ablesen könnten. "Wenn man sich viel damit beschäftigt hat, dann kann man in der Physiognomie Spuren in den Micro-Expressions von Depressionen erkennen." Aber darauf seien wir nicht geschult.