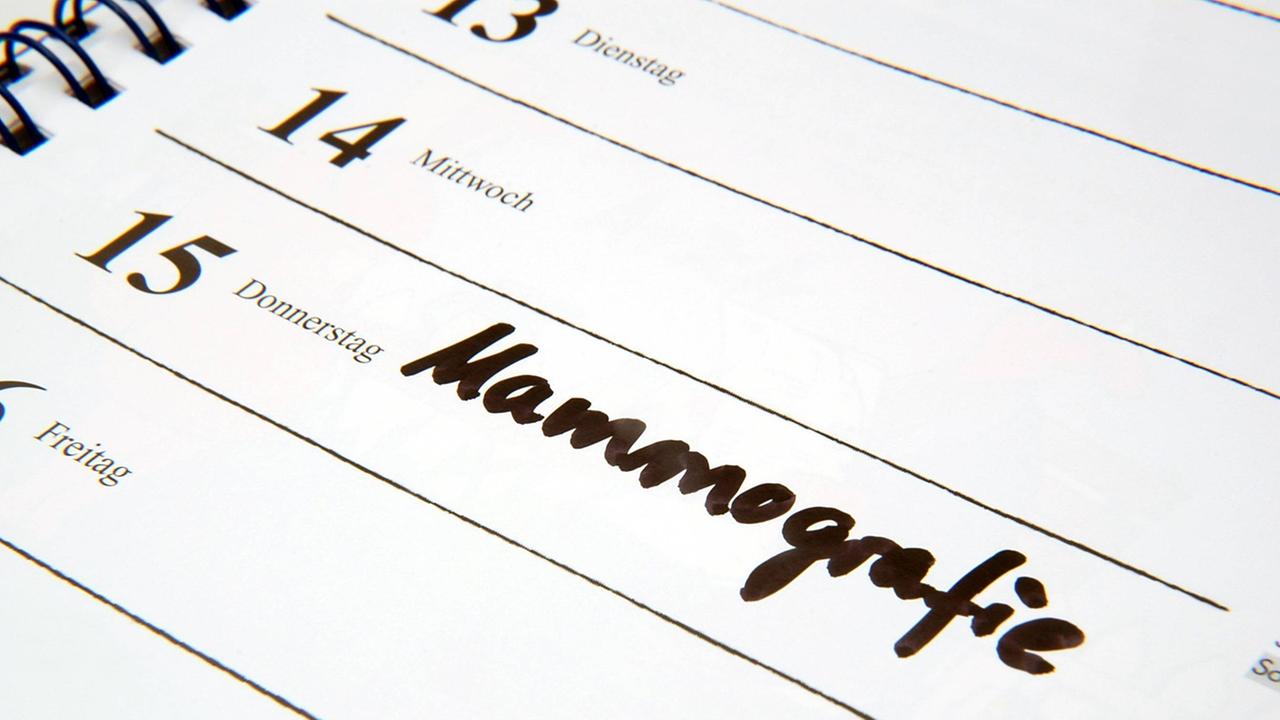Bitte die Arme leicht abwinkeln und die Luft anhalten. Der Arzt hat den Patienten vor dem Röntgengerät positioniert, nun folgt die Aufnahme. Einen kurzen Augenblick lang dringt Röntgenlicht durch den Brustkorb, ein Detektor - eine Art Röntgenkamera - nimmt es auf.
"Es durchdringt den Körper allerdings nicht vollständig, sondern bleibt teilweise im Körper hängen", sagt Sven Prevrhal, Forscher bei Philips Research in Hamburg, dem deutschen Forschungsstandort des Konzerns. "Genau das nutzen wir in der Röntgenbildgebung, dass wir uns ansehen, wie viel von der Röntgenstrahlung durch den Körper durchkommt und wie viel an den Knochen, an den Weichgewebe-Anteilen hängenbleibt."
Das Skelett ist deutlich zu erkennen, auch manche Organe zeichnen sich im Röntgenbild ab. Aber:
"Im Licht ist ja mehr Informationen enthalten als nur, ob es hängenbleibt oder nicht."
Dieses Mehr an Information steckt zum Beispiel in der sogenannten Phase des Röntgenlichts. Licht ist eine elektromagnetische Welle, und eine Welle besitzt Wellenberge und Wellentäler. Die Phase kennzeichnet dabei vereinfacht gesagt, ob eine Welle mit einem Wellenberg oder einem Wellental irgendwo auftrifft, etwa auf einer digitalen Kamera. Aus dieser Phase lassen sich medizinisch relevante Informationen herauskitzeln.
"Wir wissen, dass verschiedene Materialien im Körper, zum Beispiel Lungenbläschen, einen Einfluss auf diese Phase haben. Wenn wir das detektieren können, können wir zum Beispiel sehen, ob sich gesunde oder kranke Lungenbläschen im Strahlengang befunden haben. Und das wiederum, hoffen wir, kann der Kliniker zu einer besseren Diagnose nutzen."
Kranke Lungenbläschen beugen das Röntgenlicht stärker als gesunde und verändern dadurch seine Phase. Phasenkontrast-Bildgebung, so heißt die Methode. Vor einigen Jahren hatten Arbeitsgruppen etwa aus München und der Schweiz die Grundlagen geschaffen. Nun versuchen mehrere Firmen, die Methode in die Praxis umzusetzen, darunter Philips. Dafür müssen die Fachleute keine komplett neue Apparatur entwickeln. Es reicht, ein konventionelles Röntgengerät zu erweitern.
"Dazu brauchen wir ein sogenanntes Gitter."
Das ist eine dünne Siliziumfolie, in die mikrometerfeine Linien geätzt sind. Sie hat folgende Aufgabe: Die Wellen, die aus einer Röntgenröhre kommen, sind zunächst mal völlig ungeordnet: Manche würden mit dem Wellenberg am Detektor auftreffen, andere mit dem Wellental. Doch für das neue Verfahren müssen alle Röntgenwellen quasi gleichgeschaltet sein, also alle zum Beispiel mit dem Wellenberg auftreffen. Genau dafür sorgt das hauchdünne Gitter aus Silizium. Wie es aussieht, zeigt Sven Prevrhal in seinem Labor. Dort steht ein Röntgengerät für die Mammografie. Die Fachleute haben es für die Phasenkontrast-Methode umgerüstet.
"Wenn Sie hier runterschauen, sehen Sie den Strahlaustritt. Da sehen Sie auch schon das erste Gitter. Das ist das Gitter, das die Wellenberge der Röntgenstrahlung sozusagen auf Tritt bringt."
Schillernde Gitter sorgen für phasengleiches Licht
Das Gitter ist etwas größer als eine Briefmarke und schillert in mehreren Farben - ein Nebeneffekt des mikrometerfeinen Linienmusters. Es bringt das Röntgenlicht in Phase, und mit diesem gleichgeschalteten Licht wird dann das Gewebe durchleuchtet. Vor dem Röntgendetektor, der die Strahlung anschließend aufnimmt, sind weitere Gitter platziert. Nur so lässt sich eine Phasenveränderung, hervorgerufen etwa durch krankhafte Lungenbläschen, erkennen. Und wie läuft die Bildaufnahme ab?
"Für den Patienten besteht da kein Unterschied. Der Arzt sieht sich aber mit zwei Röntgenbildern beschenkt und kann diese zur Diagnose nutzen."
Der Apparat nimmt also zwei Bilder auf einen Schlag auf - normale Röntgenaufnahme und Phasenkontrast-Bild. Auf diesem können sich verdächtige Strukturen etwa in der Lunge oder in der Brust als schwarz-weiße Kringel verraten. Die Hoffnung: Tumoren sollten sich bereits im Frühstadium erkennen lassen, die Heilungschancen würden sich erhöhen.
"Wir haben auf Brustgewebsproben bereits hervorragende Ergebnisse erzielt. Und wir hoffen jetzt, das in einer klinischen Studie zu überprüfen. Wir planen mit Beginn 2018 in die klinischen Studien einzusteigen."
Und zwar gemeinsam mit dem Universitätsspital Zürich. Doch die Methode hat auch einen Nachteil: Sie ist zumindest im Prinzip mit einer höheren Strahlendosis verbunden. Dieses Manko wollen die Forscher nun ausgleichen, indem sie die Bildaufnahme mit einem speziellen Scan-Verfahren kombinieren. Und wann könnte die Methode Einzug halten in den Klinikalltag?
"Bis sie auf den Markt kommt, werden mit Sicherheit noch ein paar Jahre vergehen."