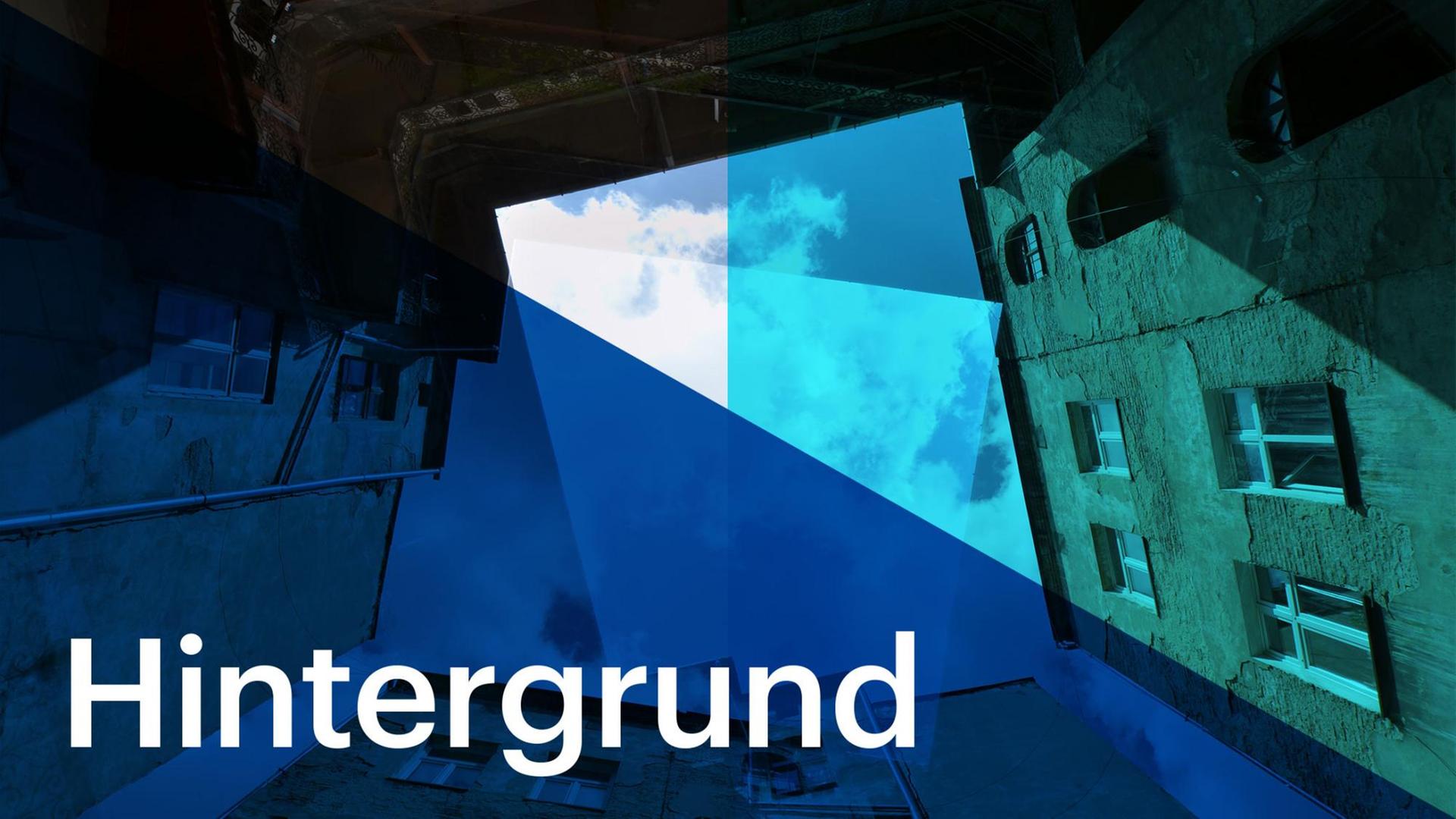"Wascht eure Hände, wascht eure Hände."
Die Stimmung ist gereizt hier am Einstieg zu Moa Wharf, einem Slum in Freetown. Helfer stehen an einem Plastikeimer mit Wasserhahn. Alle, die unten aus dem Slum kommen, werden von den Helfern unmissverständlich aufgefordert, ihre Hände zu waschen – mit Chlorwasser. Sollten sie das Ebola Virus doch an ihren Händen tragen...
Eine steile, schmale Treppe führt in das Moa Wharf. Es geht nach unten, auch gesellschaftlich. Hier, direkt am Meer, leben die ärmsten der Armen Freetowns – der Hauptstadt Sierra Leones.
Kot und verbranntes Plastik
Ein Bach zur Rechten. Das Flussbett ist voller Abfall, das Wasser milchig weiß. Eine einzige Kloake. Schweine suchen darin nach Fressbarem. Rauchschwaden ziehen über die Wellblechdächer des Slums. Überall liegt Müll herum. Es stinkt nach Kot und verbranntem Plastik. Obendrein ist es schwül-heiß.
Unten angekommen - ein paar Leute streiten sich. Soldaten sind in die Auseinandersetzung. Ein Sozialarbeiter, der für die Hilfsorganisation Cap Anamur in dieser Gegend tätig ist, erklärt worum es geht.
"Das ist die am stärksten Ebola-verseuchte Gegend hier. Und gestern sind hier zwei neue Ebolafälle entdeckt worden. Da in der Hütte ist jemand drin, der Ebola-Symptome zeigt. Ein Überlebender kümmert sich jetzt um den Verdachtsfall und soll ihn ins Behandlungszentrum bringen."
Mehrere Dutzend Menschen schauen zu, wie ein Soldat einen Mann zurechtweist. Der Mann will sein Haus verlassen. Doch die Bewohner stehen wegen des Ebola-Verdachtsfalls unter Quarantäne. Fast unsichtbar vor dem Haus – eigentlich ein Verschlag aus Wellblech und Planen - ein Absperrband. Darauf steht Police – Polizei. Niemand darf das Band übertreten. Außer Helfern in Schutzanzügen oder Ebola-Überlebenden, die immun sind gegen die Krankheit.
Der Chief von Moa Wharf ist gekommen. Ein älterer Mann mit weißer Schlägermütze und blauem Hawaiihemd. Chief Copain ist sauer.
"Ebola war hier zuletzt vor vier Monaten. Danach war Ruhe. Und jetzt – seit ein paar Tagen - ist Ebola wieder da."
Der Chief erzählt mit aufgebrachter Stimme, wie das Virus in den Slum zurückgekehrt ist. Eine ebolakranke Frau aus einem anderen Slum hätte es hier eingeschleppt. Deren Slum sei nicht richtig abgesichert worden vom Militär und so konnte die Frau die Quarantäne umgehen. Aber im Moa Wharf laufe es besser.
Sicherheitskräfte riegeln Quarantänegebiet ab
"Hier sind die Sicherheitskräfte richtig aufgestellt. Die machen ihre Arbeit wirklich gut. Wir haben so viele hier, schauen sie, da sitzen sie. Wir haben hier um die 50 Sicherheitskräfte in unserer Gemeinde."
Eine enge Gasse führt zu dem Haus, das unter Quarantäne steht. Die Gasse ist gesäumt von Schweinen, die es sich im Schatten bequem machen. Die Menschen hinter den Schweinen und dem kümmerlichen Absperrband dürfen in den nächsten 21 Tagen nicht ihr Haus verlassen. Das Militär achte darauf, so der Chief. Die Bewohner schauen frustriert herüber. Hitze, Dreck und nun auch noch eingesperrt.
Weiter durch den Slum. Enge Gassen, einfache Behausungen. Manche sind aus Beton gemauert. Die Menschen leben auf engstem Raum. Berührungen sind deshalb fast unvermeidlich. Ideale Übertragungsmöglichkeiten für das Ebola Virus.
Regenzeit ist Seuchenzeit
Die meisten der Bewohner sind einfache Fischer. Ihre langen Holzboote liegen wenige Schritte entfernt im Wasser. Eine schwarze Soße voller Plastikflaschen, Tüten, Stofffetzen, Autoreifen. All das, was die Stadt da oben nicht mehr braucht, hat der Regen herunter gespült. Ein Brutbecken für Krankheiten. Jetzt beginnt die Regenzeit. Cholera, Dengue, Malaria gesellen sich dann zu Ebola.
Wieder ein Absperrband. Eine weitere Familie in Quarantäne. Auch hier soll die Frau, die kurz darauf an Ebola starb, vorbeigeschaut haben. Ob sie die Bewohner wissentlich anstecken wollte – keiner weiß es. Ein alter Mann in weißem Trägershirt und seine Familie schauen verbittert über das Band. Aus sicherem Abstand beantwortet er Fragen.
"Wir fühlen uns hier nicht gut. Ich bin Händler, ich verliere Geld. Und die Kinder dürfen nicht in die Schule. Es ist furchtbar."
Noch über zwei Wochen müssen sie warten und hoffen, dass niemand Ebola-Symptome zeigt. Versorgt werden sie von Hilfsorganisationen – und bewacht. Ein Soldat schaukelt auf einem Stuhl neben dem Absperrband. Wie kann eine Frau mit Ebola im Endstadium überhaupt frei herumlaufen? Der Chief glaubt, zu wissen warum.
Angst vor dem Krankenhaus
"Die meisten haben immer noch Angst vorm Krankenhaus. Als Ebola vor einem Jahr hier anfing, ist kaum einer aus dem Krankenhaus zurückgekehrt. Die Leute haben Angst dahinzugehen, weil es für sie den Tod bedeutet. Aber jetzt sehen wir doch – und das freut mich als Chief besonders – dass einige, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wieder hier sind. Sie haben überlebt, drei, vier fünf Leute. Und ich sage immer wieder Leute, geht ins Krankenhaus!"
Einer dieser Überlebenden betreut nun die andere Familie. Durch ihre Ebola-Immunität haben manche eine neue Tätigkeit gefunden und arbeiten nun als Pfleger.
Wieder zurück nach oben – durch den Müll! Immer wieder die Warnschilder: Ebola ist tödlich! Vermeidet Berührungen! Wascht eure Hände! Die Menschen sind gewarnt und die meisten halten sich an die Hinweise. Und doch kommt es noch immer zu unerklärlichen Fehlern – ein Jahr nach dem Ebola-Ausbruch.
Oben am Ende der steilen Treppe stehen wieder die Helfer mit ihrem Eimer.
"Wascht eure Hände, wascht eure Hände."
Der Aufforderung die Hände zu waschen kommen alle nach.