
Einst war das Kaufhaus der produktive Ort der marktgerechten Wertermittlung: Man konnte sich als Konsument auf eine relative Stabilität der Preise verlassen, was das Handeln auf dem Markt ersetzte und das Einkaufen bürgerlich kultivierte. Heute ist davon gerade einmal die Preisbindung für Bücher geblieben. Ausnahmen von der Regel gab es indes schon immer, die wichtigste war der Schlussverkauf, wo zwei Mal im Jahr auslaufende oder saisonbedingte Ware zu einem günstigeren Preis gekauft wurde.
Doch die Zeiten solcher Regelungen der Preisgestaltung sind längst vorbei, ein "empfohlener Verkaufspreis" ist nur noch ein fiktiver Wert. Shoppingmalls und Fußgängerzonen sind voll von Angeboten: Sales und Black Fridays, beim Internethandel spielt diese ständige Bewegung der Preise eine noch größere Rolle.
Sonderangebote halten oft ihr Versprechen nicht
Näherer Prüfung halten die tollen Preise allerdings selten stand. Manchmal handelt es sich bei den Angeboten um minderwertige Ware, manchmal erweisen sich die Preisnachlässe als reine Fiktion, manchmal dienen besondere Preise als Lockmittel, um andere, eher teurere Produkte zu verkaufen. Der große Traum des Einzelhandels ist der Verwirklichung bereits nahe: über den potenziellen Kunden so viele Informationen zu sammeln, dass man einen auf ihn individuell abgestimmten Preis anbieten kann.
Alles nur ein Spiel? Mit perfiden Seiten, bilanzieren die Autoren. Denn das besonders Perfide an diesem Spiel besteht darin, dass die Verantwortung zum großen Teil auf die Verbraucher abgeschoben wird.
Markus Metz, geboren 1958, studierte Publizistik, Politik und Theaterwissenschaft, er lebt als Hörfunkjournalist und Autor in München. Zuletzt erschien von ihm "Schnittstelle Körper" (Matthes & Seitz Verlag) und "Freiheitstraum und Kontrollmaschine. Der (vielleicht) kommende Aufstand des nicht zu Ende befreiten Sklaven" (bahoe books Wien), beide gemeinsam mit Georg Seeßlen.
Georg Seeßlen, geboren 1948, hat in München Malerei, Kunstgeschichte und Semiologie studiert. Er war Dozent an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland und schreibt heute als freier Autor unter anderem für "Die Zeit", "Frankfurter Rundschau", "taz" und "epd-Film". Außerdem hat er rund 20 Filmbücher verfasst und Dokumentarfilme fürs Fernsehen gedreht.
Jedes Ding hat seinen Preis. Das ist die Grundlage unseres Wirtschaftssystems, vielleicht sogar unserer Form des Zusammenlebens. Dinge werden hergestellt, Dienstleistungen erbracht, Ideen entwickelt, damit man sie verkaufen kann, um mit dem Erlös andere Dinge zu kaufen, andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, andere Ideen aufnehmen zu können. Ein Kreislauf, der mal gut und mal nicht so gut funktioniert. Wenn es gut geht, dann drückt der Preis in etwa den Wert einer Ware oder einer Dienstleistung aus; wenn es nicht gut geht, ist der Preis entweder zu hoch oder zu niedrig für den Wert einer Ware oder einer Dienstleistung. Dann zahlt – wie man so sagt – jemand drauf.
Damit der Preis seine Aufgabe erfüllen kann, den Wert einer Sache zugleich festzulegen und in Bewegung zu setzen, gibt es den Markt. Auf dem können die Anbieter sagen, was sie für eine Ware oder eine Dienstleistung verlangen, die Interessenten können sagen, was sie für eine Ware oder eine Dienstleistung zu zahlen bereit sind. Der Preis wird also ausgehandelt. Nach Angebot und Nachfrage. Das Ganze ergibt die sogenannte unsichtbare Hand, und die schreibt schließlich Preisschilder. Der Preis ist nämlich nicht nur davon abhängig, was eine Sache wert ist, sondern auch davon, welche Menge an Waren und an Geld überhaupt im Umlauf ist. Daher ist es sehr sinnvoll, dass der Markt eine öffentliche Angelegenheit ist. Preise sind das Ergebnis von Informationen, und sie sind selbst Informationen. Man geht auf den Markt, um etwas von Wert zu kaufen, aber eben auch, um sich zu informieren.
Das klingt doch ganz vernünftig, oder? Allerdings: Was eigentlich den Wert einer Sache ausmacht, darüber haben sich die Theoretiker nie vollständig Klarheit verschaffen können. Ist Wert das, was man in das Produkt hinein gesteckt hat, an Wissen, Material, Arbeit und Zeit? Oder ist Wert das, was für einen möglichen Käufer darin steckt, sein Interesse, seine Wünsche, seine Erwartung? Wenn man nicht genau sagen kann, worin der Wert einer Sache besteht, ist natürlich auch ihr Preis keine so eindeutig vernünftige Information wie zuerst gedacht. Der Preis ist unter anderem ein Versuch, die verschiedenen Vorstellungen vom Wert einer Sache auf einen Nenner zu bringen. Allerdings: Auf dem Markt versucht jeder, nicht nur den Wert seiner Ware anzupreisen, sondern auch den möglichen Käufer zu umschmeicheln und zu bedrängen.
"Kommen Sie näher, schöne Frau, ich habe die rotesten Tomaten von allen! Da schmecken Sie die Kraft der Sonne heraus. Für Sie mache ich auch einen Sonderpreis. Aber nur jetzt und nur, weil Sie es sind!"
Vom Wert einer Sache
Es gibt zwei ganz verschiedene Arten, den Wert einer Sache zu bestimmen. Einmal setzt er sich zusammen aus dem Wert der verwendeten Rohstoffe, dem Wert der eingesetzten Werkzeuge und nicht zuletzt aus dem Wert der Arbeit, die dafür nötig ist. So ist klar, dass eine goldene Uhr mehr wert ist als eine aus Plastik, eine Uhr, die ein Uhrmacher als Einzelstück hergestellt hat, mehr als eine, die nach Anleitung immer wieder gleich gebaut wird. Damit haben wir eine weitere Art, den Wert einer Sache zu bestimmen, nämlich das Rare und das Vielzählige. Eine Uhr, die es nur einmal auf der Welt gibt, ist natürlich viel mehr wert als eine Uhr aus industrieller Massenfertigung. Klar ist also auch: Was den unterschiedlichen Wert eines Goldklumpens und der daraus gefertigten Uhr ausmacht, ist die menschliche Arbeit. Sie erzeugt den Mehrwert. Was aber wird aus dem Wert einer Ware, wenn immer weniger menschliche Arbeit darin steckt?
Es leuchtet ein, dass Rohstoffe, Maschinen und menschliche Arbeitskraft den Wert eines Produktes wesentlich bestimmen. Aber das kann nicht alles sein. Zum Beispiel kann eine Uhr ja schöner sein als die andere. Bei einem Kunstwerk kann man nicht fragen, wie viel Zeit ein Künstler gebraucht hat, um dessen Wert zu bemessen. Auf der anderen Seite macht es die industrielle Massenfertigung möglich, ein Produkt mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft zu erzeugen. Eine Supermarkt-Uhr für zehn Euro gibt die Uhrzeit ebenso genau an wie eine teure Designer-Uhr.
Schon Aristoteles hat klar unterschieden zwischen einem Gebrauchswert und einem Tauschwert: "Man kann einen Schuh gebrauchen, um ihn zu tragen, aber auch, um ihn zu tauschen, beides sind Gebrauchsmöglichkeiten ein und desselben Schuhs."
Mit der Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert fangen die Verhältnisse schon zu tanzen an. Jedes Produkt sagt nun nämlich zweierlei von sich selbst: Schau her, was ich kann. Das ist das Gebrauchswertversprechen. Und: Schau her, was du für mich bekommen kannst. Das ist das Tauschwertversprechen. Wie es der Name schon sagt: Manche Versprechen werden eingehalten und manche nicht. Es gibt Dinge, die einen hohen Gebrauchswert und so gut wie keinen Tauschwert haben – zum Beispiel Lebensmittel – und umgekehrt.
Nicht umsonst spricht man von Sachen mit Seltenheitswert. Um den zu bestimmen, braucht man wiederum Informationen. Einem Seltenheitsversprechen ist nicht immer zu trauen, wie jeder Tourist weiß, dem auf ein paar hundert Metern Straße die immer gleichen Dinge als garantiert einmalige Antiquität angeboten werden. Umgekehrt könnte man vielleicht mitten in der Wüste ein kleines Vermögen für eine Flasche kühles Wasser verlangen.
Auf dem Markt kann man auch betrogen werden
Machen wir uns nichts vor: Der Markt – jeder Markt! – ist ein Ort, an dem Informationen ausgetauscht und Preise ausgehandelt werden. Und er ist ein Ort, an dem gelogen, getrickst und erpresst wird, dass sich die Balken biegen. Der Markt ist ein Ort, an dem ich damit rechnen muss, betrogen zu werden. Wenn das freilich zu viel, zu aggressiv und zu offensichtlich passiert, werden viele versuchen, ihn zu meiden. Zynisch gesagt: Auf dem Markt wird nicht nur über Preise verhandelt, sondern auch darüber, wieviel Betrug und – netter gesagt – Marktschreierei man sich zubilligt. Das wiederum ist abhängig davon, wie viele öffentliche Zeugen zugegen sind und wie sie sich verhalten. So ist es ein erstes Anliegen des Betrügers, die Öffentlichkeit auszuschalten.
"Pssst. Hallo Sie! Schauen Sie einmal unauffällig her. Das darf kein anderer sehen. Ich habe hier eine echte Rembremderdeng-Uhr. Kann ich Ihnen günstig überlassen. Aber nur, wenn Sie es niemandem erzählen."
Ganz gleich wie ich den Wert eines Dings bestimme und ihn in ein Verhältnis zum Preis setze – damit die Zirkulation reibungslos und zum Wohle aller funktioniert, muss es ein Mindestmaß an Vertrauen geben. Drei Voraussetzungen sind dazu notwendig. Zum einen Marktteilnehmer, die sich an bestimmte Regeln halten. Zweitens irgendeine Art von Marktaufsicht, die eine klare Grenze setzt zwischen dem freien Aushandeln von Preisen nach Angebot und Nachfrage und dem Betrug und die in der Lage ist, die Marktteilnehmer vor Betrügern zu schützen. Und drittens eine Öffentlichkeit des Marktgeschehens, die es ermöglicht, Preise zu vergleichen, sich gegen unfaire Absprachen zur Wehr zu setzen oder einen Handel mit verdorbenen oder wertlosen Waren anzuprangern.
Es sieht allerdings ganz danach aus, dass die Art von Marktwirtschaft, die man Marktradikalität oder Neoliberalismus nennt, drauf und dran ist, alle drei Sicherheitsmaßnahmen für einen freien Markt abzuschaffen.
"Wer sich an Regeln hält, hat schon verloren; wir sind doch freie Verbraucher! Politische oder gesellschaftliche Aufsicht hat im Markt nichts verloren, das ist ja schon Kommunismus! Was braucht der Markt noch eine Öffentlichkeit, wenn sich in der Zeit der digitalen Kontroll- und Kommunikationsmedien Anbieter und Kunde direkt verbinden können. Das machen wir unter uns aus. Ganz individuell!"
Zur Praxis einer sozialen Marktwirtschaft gehörten mehr oder weniger stabile und allgemein verbindliche Preise. Das meint nicht, dass das gleiche Ding zu jeder Zeit an jedem Ort genau gleich viel kosten muss. Es ist klar, dass ein Pfund Erdbeeren im Winter mehr kostet als im Sommer. Das heißt aber, dass Preise nicht willkürlich und nicht allein nach Marktmacht – zum Beispiel, weil jemand den Erdbeerhandel zum eigenen Vorteil monopolisiert hat – bestimmt werden sollen. Stabile Preise erhöhen auf jeden Fall das Vertrauen der Konsumenten und können daher zu bestimmten Zeiten sehr wichtig für die Entwicklung des Marktes sein. Die Kaufhäuser, die Versandhäuser, die Supermarkt-Ketten, die Markenrestaurants – ihre Erfolgsgeschichten beruhten darauf, dass sie festgesetzte Preise anboten. Aber die Preise gerieten in Bewegung, und zwar nicht allein in die eine Richtung.
"Alles wird immer teurer!"
Ein gnadenloser Wettbewerb ist entstanden
Vorschnell wurde in den 90er-Jahren das Ende der Markenwaren ausgerufen. Billigwaren, No Name-Produkte und generische Angebote setzten eingeführte Marken und feste Preise unter Druck. 1993 gab es den berüchtigten Marlboro Friday, an dem der Tabakkonzern den Preis für seine populärste Zigarettenmarke um 20 Prozent senkte, als Reaktion auf den Preisdruck der Billigmarken. Aber nicht das Ende der Marken, sondern das Ende der relativen Preisstabilität war damit gekommen. Im gnadenlosen Wettbewerb untereinander verfielen etwa Supermärkte und Discounter auf Tricks zur Dynamisierung der Preise an ihren Standorten. Supersonderangebote locken die Kunden an; auf der Jagd nach den Schnäppchen verweilen sie lange genug im Laden, um noch anderen Konsumverlockungen nachzugeben.
Deregulierung nennt sich die entsprechende Wirtschaftspolitik, um Marktregulierungen wie Ladenschlussgesetze oder Preisbindungen abzubauen oder zu vereinfachen. Preisbindungen, die es zuvor für viele Artikel gegeben hatte, blieben nur noch für Bücher und Zeitschriften zugelassen, aus Respekt vor dem kulturellen Erbe und aus Angst davor, der Buchhandel würde sich noch mehr auf ein schmales Bestseller-Segment verengen. Ansonsten sollte der freie Wettbewerb die Preise finden. 2004 wurde die Reglementierung der Saisonschlussverkäufe abgeschafft; seitdem werden wir das ganze Jahr über mit angeblichen oder tatsächlichen Sonderverkäufen und Preisnachlässen bombardiert. Neben Kaufhäuser und Einzelhandelsgeschäfte treten Outlets, die Markenwaren zum Sonderpreis anbieten. Oder sind es doch nur angebliche Markenwaren zum angeblichen Sonderpreis?
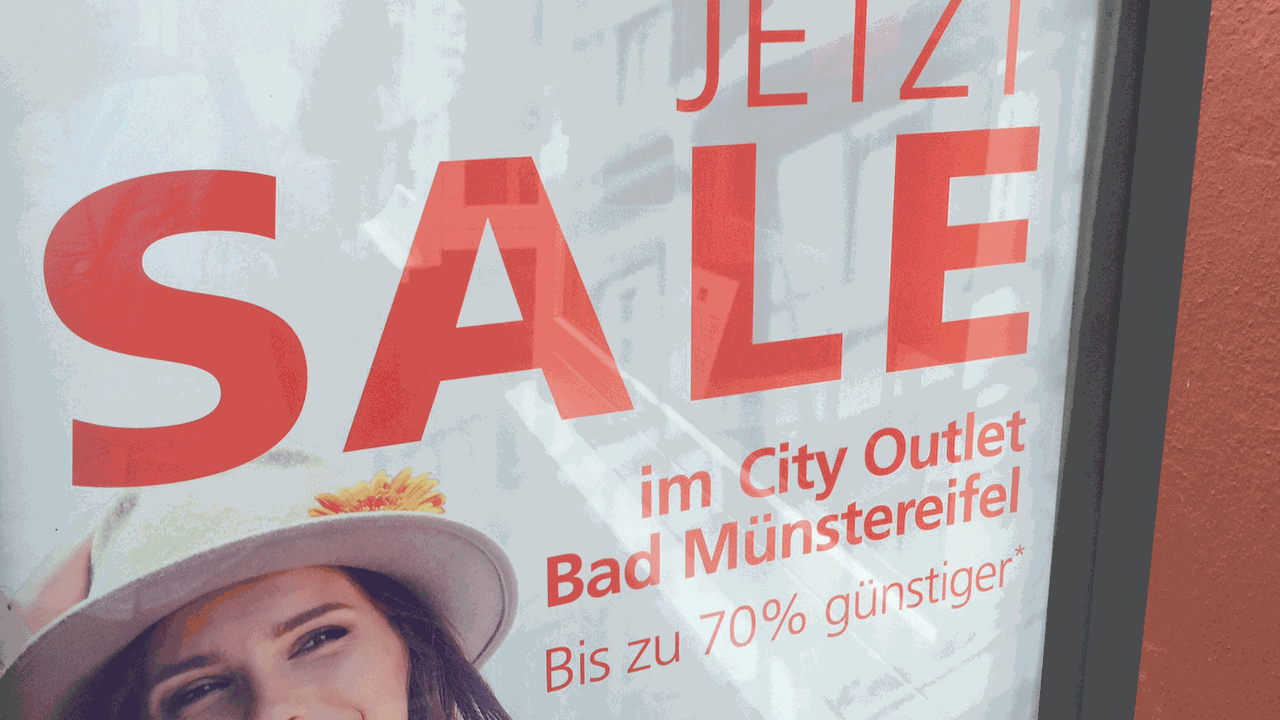
Verbraucherorganisationen, die recht und schlecht die Funktion einer Marktaufsicht übernommen haben, weil Staat und Gesellschaft mündige Bürger ja dazu anhalten, sich selbst vor Lug und Trug zu schützen, haben da jedenfalls erhebliche Kritik angebracht. Aus dem "Alles wird immer teurer" ist ein "In dem Preiswirrwarr kennt sich doch kein Mensch mehr aus!" geworden.
Es folgte die Phase der mehr oder weniger gezielten Chaotisierung der Preise. Die Deregulierung der Preise trug unter anderem dem Umstand Rechnung, dass die Hersteller immer mehr Kosten sparen konnten, indem sie ihre Produkte nicht mehr in großen Mengen in Lagern vorrätig hielten, sondern nach Bedarf produzierten und just in time auslieferten. Ebenso entsprach die Deregulierung einer Jagd nach Standortvorteilen, billigen Arbeitslöhnen und günstigen Transportbedingungen. Eine deregulierte Produktion benötigt eine deregulierte Preisermittlung.
Ökonomisch machte die erste Welle der Preis-Flexibilisierung also durchaus Sinn. Sie passte in die Zeit der weitgehenden Privatisierung, der Globalisierung und der Digitalisierung der Warenproduktion. Rasch reagieren können, Marktlücken nutzen, Überproduktionen und Überkapazitäten schnell abbauen und vor allem beständig neue Anreize schaffen für auf- und angeregte Marktteilnehmer: Schnäppchen jagen, Tanken, wenn es am billigsten ist, bevor die unsichtbare Hand die Preisschilder für Benzin und Diesel zauberhaft gleichmäßig nach oben korrigierte, Shopping-Tourismus zu Hersteller-Outlets. Man freute sich darüber, dass der Markt wieder kräftig in Bewegung geraten war, das Mitleid mit den Verlierern hielt sich in Grenzen. Schließlich konnte man immer darauf verweisen, dass auch die Kunden etwas von der flexiblen Preisgestaltung haben konnten, wenn sie nur aufmerksam genug das Geschehen beobachteten und sich vor dem allfälligen Betrug in acht nehmen würden. Doch kaum jemand fragte danach, was die Dynamisierung der Preise für die Kultur des Marktes bedeutete?
Dynamisierung der Preise erfolgt
Auf die Dynamisierung der Preise am Ort ist die Dynamisierung der Preise in der Zeit gefolgt. Vorreiter sind dabei die Hotel- und die Flugreise-Branche. Hotelzimmerpreise werden nicht nur in touristischen Gegenden nach Saison gestaffelt, sondern reagieren immer rascher auf die Nachfrage. In Zeiten von Messen, Volksfesten oder sportlichen Großereignissen verdoppeln und verdreifachen sich die Hotelzimmerpreise, daran ist man gewöhnt. Auch dass es in besucherschwächeren Zeiten Sonderangebote und Preisnachlässe gibt, verwundert nicht wirklich. Mittlerweile aber sind die meisten Hotels an sogenannte dynamic-pricing-Systeme angeschlossen, die Nachfrage direkt in die Preisgestaltung umsetzen. Die Preise ändern sich nun je nach Belegung, zuerst täglich, dann stündlich, mittlerweile bereits minütlich.
Das dynamic pricing ist die zweite Welle der Flexibilisierung der Preise. Es bietet dem einen Kunden eine Gelegenheit, günstig an eine Dienstleistung zu kommen, und es nutzt die Stimmung oder den Zwang des anderen aus, um höhere Preise zu durchzusetzen. So ergibt sich zunächst einmal eine Art Zweiklassensystem, wie es die Beratungsfirma "Spalteholz Hotelkompetenz" auf ihrer Webseite beschreibt:
"Beim dynamischen Preismodell unterteilt man den Nachfragemarkt in preisbereite und weniger preisbereite Kunden. Das preisbereite Marktsegment, zum Beispiel ein Geschäftsreisender, der ein bestimmtes Hotel in einer für seinen Reisezweck idealen Lage ad hoc buchen will und muss, braucht hohe Flexibilität, um jederzeit seine Anreise verschieben oder stornieren zu können. Diese Flexibilität hat ihren Preis. Der Kunde kauft sich also höhere Flexibilität in der Buchung zu einem höheren Preis ein, der nicht preisbereite Gast lässt sich zugunsten eines günstigeren Preises auf Restriktionen, also einschränkende Buchungs- und Stornobedingungen ein. Bekommt dafür aber einen oft sensationell günstigen Preis."
Im Hotel- wie im Fluggewerbe verzichtet derjenige, der einen günstigen Tarif wählt, auf einen Teil seiner Verbraucherrechte wie Rücktritt, Umbuchung, Tausch. Dynamic pricing passt den Preis der Nachfragesituation an.
Im Schweizer Skigebiet Pizol im Kanton St. Gallen wird seit zwei Jahren mit wetterabhängigen Preisen experimentiert: 54 Schweizer Franken kostet die Tageskarte bei blauem Himmel, nur 41 Franken dagegen bei Wolken und Nebel. Dem Beispiel Pizol sind mittlerweile viele Schweizer Skigebiete gefolgt. Fatal nur, wenn nun auch die Therme und der Schneeschuhverleih dem Prinzip des dynamic pricing folgen. Denn wo ein Unternehmen das Prinzip des dynamischen Preises einsetzt, wäre ein anderes, das mit ihm verbunden ist und bei fixen Preisen bliebe, wirklich dumm. Wie die Bergbahn richtet auch die Therme ihre Preise nach der Nachfrage.
Individualisierung von Preisen
Ist damit nicht allen gedient? Das Hotel kann seine Kapazität auslasten, der Geschäftsreisende kann seine Privilegien genießen und Herr oder Frau Mustermann können sich ein Hotel leisten, das ansonsten außerhalb ihrer Budgetplanung läge. Es ist leider ein wenig komplizierter.
Denn in Zeiten des boomenden Online-Handels setzen das dynamic pricing nicht nur bestimmte Branchen ein, sondern es ist allgegenwärtig. Online-Händler gleichen die Preise ihrer Produkte ständig nicht nur mit der Nachfrage, sondern auch mit den Preisen der Konkurrenten ab. Zudem ist es üblich, dass unterschiedliche Online-Kunden das gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen angeboten bekommen, nicht nur abhängig von Tageszeit oder Wochentag, sondern auch von der speziellen Situation des Interessenten. Denn wer im Internet unterwegs ist, liefert mehr oder weniger freiwillig den Online-Shops eine Menge von Informationen über sich selbst. Und schafft damit gleichzeitig die Grundlage für die dritte Welle der Preis-Flexibilisierung, nämlich die Individualisierung des Preises.
Die dynamische Preisermittlung betrifft mich nun nämlich nicht mehr als Teil der Gesamtbevölkerung wie an der Tankstelle und nicht mehr als Teil einer mehr oder weniger "preisbereiten" Kundengruppe. Sondern als einzelnen Menschen mit Eigenschaften, Gewohnheiten und Vorlieben. Bei diesem dynamic pricing fließt in die Preisgestaltung nicht allein die Situation des Online-Anbieters ein, sondern auch die individuelle Situation des Kunden. Fragt er mehrfach an? Aha, das Interesse ist groß, also kann der Preis nach oben gehen. Fragt er nicht mehr nach, kann ihm dagegen ein Preisnachlass angeboten werden. Wohnt er in einer reichen Stadt? Dann beginnen wir das dynamic pricing doch ein wenig höher. Benutzt er ein neueres Smartphone-Modell? Ein Konsumavantgardist, der einen Preisaufschlag sicher verträgt. Und dieser dynamisch individualisierte Preis gilt nur, wenn ich über einen bestimmten Vermittler zu einer bestimmten Zeit zuschlage und eventuell mit einer bestimmten Kreditkarte bezahle.
Dynamisierung des Preises bedeutet vor allem die Beschleunigung der Veränderung. An einer Tankstelle kann es einem bereits passieren, dass sich der Preis verändert, während man gerade den Zapfhahn aus seiner Halterung nimmt.

Das ist bald auch im Supermarkt möglich, der gerade seine gedruckten oder geschriebenen Preisschilder durch elektronische Preisanzeigen ersetzt. Über die Anpassung der Preise bestimmt nun nicht mehr Zentrale oder Filialleiter, sondern ein Algorithmus, der die Anzahl der Kaufvorgänge je nach Zeit und Tag errechnet, überfällige Produkte rasch abverkauft, Wettervorhersagen und Einwohnerstruktur bedenkt. Das elektronische Preisschild weiß um eine Lieferung von Tomaten aus Holland ebenso wie um den Zuckerpreis der Konkurrenz.
Und möglicherweise schon bald bepreist die Künstliche Intelligenz dahinter per Gesichtserkennung Kunden ganz individuell. Sie erkennt einen langen, sehnsuchtsvollen Blick auf eine Ware ebenso wie Kindergezeter und reagiert darauf. Ein solches intelligentes Preisschild ist natürlich marktwirtschaftliche Science Fiction, oder?
In den USA ist bereits mehr als die Hälfte aller Handelsunternehmen mit sogenannten Price Intelligence-Verfahren und verschiedenen Systemen von dynamischen und individualisierten Preisen ausgestattet, wenngleich mit sehr unterschiedlichen Methoden und sehr unterschiedlichen Resultaten. In Deutschland experimentierte der Media-Markt ab 2015 mit elektronischen Preisschildern. Die Kaiser’s-Supermarktkette erprobte 2015 in Berliner Filialen ein System personalisierter Rabatte, Netto und Penny folgten. Eine anonyme Kundenkarte speichert das Kaufverhalten des Kunden, vor jedem Einkauf spuckt ein Terminal eine Liste mit individuell zugeschnittenen Preisnachlässen aus. Nach drei Einkäufen kennt das System einen Kunden, verspricht der Marketing-Dienstleister SO1, der es entwickelt hat. Auf Produkte, die er bisher schon gekauft hat oder solche, die ihn neu interessieren sollen, erhält der Kunde Rabatte in genau der Höhe, die seinen Impuls zum Wechsel oder zu einem Zusatzkauf auslöst. Die Ziele: Kunden locken. Umsatz erhöhen. Marken pushen.
Der Markt weiß alles über den Kunden
Das dynamic pricing entzieht den Preis einer Ware der öffentlichen Diskussion, er wird aus dem Wissen des Systems über den Kunden ermittelt. Du weißt nichts mehr über den Markt, der Markt aber weiß alles über dich.
IBM bietet etwa eine Software namens Demandtec an, mit deren Hilfe Supermärkte, Lebensmittelhändler, Drogerien oder Baumärkte ihre Preise auf Basis von persönlichen Kaufmustern, Konkurrenzpreisen oder anderen Einflüssen ständig anpassen können. Dieselbe Ware, die einst durch ihren relativ stabilen, relativ verlässlichen und öffentlich ausgehandelten Preis das System der freien Marktwirtschaft begründete, kostet nun an jedem Ort, zu jeder Zeit und für jede Person etwas ganz anderes. Dazu passend gibt es eine zweite IBM-Software namens Xtify, mit der jeder Kunde zu jeder Zeit an jedem Ort über seine elektronischen Geräte aber auch über öffentliche Werbung oder Fensterwerbung direkt angesprochen werden kann.
"Jetzt kaufen. Hier kaufen. Du ganz allein."
Das Kalkül ist klar. Jemand, der jetzt eine Ware als besonders günstiges, personalisiertes Angebot kauft, wird sie beim nächsten Mal auch zum regulären und schließlich sogar zu einem überhöhten Preis kaufen. Jemand, der eigentlich zurückhaltend sein wollte, wird dazu gebracht, sein Geld doch noch auszugeben, weil er bei seinen intimsten Wünschen oder emotionalen Schwächen gepackt werden kann. Die in die Schaufensterpuppe eingebaute Kamera erkennt den sehnsuchtsvollen Blick und sendet auf deine App ein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst.
Wie dem auch sei. Wir werden uns wohl damit abfinden müssen, dass in Alltag und Freizeit der freie Markt nicht mehr das ist, was wir gewohnt waren. Der Preis hat sich nicht nur vom Wert der Ware verabschiedet, sondern auch von seiner sozialen Kommunikation. Er ist eine mehr oder weniger geheime Absprache zwischen Anbieter und Kunde, wobei jede Seite hofft, die andere zu übertrumpfen. Das Psychomarketing, das damit einhergeht, lässt von der gerühmten Rationalität des homo oeconomicus wenig übrig. Aber was geschieht mit uns, wenn die Preise immer weniger über den Wert der Waren aussagen? Wenn der Passagier neben mir für den Flug nur 7 Euro gezahlt hat, während ich 387 Euro dafür hinlegen musste?

Was geschieht, wenn der Preis nicht mehr ein gerechter Kompromiss, sondern privates Schicksal ist? Was geschieht, wenn der Markt so viel über mich weiß und so stark mit Belohnung und Bestrafung arbeitet, wie es anderswo autoritäre Regierungen und große Brüder tun? Was geschieht, wenn es auf dem Markt keine Gerechtigkeit und keine Diskussionen mehr gibt, sondern nur noch unendliche Rückkopplungseffekte und Manipulationen? Und wem nutzt das alles?
Eine vermeintliche Win-Win-Situation?
Marketing-Dienstleister wie SO1 werben damit, dass die Kunden die personalisierten Preise begeistert annehmen und sogar bereit seien, den Einzelhändler zu wechseln, um in den Genuss ihres Systems zu kommen, das man im Fachjargon "me-focused" – auf mich bezogen – nennt. Es gibt aber durchaus auch Beispiele dafür, dass die vermeintliche Win-win-Strategie nicht funktioniert. So brachen britische Kinoketten ein dynamic pricing-Experiment ab, als sich heraus stellte, dass nach einiger Zeit die Zuschauer den bisherigen Normalpreis als zu hoch erachteten. Der Kunde mag im Einzelfall tatsächlich einmal einen Preisvorteil erzielen, insgesamt aber soll dynamic pricing den Umsatz des Anbieters erhöhen.
Den Online-Handel, wo die Systeme zunächst erprobt wurden, verdächtigen kritische Verbraucher vielleicht eher einer Verbindung mit Big Data und Datenkraken als den Supermarkt, wo die Einkaufsgewohnheiten anonym verarbeitet werden. Wenn der intelligente Kühlschrank zuhause ihm mitgeteilt hat, dass neue Milch für die Cornflakes gebraucht wird, dann sagen ihm die künstlich-intelligenten Preisschilder im Supermarkt, welche Sorte seinem Preisempfinden, seiner Markenbindung, seinem Geschmack, seinem Gesundheitszustand und seiner Einkaufshistorie entspricht. Gegen die geballte Big Data-Macht der intelligenten Haushaltsgeräte, der immerwährenden und ebenfalls immer mehr personalisierten Werbung und der individuellen Preise im dramaturgisch inszenierten Supermarkt hat auch der viel beschworene mündige Verbraucher am Ende wenig Chancen.
Der Marketing-Dienstleister SO1 wirbt mit einer Untersuchung, nach der 67 Prozent aller Kunden individuelle Preise den allgemein verbindlichen vorziehen. Sind die restlichen 33 Prozent wirtschaftsfeindliche Konsummuffel, die aus lauter Angst um ihre Daten den Weg ins schöne neue Einkaufsparadies blockieren wollen? Oder sind es Kunden, die sich schon einmal persönlich gekränkt fühlten, weil individuell dynamisierte Preise den anderen bevorzugt haben? Haben sie beim Uber-Taxi die Erfahrung gemacht, dass dynamic pricing dazu führt, dass ein Schneesturm oder ein Hagelschauer die Transportpreise sprunghaft steigen lässt? Tatsächlich gibt es andere Untersuchungen, die davon ausgehen, dass die Hälfte aller Kunden lieber zur traditionellen Konkurrenz wechseln würde, als sich den Unwägbarkeiten des individuellen Preises auszusetzen.
Isolation der Kunden
Was immer durch das dynamisierte Preissystem erreicht wird, Gerechtigkeit, Fairness und Vertrauen gehören nicht dazu. Im schlimmsten Fall wird aus der sanften Verführung ein unbarmherziger Kampf und aus der Deregulierung eine neue Form von Ausbeutung.
Verbraucherschützer fürchten, dass dynamic pricing vor allem den Unternehmen hilft, Kunden zu übervorteilen, um größtmöglichen Profit zu erlangen. Rechtlich ist dynamic pricing in Deutschland nicht greifbar. Grundsätzlich steht es in der freien Marktwirtschaft dem Händler frei, seinen Preis für ein Produkt zu gestalten.
Bedeuten individuelle Preise nicht automatisch, dass Menschen nicht nur nach Kaufkraft, Kauflust und Kaufzwang eingeteilt werden, sondern auch nach Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Sprache oder Behinderung? Das soll das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verhindern, und personenbezogene Daten dürfen nur nach Einwilligung erhoben werden. Allerdings versteckt sich die oft in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die bekanntlich gerne ungelesen akzeptiert werden. Grundsätzlich fällt es schon schwer zu erkennen, ob ein Händler im Internet dynamic pricing betreibt und unter Einsatz welcher Parameter. Um wieviel schwerer ist es nachzuweisen, dass damit rassistische, sexistische und andere Diskriminierungen einhergehen.
Auf jeden Fall isoliert dynamic pricing die Kunden voneinander, löst die soziale Einigung über Gebrauchs- und Tauschwerte von Waren und Dienstleistungen auf und lässt das Kaufgeschehen in einem psycho-digitalen Nebel verschwinden. Und es ist ganz offensichtlich auch ein Mittel, das bewusst oder nicht, Spaltungen und Widersprüche in einer Gesellschaft vertieft. Es entsteht nicht nur ein neuer Datenkrake, sondern auch ein neuer Konfliktstoff. Nicht einmal als Konsumgemeinschaft überleben die mikrosozialen Einheiten, nicht einmal in der Verhandlung von Preisen auf dem Markt können allgemeine Verständigungen stattfinden. Nicht einmal beim Einkaufen erlebt man noch Nachbarschaft.
Den Konsumenten bleibt die atemlose Jagd nach dem Schnäppchen, begleitet von der Angst, dem System in die Falle zu gehen. Nicht mehr die Produzenten betreiben den härtesten Konkurrenzkampf unter sich, sondern es sind die Kunden, die das Konsumieren als Wettbewerb betreiben müssen. In der Welt der dynamisierten und individualisierten Preise wird der Konsum zur Arbeit, und schließlich zur Arbeit an sich selbst. Ich bin, was ich kaufe. Was ich wert bin, ergibt die Preisermittlung. Und der freie Markt verschwindet in den digital vernetzten Big Data-Wolken. Wir können erahnen, was dies für die politischen und kulturellen Grundlagen einer Gesellschaft bedeutet, in der Arbeit, Wert und Tausch ihre Beziehung zueinander verloren haben. Was es mit uns als Menschen macht.
