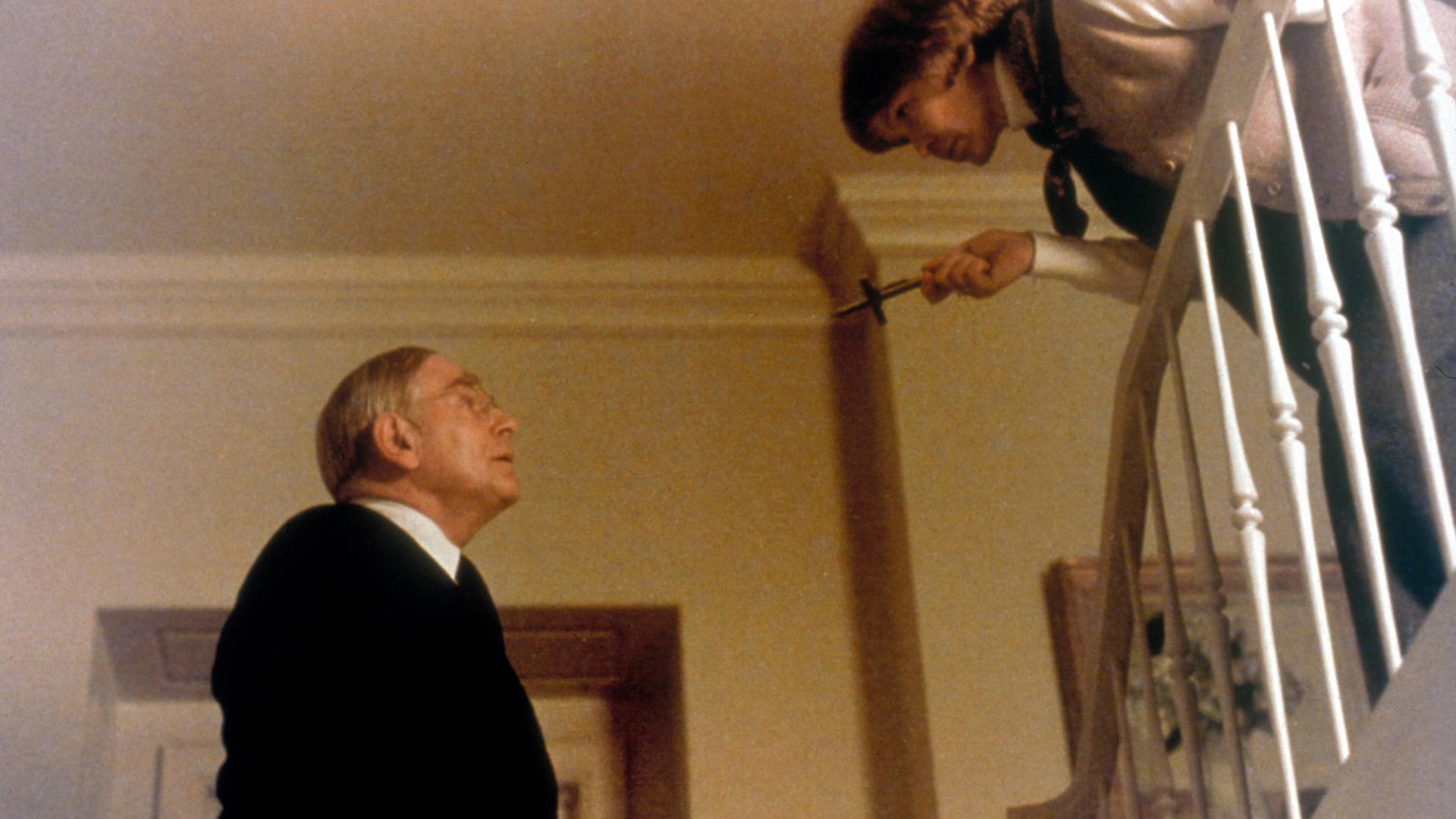Heidelberg, 1924: An der Universität macht ein Student von sich reden. Hans Oppenheimer legt mit 23 Jahren seine Promotionsschrift vor. Thema: „Die Logik der soziologischen Begriffsbildung“. Die Arbeit gilt als beste ihres Jahrgangs, renommierte Forscher zitieren sie. Und als ein paar Jahre später ein erstes Standardwerk zur Soziologie entsteht, wird darin auch Hans Oppenheimer erwähnt.
Heute ist das Nachwuchstalent – anders als sein berühmter Namensvetter Franz Oppenheimer – weitgehend vergessen – und das, obwohl noch in den späten 80er-Jahren ein Kollege schrieb, Oppenheimers Arbeit sei „unübertroffen“. Warum ist das so, fragte sich die Wissenschaftssoziologin Nicole Holzhauser von der TU Braunschweig. Die Antwort: Weil Oppenheimer es nicht in den „Kanon“ des Faches geschafft hat. Sein Aufsatz wurde nie zum „Klassiker“ – anders als Größen wie Max Weber oder Karl Marx.
„Wenn man Lehrbücher und Seminarpläne in der Soziologie vergleicht, insbesondere in der Grundlagenlehre, dann ist es überraschend, wie sehr sich die Inhalte dort gleichen. Man sieht über viele, viele Bücher hinweg, über zahlreiche Lehrpläne hinweg, dass immer wieder dieselben Personen behandelt werden, dass immer wieder dieselben Großtheorien behandelt werden und ähnliche Theorietraditionen verhandelt werden.“
Heute ist das Nachwuchstalent – anders als sein berühmter Namensvetter Franz Oppenheimer – weitgehend vergessen – und das, obwohl noch in den späten 80er-Jahren ein Kollege schrieb, Oppenheimers Arbeit sei „unübertroffen“. Warum ist das so, fragte sich die Wissenschaftssoziologin Nicole Holzhauser von der TU Braunschweig. Die Antwort: Weil Oppenheimer es nicht in den „Kanon“ des Faches geschafft hat. Sein Aufsatz wurde nie zum „Klassiker“ – anders als Größen wie Max Weber oder Karl Marx.
„Wenn man Lehrbücher und Seminarpläne in der Soziologie vergleicht, insbesondere in der Grundlagenlehre, dann ist es überraschend, wie sehr sich die Inhalte dort gleichen. Man sieht über viele, viele Bücher hinweg, über zahlreiche Lehrpläne hinweg, dass immer wieder dieselben Personen behandelt werden, dass immer wieder dieselben Großtheorien behandelt werden und ähnliche Theorietraditionen verhandelt werden.“
Viele Größen des Fachs sind heute vergessen
Aber nach welchen Kriterien werden diese Namen und Texte ausgewählt? Nicole Holzhauser hat das empirisch untersucht. Sie nahm sich eines der ersten Grundlagenwerk der Soziologie vor, ein 1931 erschienenes Handwörterbuch – mit fast tausend Namen ein „Who is who“ des damals entstehenden Faches. Diese Namensliste verglich sie mit dem Standard-Lehrbuch „Klassiker der Soziologie“, das seit den 1970ern immer wieder neu aufgelegt wurde, und fand heraus: Über die Jahrzehnte erhalten geblieben sind nur einige wenige Namen, die schon im ersten Handbuch besonders oft erwähnt wurden.
„Witzigerweise kann man anhand dieser Top-Ten, Top Twenty im Grunde schon sagen: Okay, die und die Personen werden wahrscheinlich Klassiker. Und wenn man es vergleicht mit den tatsächlichen Klassikern, kriegt man raus, dass diejenigen, die besonders große soziale Macht hatten damals, dann eben doch nicht Klassiker werden.“
Denn wer oft erwähnt wurde, weil er selbst am Handbuch mitschrieb oder der Fachgesellschaft vorstand, also „soziales Kapital“ hatte, schaffte es eher nicht in den Kanon. Durchgesetzt haben sich stattdessen die, die vor allem über „kulturelles Kapital“ verfügten, wie Nicole Holzhauser es nennt – also in erster Linie wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen hatten.
„Witzigerweise kann man anhand dieser Top-Ten, Top Twenty im Grunde schon sagen: Okay, die und die Personen werden wahrscheinlich Klassiker. Und wenn man es vergleicht mit den tatsächlichen Klassikern, kriegt man raus, dass diejenigen, die besonders große soziale Macht hatten damals, dann eben doch nicht Klassiker werden.“
Denn wer oft erwähnt wurde, weil er selbst am Handbuch mitschrieb oder der Fachgesellschaft vorstand, also „soziales Kapital“ hatte, schaffte es eher nicht in den Kanon. Durchgesetzt haben sich stattdessen die, die vor allem über „kulturelles Kapital“ verfügten, wie Nicole Holzhauser es nennt – also in erster Linie wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen hatten.
Systematische Benachteiligung bestimmter Gruppen
Das klingt so, als würde die Selektion im Fach funktionieren: Nur wer auf herausragendem Niveau forscht, bleibt der Nachwelt erhalten. Eines fällt allerdings auf: Unter denen, die sich als Klassiker durchsetzen konnten, ist keine einzige Frau – obwohl schon im Handbuch aus den 1930ern eine Reihe von Soziologinnen aufgeführt wurde.
Bestimmte gesellschaftliche Gruppen seien systematisch benachteiligt worden, sagt Nicole Holzhauser – darunter auch Arbeiterkinder oder jüdische Wissenschaftler, wie der Heidelberger Ausnahmestudent Hans Oppenheimer. Dabei sollten diese Merkmale keine Rolle spielen, meint die Soziologin:
„Mein Wunsch wäre – und das ist ein Motiv, weshalb ich diese ganze Forschung mache –, dass wir guten Gewissens sagen können: Ja, es geht um die Inhalte. Die Schöpfer interessieren uns eigentlich gar nicht so sehr, sondern die Inhalte sind das Entscheidende. Und wir finden Kriterien, wonach wir auswählen, was wissenschaftlich wirkmächtig sein soll und was nicht - weil der Kanon ist verdammt wirkmächtig, weil er unser ganzes Denken prägt.“
Bestimmte gesellschaftliche Gruppen seien systematisch benachteiligt worden, sagt Nicole Holzhauser – darunter auch Arbeiterkinder oder jüdische Wissenschaftler, wie der Heidelberger Ausnahmestudent Hans Oppenheimer. Dabei sollten diese Merkmale keine Rolle spielen, meint die Soziologin:
„Mein Wunsch wäre – und das ist ein Motiv, weshalb ich diese ganze Forschung mache –, dass wir guten Gewissens sagen können: Ja, es geht um die Inhalte. Die Schöpfer interessieren uns eigentlich gar nicht so sehr, sondern die Inhalte sind das Entscheidende. Und wir finden Kriterien, wonach wir auswählen, was wissenschaftlich wirkmächtig sein soll und was nicht - weil der Kanon ist verdammt wirkmächtig, weil er unser ganzes Denken prägt.“
Forschung ist heute meist Teamarbeit
Wichtig seien klare Kriterien auch deshalb, weil inzwischen so viele Artikel veröffentlicht würden, dass niemand in der Lage sei, einen Überblick zu behalten oder auch nur alle Abstracts zu lesen. Es stelle sich also die Frage: Wie bearbeiten wir diese Fülle?
Es gehe dabei nicht nur darum, mehr Frauen und anderweitig benachteiligte Forscher in den Kanon aufzunehmen, findet die Soziologin Felicitas Heßelmann, die an der Humboldt-Universität Berlin forscht:
„Ich halte es nicht für eine gute Lösung, zu sagen, wir müssen einfach mehr Frauen in die Positionen bringen, die jetzt Männer innehaben und dann wird das ganze System automatisch gut, sondern dass man eben vielleicht auch das ganze System verändern muss. Und dass es keine Verbesserung ist, wenn wir dann einfach mehr große Denkerinnen der Zeitgeschichte haben, die trotzdem irgendwie immer noch so herausgehoben sind, sondern ich denke, man braucht eine Struktur, die irgendwie mehr Diversität auch zulässt.“
Denn Forschung sei heute meist Teamarbeit, also eine kollektive Leistung: Über vielen Aufsätzen steht längst nicht mehr ein Name, sondern eine ganze Gruppe von Beteiligten. Felicitas Heßelmann wünscht sich:
„Dass man auch so ein bisschen wegkommt von dieser Idealisierung oder von dieser Ikonisierung von einzelnen großen Denkern, die dann ihre einzelnen genialen Ideen haben, sondern das eben mehr versteht als so diskursive Zusammenhänge, die eben von diversen Menschen auch betrieben werden und die vielleicht auch mehr diverse Sichtweisen widerspiegeln.“
Es gehe dabei nicht nur darum, mehr Frauen und anderweitig benachteiligte Forscher in den Kanon aufzunehmen, findet die Soziologin Felicitas Heßelmann, die an der Humboldt-Universität Berlin forscht:
„Ich halte es nicht für eine gute Lösung, zu sagen, wir müssen einfach mehr Frauen in die Positionen bringen, die jetzt Männer innehaben und dann wird das ganze System automatisch gut, sondern dass man eben vielleicht auch das ganze System verändern muss. Und dass es keine Verbesserung ist, wenn wir dann einfach mehr große Denkerinnen der Zeitgeschichte haben, die trotzdem irgendwie immer noch so herausgehoben sind, sondern ich denke, man braucht eine Struktur, die irgendwie mehr Diversität auch zulässt.“
Denn Forschung sei heute meist Teamarbeit, also eine kollektive Leistung: Über vielen Aufsätzen steht längst nicht mehr ein Name, sondern eine ganze Gruppe von Beteiligten. Felicitas Heßelmann wünscht sich:
„Dass man auch so ein bisschen wegkommt von dieser Idealisierung oder von dieser Ikonisierung von einzelnen großen Denkern, die dann ihre einzelnen genialen Ideen haben, sondern das eben mehr versteht als so diskursive Zusammenhänge, die eben von diversen Menschen auch betrieben werden und die vielleicht auch mehr diverse Sichtweisen widerspiegeln.“
Mehr Diversität in der Lehre
In Lehrveranstaltungen könnte dann nicht mehr Max Weber oder Karl Marx auf dem Lehrplan stehen, sondern das Thema Diskurstheorien oder Theorien kollektiven Handelns. Bis sich der Wandel in einem Fach in der Lehre niederschlage, könne es allerdings Jahre dauern, sagt Nicole Holzhauser. Aber: Es lohne sich, die Geschichte der Soziologie daraufhin abzuklopfen, ob nicht wichtige Personen aus dem Gedächtnis verschwunden seien.
„Klassiker ist nicht nur etwas Historisches und etwas historisch Gewachsenes, sondern es ist etwas, das wir jeden Tag praktizieren. Das ist ein fortlaufender Prozess. Und das ist ein Prozess, auf den wir starken Einfluss haben.“
Hans Oppenheimer, der vielversprechende Heidelberger Nachwuchswissenschaftler, verlässt nach seiner Promotion die Wissenschaft – vielleicht aus finanziellen Gründen, vielleicht, weil er als Jude mit besonderen Hürden rechnet. Er arbeitet erst bei der Handelskammer Berlin, dann bei einer Bank. Den Nazi-Terror überlebt er nicht, er stirbt im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Heute hat der einstige Ausnahmedenker nicht einmal einen Wikipedia-Beitrag.
„Klassiker ist nicht nur etwas Historisches und etwas historisch Gewachsenes, sondern es ist etwas, das wir jeden Tag praktizieren. Das ist ein fortlaufender Prozess. Und das ist ein Prozess, auf den wir starken Einfluss haben.“
Hans Oppenheimer, der vielversprechende Heidelberger Nachwuchswissenschaftler, verlässt nach seiner Promotion die Wissenschaft – vielleicht aus finanziellen Gründen, vielleicht, weil er als Jude mit besonderen Hürden rechnet. Er arbeitet erst bei der Handelskammer Berlin, dann bei einer Bank. Den Nazi-Terror überlebt er nicht, er stirbt im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Heute hat der einstige Ausnahmedenker nicht einmal einen Wikipedia-Beitrag.