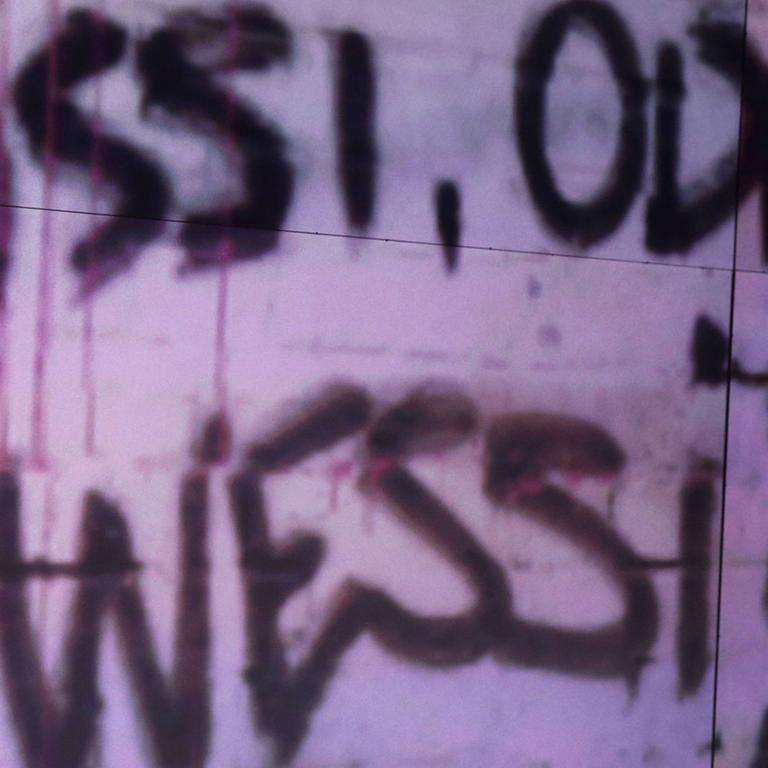Stephanie Rohde: Brandenburg und Sachsen wählen morgen – aber wie? Um genau das zu ergründen, wurde das eine oder andere Psychogramm der Ostdeutschen erstellt. Was daran Klischees von Westdeutschen sind und was Realität, darüber wurde sehr viel gestritten, auch mit Blick auf den "Spiegel"-Titel: "So isser, der Ossi". Wie Ostdeutsche in der Bundesrepublik gesehen werden 30 Jahre nach der Wende, das hat die Soziologin Naika Foroutan untersucht, und sie wollte dann auch noch wissen: Kann man die Ausgrenzung Ostdeutscher vergleichen mit der von muslimischen Migranten? Ihre Studie trägt den Titel "Ostmigrantische Analogien", und neu daran ist nicht die Erkenntnis, dass sowohl Migranten als auch Ostdeutsche unterdurchschnittlich verdienen und in der Politik unterrepräsentiert sind, sondern der Hinweis, dass beide auf ähnliche Art und Weise mit Klischees belegt werden, oft von Westdeutschen. Wenn dem so ist, müssten Westdeutsche in der Bundesrepublik dann anfangen, kritisch zu reflektieren, was ihr Westdeutsch-Sein eigentlich ausmacht? Also braucht es mehr "Critical Westness" in der Bundesrepublik? Darüber habe ich mit Naika Foroutan gesprochen, sie ist Professorin an der HU Berlin und Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung, und ich wollte von ihr wissen: Warum sagen Sie, dass Ostdeutsche in der Bundesrepublik ähnlich benachteiligt werden wie muslimische Migranten?
Naika Foroutan: Ja, tatsächlich haben wir in unserer Studie weniger auf die Ähnlichkeit in der Benachteiligung geschaut, das haben Sie eben ja schon erwähnt, es gibt viele Studien, die strukturelle Benachteiligungen nachweisen, zum Beispiel geringeres Vermögen, höhere Armutsrisiken oder geringere Renten und so weiter. Wir wollten tatsächlich eher schauen auf die Analogien, also die Ähnlichkeiten, die es in der symbolischen Abwertung dieser beiden Gruppen gibt. Also wie sind diese beiden Gruppen mit Stereotypen konfrontiert und ähneln sich diese vielleicht überraschenderweise?
"Dieses Opfernarrativ, das kam sehr oft"
Rohde: Aber wie wird eine Frau mit Kopftuch, sagen wir in Stuttgart, auf ähnliche Weise abgewertet wie ein Kohlearbeiter in der Lausitz?
Foroutan: Das sind ja zunächst mal nur größere Gruppenbeobachtungen, die wir hier angestellt haben. Wir gehen gar nicht so stark auf die Mikrodimension, da unterscheiden sich selbstverständlich die Abwertungserfahrungen. Rassismus ist etwas anderes und davon betroffen zu sein als die Tatsache, als Ostdeutscher irgendwie belächelt zu werden, oder dass man sich über den Akzent lustig macht. Aber wir hatten im Vorfeld tatsächlich Gruppeninterviews geführt mit Ostdeutschen, und darüber wollten wir herausfinden, mit welchen Stereotypen diese Gruppe sich auch 30 Jahre nach der Wende noch konfrontiert sieht und was sie besonders stört. Und da wurde überproportional oft genannt, dass man das Gefühl habe, man dürfe sich nicht über diese Ungleichheit beklagen, weil einem sofort entgegenschallt, man sei immer noch der Jammer-Ossi von früher und man solle sich doch endlich mal freuen darüber, dass die Dresdner Innenstadt so gut aufgebaut ist. Ich stilisiere das jetzt mal ein bisschen. Also dieses Opfernarrativ, das kam sehr oft. Dann kam ein weiterer Stereotyp, mit dem man umgehen muss, nämlich, dass der Osten immer nur als brauner Osten imaginiert wird, also der Vorwurf, man distanziere sich nicht genug vom Extremismus. Und dann gab es noch einen anderen Vorwurf, nämlich, man sei noch nicht im heutigen Deutschland angekommen, und das nach 30 Jahren. Das hat uns ein wenig daran erinnert, weil wir sind ja eigentlich von Haus aus Migrationsforscher, dass wir sehr ähnliche Stereotype in den letzten Jahren auch schon untersucht haben mit Bezug auf die Gruppe der Muslime, und dann sind wir reingegangen und haben reingezoomt in die Bevölkerung, weil es ja immer etwas anderes ist, ob man das selbst so wahrnimmt, oder ob man dann mit Zahlen nachweisen kann, nein, es stimmt, ein großer Teil der westlichen Bevölkerung denkt das von eurer sozialen Gruppe. Und wir waren überrascht, zu erkennen, dass bei knapp 40 Prozent der Westdeutschen diese Stereotype relativ handfest vorhanden waren, also dass der Ostdeutsche sich grundsätzlich als Opfer sehen würde, sich nicht vom Extremismus distanziere oder noch nicht im heutigen Deutschland angekommen sei. Und zu fast analogen Positionen oder ähnlichen Höhen haben wir das gefunden als Vorwurf gegenüber Muslimen. Das hat unsere Hypothese in der Form empirisch bestätigt.

Rohde: Das heißt, Sie haben quasi diese Analogie mit muslimischen Migranten gewählt, um die Stereotypisierung von Ostdeutschen thematisieren zu können, sichtbar zu machen?
Foroutan: Ja, wir haben vor allen Dingen das gewählt, um deutlich zu machen, dass, wenn es gegenüber zwei gänzlich unterschiedlichen sozialen Gruppen in der Bevölkerung doch sehr ähnliche Stereotype und Abwertungsmechanismen gibt, dass es dann wahrscheinlich nicht so weit führt in unseren Erklärungsprämissen, wenn wir das immer über die Gruppen selbst erklären: Das ist so, weil der Ostdeutsche in der DDR geboren ist, oder das ist so, weil die muslimische Kultur so ist – und das sind ganz starke Erklärprämissen, die wir gesamtgesellschaftlich seit Langem anwenden. Wir haben uns gedacht: Wenn man für zwei eben so unterschiedliche Gruppen ähnlich abwertend positioniert ist, wäre es doch vielleicht interessant, den Blick mal zu wenden und auf den oder die Stereotypisierenden zu schauen.
"Wir haben ein westdeutsches Normalitätsparadigma"
Rohde: Das wären dann die Westdeutschen in dem Fall, und die Journalistin Nelli Tügel hat da den Begriff ins Spiel gebracht der Critical Westness. Also um mal ein bisschen den Hintergrund zu erläutern: Es gibt den Begriff der Critical Whiteness, also dass man weiße Menschen darauf aufmerksam macht, dass sie eben nicht einfach Menschen sind, sondern weiße Menschen und damit eben gesellschaftliche Privilegien einhergehen. Könnte man davon ausgehend jetzt sagen, wir brauchen mehr Critical Westness?
Foroutan: Ja, das ist insofern interessant, weil das einfach die Perspektive der Betrachtungen und Beobachtungen und auch der Analyse verschieben kann. Toni Morrison, die ja kürzlich gestorben ist, hat auch dieses Konzept aufgenommen und hat gesagt, wenn wir uns die ganze Zeit bei einem Blick auf ein Aquarium darauf konzentrieren, die Fische und das Wasser zu benennen, aber aus den Augen verlieren, dass es eigentlich das Aquarium ist, das die Beziehung zwischen Fisch und Wasser konditioniert, weil wir einfach diese fish bowl, dieses Aquarium nicht sehen und nicht beschreiben, dann fehlt uns eine Analysekomponente. Und es ist in der Tat so, dass Deutsche oder die deutsche Identität relativ dominant als westdeutsch imaginiert wird. Wir haben ein westdeutsches Normalitätsparadigma, wenn man das so sagen kann, und in dieses Normalitätsparadigma passen die anderen, in dem Falle die Ostdeutschen, die Migranten, Migrantinnen oder auch die Muslime, Muslima, wie auch immer, wen man da gerade in den Blick nimmt, vor allen Dingen über Devianzmessung, also über Abweichungen: Was macht die anders zu uns, die wir das vermeintlich normalisierende, kodierte Element sind? Und es macht die Beziehungszusammenhänge offener, wenn es uns gelingen würde, auch diesen dritten Part mit reinzunehmen und zu schauen: Woher kommt eigentlich die Erzählung oder diese hegemoniale Position, dass man sich bestimmte Privilegien behalten kann, nämlich, alles an der Normalität auszurichten danach, dass es ein bundesrepublikanisches gelesenes Deutsches gibt?
Rohde: Sie sagen also, dass dieses Westdeutsch-Sein quasi der unsichtbare Maßstab auch heute noch in der Bundesrepublik ist. Aber kann man nicht sagen, allein dadurch, dass wir das Wort "westdeutsch" benutzen, sehen wir doch schon, dass es ein Attribut ist, das einhergeht mit bestimmten Zuschreibungen, also beispielsweise kapitalistisch geprägt, individualistischer? Also das ist doch auch eine Identität, die schon sichtbar gemacht wurde.
Foroutan: Na ja, wenn wir uns das mal anschauen: Wir haben in dieser Studie auch noch weitere Fragen gestellt, zum Beispiel danach, ob die Menschen sich eher als deutsch oder als westdeutsch bezeichnen würden, die Menschen, die aus Ostdeutschland kamen, haben wir natürlich danach gefragt, ob sie sich eher als deutsch oder ostdeutsch beschreiben. Und während wir bei den Ostdeutschen ungefähr 30 Prozent festhalten konnten, für die die Markierung als Ostdeutsch relevanter ist, war das bei den Westdeutschen verschwindend gering. Es heißt also im Umkehrschluss: Das Deutsche ist das Westdeutsche. Die Definition, die Benennung ist noch gar nicht so da. Und so lange wir nicht benennen, können wir auch auf die Ungleichheiten nicht aufmerksam machen. Nehmen Sie mal als Beispiel ostdeutsche Universitäten. In einer Studie wurden die Biografien von 81 Universitäten in Deutschland untersucht, dort gibt es keinen einzigen Universitätsrektor, der selber aus Ostdeutschland kommt.[*] So lange wir die Geschichte erzählen, es gibt doch keine Unterschiede mehr, können wir auch nicht darauf hinweisen, dass es eine eklatante Ungleichheit gibt, weil diese schöne Geschichte von, sind wir nicht alle schon längst gleich, das deckt uns die Augen zu für die Ungleichheiten, die wir seit 30 Jahren fortschreiben.
"Es geht jetzt nicht darum, ein Westdeutschen-Bashing aufzusetzen"
Rohde: Und wenn man diese Ungleichheiten sichtbar machen würde, wie würden da Ostdeutsche und Westdeutsche von profitieren? Also würde sich da ein neues Deutschlandbild, eine neue Imagination von Deutschland formen können?
Foroutan: Wenn die Imagination von Deutschland im Grunde genommen darauf basiert, dass dies eine plurale Demokratie ist, und einer der Kernsätze der pluralen Demokratie ist Artikel 3, kein Mensch darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, Geschlecht et cetera benachteiligt werden, dann müssen wir natürlich den Grad unserer Demokratie auch an der Benachteiligung von nicht-dominanten Gruppen messen. Und so lange es diese Benachteiligung gibt, bleibt dies keine erfüllte Demokratie, und wir sehen das daran, dass sehr viele Menschen anfangen, an der Qualität der Demokratie zu zweifeln. Und das führt dann wiederum zur Erosion von diesen Werten, die wir so verinnerlicht haben.
Rohde: Das heißt letztlich: Um die Demokratie zu retten, müssen wir darüber reden, was Westdeutsch-Sein bedeutet?
Foroutan: Na ja, wir müssen vor allen Dingen darüber sprechen, wer in dieser Gesellschaft privilegiert ist und welche Möglichkeiten es gibt, zu teilen und Privilegien möglicherweise auch abzugeben. Es geht jetzt nicht darum, ein Westdeutschen-Bashing aufzusetzen, um sich quasi zu rächen für erfahrene Ungleichheit, es geht nur darum, das Westdeutsche sichtbar zu machen in all seiner Dominanz.
Rohde: Könnten Sie denn ein Beispiel geben für diese Dominanz des westdeutschen Bildes als deutsches?
Foroutan: Ja, tatsächlich finden wir das gerade auch mit Bezug auf die Wahlen, die anstehen. Es ist schon sehr überraschend, dass so jemand wie Kalbitz, der in Brandenburg als Kandidat für die AfD ins Rennen geht, oder auch solche Figuren wie Höcke oder Gauland, die genuin westdeutsche Männer sind, es schaffen, mit einem Slogan wie "Vollende die Wende" so zu tun, als wären sie an der Revolution in Ostdeutschland beteiligt gewesen. Auch dazu benötigt es ganz schön viel Chuzpe, und es soll so ein wenig meiner Meinung nach zeigen: Wir Westdeutschen können selbst das besser und vollenden das für euch, was ihr nicht richtig zu Ende geführt habt. Und ich verstehe gar nicht, wie man das gar nicht so stark als ein Dominanznarrativ reflektiert.
Rohde: Westdeutsche sehen sich meistens als Deutsche, während Ostdeutsche sich zum Teil als Ostdeutsche identifizieren, das Deutsche ist also auch 30 Jahre nach der Wende noch das Westdeutsche. Und genau das müssen wir benennen, um sinnvoll über Ungleichheiten sprechen zu können in der Bundesrepublik. Das meint Naika Foroutan.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
[*] Anm. der Redaktion: An dieser Stelle war in der ursprünglichen Version eine falsche Einordnung angegeben. Die nun korrigierte Zahl basiert auf einer Studie des CHE gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung (http://www.che.de/downloads/CHECK_Universitaetsleitung_in_Deutschland.pdf), welches 81 Biografien von Universitätsrektoren untersucht hat. Laut Hochschulrektorenkonferenz gab es 2019 insgesamt 121 Universitäten in Deutschland (https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-06-Hochschulsystem/Statistik/2019-05-16_Final_fuer_Homepage_2019_D.pdf).