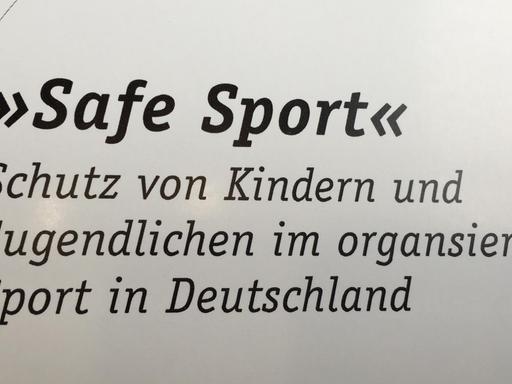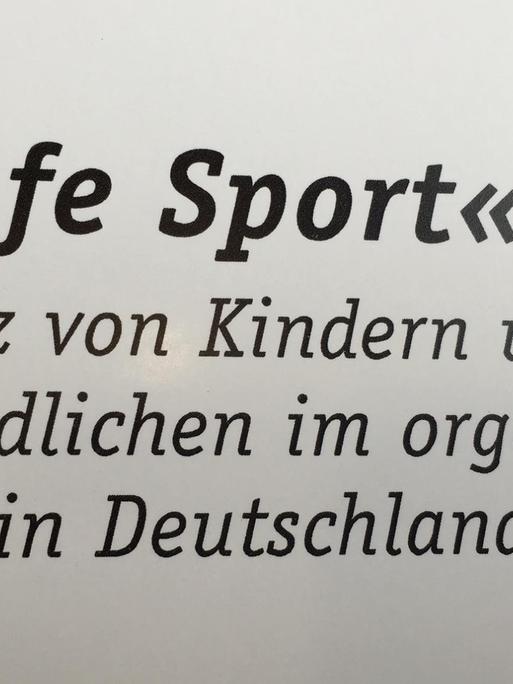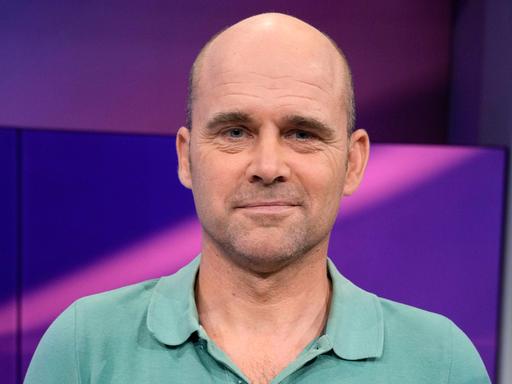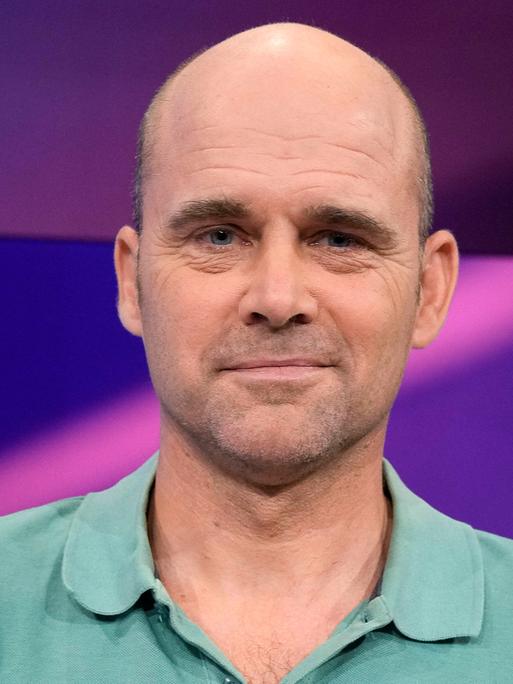Triggerwarnung:
Im folgenden Beitrag werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für die Betroffene geschildert, die belastend und retraumatisierend sein können.
Im folgenden Beitrag werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für die Betroffene geschildert, die belastend und retraumatisierend sein können.
Von Demütigung bis zu schwerer sexualisierter Gewalt: Machtmissbrauch kommt sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport vor. Welche Schutzkonzepte es gibt, welche Anlaufstellen für Betroffene und warum diese allein nicht ausreichen.
- Warum ist der Sport von Gewalt betroffen?
- Welche Gewaltformen gibt es im Sport ?
- Welches Ausmaß hat sexualisierte Gewalt im Leistungssport?
- Sind diese Gewaltformen nur auf den Leistungssport beschränkt?
- Was berichten Betroffene?
- Gab es Entschädigungszahlungen an Betroffene aus dem Sport?
- Bekommen Betroffene aus dem Sport finanzielle Unterstützung?
- Welche anderen Unterstützungsmaßnahmen gibt es?
- Was tut der organisierte Sport?
- Wie sieht es mit der Aufarbeitung aus?
Warum ist der Sport von Gewalt betroffen?
Der Sport bietet potenziellen Tätern leicht Zugang zu Kindern und Jugendlichen. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, werden mit offenen Armen aufgenommen. Täter gehen strategisch vor, engagieren sich intensiv, machen sich beliebt bei Eltern und Kindern und gewinnen so Vertrauen. Mögliche Vorbehalte schwinden bald und schnell vertraut man Kinder der Person an, die dieses Vertrauen im schlimmsten Fall für ihre Zwecke ausnutzt.
Im Leistungssport kommt der Faktor Erfolg hinzu. In Sportarten wie Schwimmen oder Turnen kommen Kinder bereits früh ins System. Hier sehen sie sich häufig einem psychischen und körperlichen Druck ausgesetzt. Öffentliches Anbrüllen, Demütigung und Bodyshaming oder Essensentzug sind Formen der psychischen Gewalt, über die Athletinnen und Athleten immer wieder berichten. Das gilt auch für körperliche Übergriffe wie Zwang zum Training trotz Verletzungen, Schütteln oder Schläge.
Welche Gewaltformen gibt es im Sport ?
Sexualisierte Gewalt:
In der Wissenschaft bezeichnet dieser inzwischen allgemeingültige Begriff verschiedene Formen der Machtausübung mit dem Mittel der Sexualität. Dazu gehören verbale sexuelle Belästigung, etwa über unangemessene Sprüche oder Textnachrichten, das Zeigen pornografischer Inhalte sowie körperliche Übergriffe und Vergewaltigung.
Psychische Gewalt:
Hier sprechen die Forschenden von Machtmissbrauch etwa in Form von Demütigung, Anschreien, Bodyshaming, Essensentzug.
Körperliche Gewalt:
Bei dieser Form handelt es sich zum Beispiel um den Zwang zum Training, obwohl der Athlet oder die Athletin verletzt ist, zu viel und zu hartes Training bis zur absoluten körperlichen Erschöpfung, Verabreichung von Medikamenten durch Trainerin oder Trainer.
Welches Ausmaß hat sexualisierte Gewalt im Leistungssport?
Die erste Studie zum Ausmaß der geschilderten Gewaltformen im Sport begann 2014. Die Sporthochschule Köln führte die Studie „Safe Sport“ zusammen mit der Uniklinik Ulm durch und befragte dazu 1800 Leistungssportlerinnen und -sportler. Mehr als ein Drittel von ihnen gab an, im Leistungssport bereits einmal eine Form von sexualisierter Gewalt erfahren zu haben. Bei einer bzw. einem von neun Befragten handelte es sich um schwere oder länger andauernde Gewalterfahrungen.
Psychische Gewalt hatten neun von zehn Sportlerinnen und Sportler erlebt, physische Gewalt etwa 30 Prozent.
Sind diese Gewaltformen nur auf den Leistungssport beschränkt?
Auch der Breiten- und Vereinssport ist von Gewalthandlungen betroffen. Das haben die Forschenden aus Köln, Ulm und Wuppertal in ihrer Studie „Sicher im Sport“ (Beginn 2020) herausgearbeitet.
Mehr als 4000 Personen hatten sich an der Onlinebefragung beteiligt. 70 Prozent von ihnen hatten angegeben, im Vereinssport bereits eine Form von Gewalt, Grenzverletzung oder Belästigung erfahren zu haben. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um psychische Gewalt. Ein Viertel der Befragten hatte sexualisierte Gewalt im Vereinssport erlebt.
Was berichten Betroffene?
Die Aufarbeitungskommission der Bundesregierung hat 2022 eine Fallstudie veröffentlicht, in der 72 Betroffene aus dem Sport im Rahmen von vertraulichen Anhörungen ihre Geschichte erzählt haben. Es ist die bisher größte wissenschaftliche Auswertung dieser Art.
Eines der Ergebnisse: Wenn sich Betroffene an Verantwortliche gewandt und versucht hatten, auf die Missstände hinzuweisen, hatten sie kein Gehör gefunden oder ihnen war nicht geglaubt worden. Als Folge der in den meisten Fällen schweren sexualisierten Gewalt und der über Jahre andauernden Übergriffe hatten die Betroffenen von lebenslänglichen Schäden für Körper und Seele berichtet.
Gab es Entschädigungszahlungen an Betroffene aus dem Sport?
Es gibt bisher erst einen bekannt gewordenen Fall, in dem ein betroffener Athlet eine Entschädigungszahlung erhalten hat: Der deutsche Schwimmverband hat dem ehemaligen Weltklasse-Wasserspringer Jan Hempel eine Zahlung von 600.000 Euro zukommen lassen.
Hempel war durch seinen früheren Trainer über Jahre schwerer sexualisierter Gewalt ausgesetzt worden. Verantwortliche, die darüber informiert gewesen waren, hatten nichts unternommen und keine Hilfe geleistet. Das ist auch das Ergebnis der Arbeit einer unabhängigen Kommission, die der Deutsche Schwimmverband zur Aufarbeitung der Vorwürfe eingesetzt hatte. Weitere Entschädigungszahlungen hat es bisher nicht gegeben.
Bekommen Betroffene aus dem Sport finanzielle Unterstützung?
Betroffene aus dem Sport können beim „Fonds sexueller Missbrauch“ Anträge auf Unterstützung im Rahmen des „ergänzenden Hilfesystems“ stellen. Wird der Antrag genehmigt, können Betroffene hier eine einmalige Unterstützung von maximal 10.000 Euro, etwa für Therapien, erhalten. Immer wieder kritisieren Betroffene die schleppende Bearbeitung der Anträge. In manchen Fällen warten sie zum Teil mehrere Jahre und berichten, dass diese Unterstützung nicht ausreicht, um etwa eine Berufsunfähigkeit als Folge der Übergriffe finanziell auszugleichen.
Welche anderen Unterstützungsmaßnahmen gibt es?
Vor zweieinhalb Jahren hat die unabhängige Anlaufstelle „Anlauf gegen Gewalt“ ihre Arbeit aufgenommen. Hier können sich Betroffene von Gewalt im Leistungssport melden. Es ist die erste Beratungsstelle für Betroffene speziell aus dem Sport. Sie wird vom Verein „Athleten Deutschland“, der Interessenvertretung der Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, finanziert.
Seit Sommer 2023 arbeitet der unabhängige Verein Safe Sport e. V. als Ansprechstelle für Betroffene aus dem Breiten- und Vereinssport. Dieser Verein wird vom Bundesinnenministerium und den Ländern finanziell gefördert. Ein im Koalitionsvertrag festgehaltenes Zentrum für Safe Sport soll eine Clearingstelle werden, die unabhängig vom organisierten Sport die Intervention und Aufarbeitung von Fällen interpersonaler Gewalt übernehmen kann.
Was tut der organisierte Sport?
Im Jahr 2010 hat sich der organisierte Sport in der sogenannten „Münchener Erklärung“ zum Schutz vor sexualisierter Gewalt verpflichtet. Es gibt zahlreiche Maßnahmen und Projekte zur Prävention interpersonaler Gewalt im Sport, etwa das Qualitätsbündnis des Landessportbundes NRW.
Hier erhalten Vereine Hilfestellung und Beratung, etwa beim Erstellen von Kinderschutzkonzepten und Risikoanalysen. Solche Schutzkonzepte sind mittlerweile im Leistungssport erforderlich, wenn ein olympischer Spitzenverband Fördermittel durch das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium erhalten will. Das soll schrittweise auch für den Breitensport umgesetzt werden.
Ein neues Regelwerk soll dem organisierten Sport helfen, auch Übergriffe im Sport, die nicht strafrechtlich relevant sind, rechtssicher zu ahnden und den Täter etwa durch Suspendierung oder Lizenzentzug zu sanktionieren. Diesen „Safe Sport Code“ haben die Delegierten im Dezember 2024 auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes verabschiedet. Bis er wirklich auch an der Basis anwendbar ist, wird es Jahrzehnte dauern.
Wie sieht es mit der Aufarbeitung aus?
Nach öffentlich bekannt gewordenen Fällen im Schwimmen, Tennis, Handball oder Turnen wurden Aufarbeitungskommissionen eingesetzt. Die Kommission im Handball musste aus rechtlichen Gründen aufgelöst werden und konnte ihre Arbeit nicht zu Ende führen. Die Kommissionen für Schwimmen und Tennis haben ihre Abschlussberichte vorgelegt.
Der Öffentlichkeit sind lediglich Kurzfassungen von wenigen Zeilen bis zu mehreren Seiten zugänglich gemacht worden. Den Verbänden wurden Empfehlungen ausgesprochen, auf welche Weise sie ihre Strukturen ändern müssen, um Machtmissbrauch in ihrem Sport in Zukunft zu verhindern.
Betroffene von sexualisierter Gewalt im Sport oder deren Angehörige können sich an die unabhängige Anlaufstelle für Betroffene im Spitzensport wenden.
Website: www.anlauf-gegen-gewalt.org
Telefon: 0800 90 90 444 (Mo, Mi & Fr 9-13 Uhr · Di & Do 16-20 Uhr · Nicht erreichbar an bundesweiten gesetzlichen Feiertagen)
Website: www.anlauf-gegen-gewalt.org
Telefon: 0800 90 90 444 (Mo, Mi & Fr 9-13 Uhr · Di & Do 16-20 Uhr · Nicht erreichbar an bundesweiten gesetzlichen Feiertagen)
Andrea Schültke