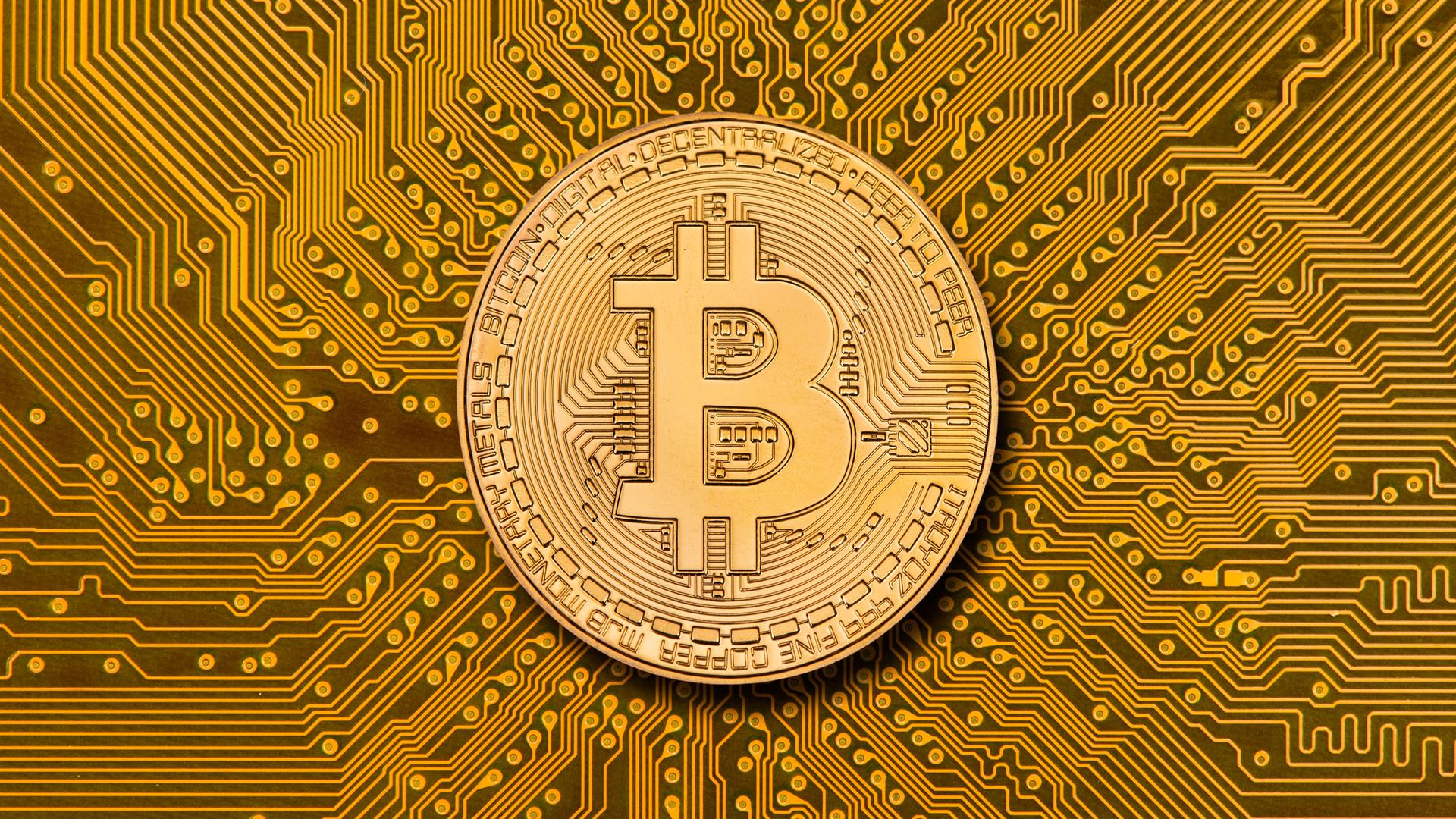Die Inflation zieht momentan deutlich an. Die Verbraucherpreise stiegen im Euro-Raum im Juli binnen Jahresfrist um 2,2 Prozent, das ist die höchste Rate seit Herbst 2018. In Deutschland stiegen die Preise im Juli sogar um 3,8 Prozent.
Und die Inflation dürfte noch weiter steigen: Denn ein viel beachteter Inflationsvorbote für die Euro-Zone schlägt so stark nach oben aus wie noch nie: Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im Juni in Rekordtempo gestiegen. Sie legten um 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit dem Start der Währungsunion 1999.
Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank, sieht eine Reihe von Gründen für den Anstieg der Inflation, einige davon betreffen nur Deutschland: Seit Anfang dieses Jahres beträgt die Mehrwertsteuer wieder 19 und nicht mehr 16 Prozent. Dazu komme der CO2-Aufschlag, den Deutschland auch seit 2021 erhebt.
Es gebe zudem einen „Corona-Preisaufschlag“: Unternehmen und Dienstleister würden die Preise einerseits wegen Corona-Auflagen erhöhen, andererseits weil die Zahlungsbereitschaft der Endverbraucher gestiegen sei. Bei Urlauben oder Restaurant-Besuchen würde momentan nicht kleinlich auf Geld geschaut.
Zudem seien weltweit die Rohstoffpreise enorm gestiegen. Die Produzenten der Rohstoffe hätten in den Lockdowns ihre Produktion runtergefahren und seien und von der schnell angestiegenen Nachfrage überrascht worden. Es habe zudem Probleme in den Lieferketten gegeben, auch durch Wetterumschwünge.
„Die inflationssichere Anlage gibt es nicht“
Sparerinnen und Sparer könnten wenig tun, um sich gegen Inflation abzusichern. „Die inflationssichere Anlage gibt es nicht“, sagte Brzeski. Auch Gold, Immobilien oder Staatsanleihen seien nicht preisstabil. Er empfiehlt, Geld möglichst diversifiziert anzulegen. Man solle hingegen nicht versuchen, die Inflation durch riskante Anlagegeschäfte auszugleichen.
Es gebe auch keinen Grund zur Panik: „Eine Hyperinflation, wie wir sie vor 100 Jahren hatten, so eine Gefahr besteht aktuell und auch in den kommenden Jahren definitiv nicht.“ Für die kommenden zehn Jahre erwartet Brzeski allerdings, dass die Inflationsraten höher sind als sie es in den vergangenen zehn Jahren waren.
Das vollständige Interview im Wortlaut:
Carsten Brzeski: Guten Morgen, Herr Heinemann.
Christoph Heinemann: Herr Brzeski, warum steigen die Preise?
Carsten Brzeski: Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die das erklärt. Fangen wir mal an mit den Erzeugerpreisen, die Sie gerade genannt haben. Wir sehen, dass die Rohstoffpreise weltweit enorm gestiegen sind. Womit hat das zu tun? Das hat einerseits damit zu tun, dass die Anbieter von diesen Rohstoffen in den Lockdowns ihre Produktion nach unten gefahren haben und überrascht wurden, dass es jetzt so eine starke Nachfrage gibt, weil die Wirtschaft überall wieder anzieht.
Dann haben wir Lieferprobleme gehabt, etwa die Halbleiter aus Taiwan. Das waren Container-Probleme, wo die Container-Preise enorm nach oben gestiegen sind. Dann haben wir andere Wetterumschwünge gehabt, die auch dazu geführt haben, dass Lieferketten immer wieder unterbrochen wurden, Suezkanal, Ever Given. Das sind eine ganze Reihe von einmaligen Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass die Rohstoffpreise weltweit in der ganzen Breite vom Holzpreis bis zum Ölpreis enorm gestiegen sind.

Dann haben wir in Deutschland noch andere Probleme. Das ist die Mehrwertsteuer-Rückerhöhung seit Anfang diesen Jahres. Die spüren wir auch. Dann haben wir noch einen CO2-Aufschlag bekommen und zu guter Letzt sehen wir aktuell auch, nennen wir das mal, einen Corona-Preisaufschlag, dass Unternehmen, dass Dienstleister, die jetzt wieder auch ihre Dienstleistungen und Güter anbieten können, entweder irgendwelche Corona-Auflagen erfüllen müssen, oder auch einfach versuchen, höhere Preise zu fragen. Urlaub ist etwa so ein Beispiel. Das trifft auf eine gestiegene Nachfrage und damit sind wahrscheinlich die Endverbraucher auch aktuell bereit, jeden Preis, der gefragt wird, im Restaurant, in der Gaststätte zu zahlen. Damit sehen wir eine steigende Inflation.
„Leicht höhere Inflationsraten in den kommenden zehn Jahren“
Heinemann: Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den kommenden Monaten?
Brzeski: Kurzfristig geht das erst mal weiter nach oben. Das hat vor allem damit zu tun, dass sich die Mehrwertsteuer-Erhöhung in den Zahlen seit Juli erst richtig bemerkbar macht. Wir sehen auch, dass die Probleme bei den Lieferketten nicht so schnell gelöst werden. Ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass wir auch mal eine Vier vorm Komma sehen werden, dass wir in der zweiten Jahreshälfte irgendwo zwischen vier und fünf Prozent eine Inflationsrate in Deutschland sehen werden. 2022 wird es dann wieder ein bisschen zurückfallen, aber nicht auf dieses Niveau, was Sie auch eingangs gesagt haben, nicht das Niveau, bei dem wir dann wieder über eine Deflation reden, sondern wir werden uns schon darauf einstellen müssen, dass wir leicht höhere Inflationsraten in den kommenden zehn Jahren bekommen werden als in den letzten zehn Jahren.
„Größte Gefahr ist, dass wir in eine selbst verstärkende Spirale reingehen“
Heinemann: Ab welchem Prozentsatz wird Inflation zum Problem?
Brzeski: Das ist eine sehr gute Frage. Das beschäftigt natürlich die ganzen Notenbanker dieser Welt. Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank hat auch schon einiges dazu gesagt. Letztendlich müssen Notenbanker sich immer langfristige Trends anschauen. In Europa haben wir die neue Zielstellung zwei Prozent. Das war bis vor drei Wochen knapp unter zwei Prozent. Ist dann Inflation schon ein Problem? – Nein!
Und für jeden einzelnen fühlt sich Inflation auch anders an. Wir sehen aktuell, wenn wir uns die Benzinpreise anschauen, dass das die Endverbraucher trifft. Wenn dem gegenübersteht, dass Preise vielleicht für Telekommunikation weiter sinken, freut sich zwar die Europäische Zentralbank, aber das merken wir als Endverbraucher nicht so stark.
Zwei Prozent ist diese Zielstellung in Europa. Wenn die Inflationsrate teilweise darüber liegt, muss eine Notenbank nicht reagieren, aber sie muss immer besser aufpassen. Denn was ist aktuell die größte Gefahr? – Die größte Gefahr ist, dass wir in eine selbst verstärkende Spirale reingehen. Die haben wir noch nicht, aber Sie haben die Erzeugerpreise am Anfang erwähnt. Wir sehen auch, wenn man Produzenten fragt und Unternehmen fragt, die geben aktuell an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese gestiegenen Erzeugerpreise weitergeben an den Verbraucher, so hoch ist wie seit Anfang der 90er-Jahre, und damit kommen wir in eine leichte Spirale hinein.
„An der aktuellen Entwicklung kann die EZB wenig tun“
Heinemann: Herr Brzeski, Sie haben eben die Europäische Zentralbank erwähnt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die Aufkäufe von Staatsanleihen gemeint gewesen als ein Instrument gegen die Deflation. Ist das auch ein taugliches Mittel gegen Inflation? Sollte die EZB damit fortfahren?
Brzeski: Da streiten sich aktuell die Geister, nicht nur bei den Experten, auch innerhalb der Europäischen Zentralbank. Die Inflationsrate in Europa ist ein bisschen geringer als in Deutschland. In Europa werden wir uns um die drei Prozent in der zweiten Jahreshälfte bewegen, deutlich über EZB-Zielstellung. Dann kann man darüber diskutieren, dass so viele Staatsanleihenaufkäufe wie aktuell nicht mehr nötig sind. Die EZB sagt aber hingegen, ja, das sind alles Sonderfaktoren, die gehen 2022 wieder aus dem Garten raus, und mittelfristig erwartet die EZB immer noch eine Inflationsrate in der Eurozone von 1,4 Prozent im Jahr 2023, also immer noch viel zu niedrig. In der Logik der EZB muss sie dann weitermachen mit Staatsanleihenkäufen. Leute, die aktuell diese Inflationsraten sehen, würden sagen, vielleicht lieber doch ein bisschen weniger aufkaufen, vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, dass man irgendwann mal in die Normalisierung reingeht.
Man muss auch sagen, in der jetzigen Situation eine Zinserhöhung oder eine Notenbank, die wirklich auf die geldpolitische Bremse tritt, bringt überhaupt nichts, denn eine EZB kann nicht dafür sorgen, dass die Rohstoffpreise sinken. Eine EZB kann nicht dafür sorgen, dass wir diese Mehrwertsteuer-Rückführung nicht haben. An der aktuellen Entwicklung kann die EZB wenig tun. Nur sie muss darauf vorbereitet sein, dass sie nicht viel zu spät ist, sollte es zu einer Spirale von Inflation und auch Lohnerhöhungen kommen.
„Die inflationssichere Anlage gibt es nicht“
Heinemann: Wie können Bürgerinnen und Bürger ihr Geld schützen?
Brzeski: Aktuell ist schützen unheimlich schwierig. Ich kann hier eigentlich sehr wenig schützen, denn was wäre der Reflex, den ich machen müsste? – Ich müsste mehr sparen, da ich mir letztendlich weniger leisten kann, da die Preise für die Güter und Dienstleistungen weiter steigen.
Heinemann: Nur gibt es keine Zinsen für Sparerinnen und Sparer.
Brzeski: Genau. Ich habe keine Zinsen. Ich bin eher konfrontiert mit Negativzinsen. Die inflationssichere Anlage gibt es nicht. In der Vergangenheit haben wir immer gelernt, das könnten Staatsanleihen sein, das könnte Gold sein, das könnte Betongold sein, also Immobilien. Ich denke, dass wir spätestens seit der Finanzkrise gelernt haben, es gibt nicht diese preisstabile inflationssichere Anlage. Von daher kann man wirklich nur mit dieser abgedroschenen Weisheit kommen, das Geld, was ich habe, muss ich versuchen zu diversifizieren, und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, jetzt aber nicht irgendwelche Kurzschlusshandlungen und auf einmal anfangen, in irgendwelche riskanten Anlagengeschäfte hineinzugehen, nur weil man Angst hat vor der Inflation.
Denn wie Sie auch gesagt haben: Eine Hyperinflation, wie wir sie vor 100 Jahren hatten, wo man sich im Café lieber zwei Bier auf einmal bestellt hat, weil bei der zweiten Bestellung der Preis wieder viel höher sein würde, so eine Gefahr besteht aktuell und auch in den kommenden Jahren definitiv nicht.
Heinemann: Zumindest eine gute Nachricht für Biertrinker.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.