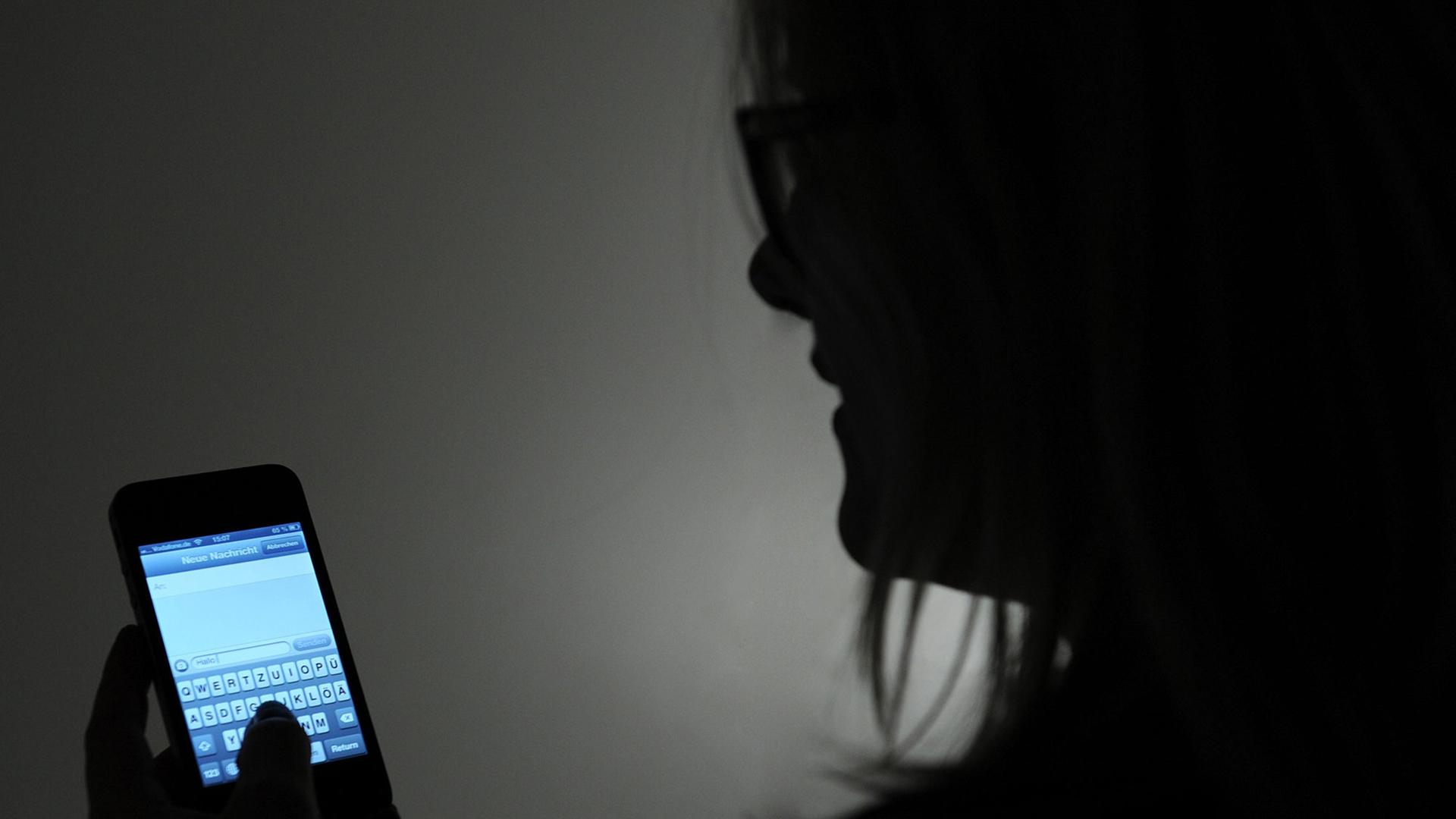Sandra Pfister: Gemeinheiten unter Schülern, die sind so alt wie die Schule selbst. Aber die sozialen Netzwerke wirken anscheinend wie ein Brandbeschleuniger. Wer früher in der Schule gedemütigt, geschubst, oder wessen Sachen zerstört wurden, konnte wenigstens zu Hause noch die Tür zu machen und sich bei seinen Eltern oder beim großen Bruder ausweinen und sich irgendwie geschützt fühlen.
Heute nehmen Schüler, die in sozialen Netzwerken gequält werden, ihr Folterinstrument quasi mit ins Bett – ihr Smartphone.
Es hört nie auf. Jeder achte Jugendliche wurde laut einer neuen Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing schon mal bei WhatsApp oder Instagram gemobbt. Wir reden mit dem Autor der Studie, mit Uwe Leest. Herr Leest, Mobbing gab es ja schon immer. Warum ist dieses Cybermobbing für Sie tendenziell schlimmer und gefährlicher als das in Anführungszeichen normale Mobbing?
Uwe Leest: Der Unterschied ist ganz schnell beschrieben, denn das Cybermobbing liegt in vielen Fällen anonym, das heißt, ich weiß gar nicht, wer mich mobbt. Das Zweite ist, nicht einer, zwei oder drei sehen, dass ich beleidigt, dass ich belästigt, dass ich diffamiert werde, sondern es können zehn, hundert oder auch Tausende seine. Und, was ganz wichtig ist, das Internet vergisst nicht, das ist ein weiterer Punkt, und das klassische Mobbing, das wir kennen, wenn ich auf dem Schulhof war und wurde gemobbt, dann bin ich nach Hause gegangen, und dann war sozusagen das Mobbing für mich beendet. Aber heute geht das Mobbing mit den Jugendlichen, nämlich bis unter die Bettdecke, denn sie werden sozusagen mit den mobilen Medien verfolgt.
Pfister: Vor vier Jahren haben Sie zum ersten Mal geschaut, wie sehr Schüler über soziale Netzwerke gemobbt werden. Was hat sich seither verändert?
Leest: Seit vier Jahren gibt es zwei Perspektiven, die sich verändert haben. Zum einen ist es so, dass Cybermobbing sich etwas verringert hat. Das ist die positive Nachricht, wenn man das so zusammenfasst. Die andere, die negative Nachricht ist, dass sich das Mobbing, das Cybermobbing intensiviert hat. Das heißt, wenn früher die Jugendlichen aus Spaß und aus Langeweile mal andere gemobbt haben, dann wird es heute ganz gezielt eingesetzt, um den anderen letztendlich fertig zu machen.
Pfister: Also es sind ganz andere Motive, die dahinter stecken?
Leest: Ja. Die Motivwelt hat sich vollkommen verändert. Und auch die Medien haben sich verändert. Wenn vor vier Jahren die Jugendlichen noch hauptsächlich über die sozialen Netzwerke gemobbt haben, dann hat sich das heute auf die Messengerdienste, die man kennt, WhatsApp und Snapshot [Anmerkung der Redaktion: gemeint ist der Messenger-Dienst Snapchat] oder auch Instagram, hat sich das in diese Welt verlagert.
Pfister: Das heißt, die Eltern, die immer noch bei Facebook sind, kriegen überhaupt nichts mit?
Leest: So ist es, ja. Das heißt, auch die Eltern sozusagen, wenn sie mit den Jugendlichen reden, dann stellen sie fest, dass die Jugendlichen sagen, Facebook, das ist ja von gestern. Und wenn die Eltern sozusagen nicht mitgehen mit der Zeit und mit der Veränderung der Kommunikationsmittel, also mit den Jugendlichen in diese medialen Welten begleitend mitgehen, dann verlieren sie die Kinder dabei.
"Es gibt keine Stoppschilder"
Pfister: Habe ich das richtig verstanden, wo wie Sie das gerader erklärt haben, dass jetzt inzwischen viel mehr Kinder und Jugendliche nicht mehr aus Spaß und Langeweile mobben, sondern um andere richtig fertigzumachen? Wie kommt das?
Leest: Die Motivlage hat sich verändert dadurch, so interpretieren wir das, dass natürlich die Jugendlichen kein Unrechtsbewusstsein entwickelt haben. Das heißt, es gibt keine Stopp-Schilder. Das heißt, es gibt, wenn ich etwas Kriminelles tue – und das sind kriminelle Handlungen, die da durchgeführt werden –, dann wird man nicht bestraft. Und wenn man lernt, mit dem Mechanismus, andere fertig zu machen, erfolgreich sein zu können, und das wird nicht sanktioniert, dann hat sich das aus dieser Welt, die ich vorhin beschrieben habe – es ist etwas weniger geworden, aber die, die Täter werden, tun es gezielter und intensiver.
Pfister: Wer könnte denn die Stopp-Schilder setzen?
Leest: Letztendlich wir alle in der Gesellschaft. Wir haben da verschiedene Perspektiven. Das eine sind die Eltern natürlich, die Stoppschilder setzen können, indem sie natürlich ihre Kinder, wenn sie das Smartphone in Anführungsstrichen als Waffe den Jugendlichen in die Hand geben, sie gleichzeitig aber auch damit umgehen lassen – ich beschreibe das immer so, wir müssen ihnen beibringen, wie man schwimmt oder wie man Fahrrad fährt, da lassen wir sie auch nicht allein. Und das bedeutet letztendlich, immer bei den Jugendlichen dabei zu sein. Das ist eine Präventionsmaßnahme der Eltern.
"Jugendlichen muss Sozialkompetenz vermittelt werden"
Pfister: Darf ich kurz einhaken. Die Kinder sind den Eltern ja weit voraus. Die Eltern sind ja meistens gar nicht so weit und können ihren Kindern das oft gar nicht beibringen.
Leest: Ja, und da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt: Man muss natürlich den Kindern dann schon, wenn sie mit vier, mit fünf, mit sechs mit diesen technischen Geräten ausgerüstet werden, dann muss man sie begleiten, darauf wollte ich gerade eingehen. Das eine sind die Eltern, das Zweite ist natürlich das schulische Umfeld, die Schule selbst, die den Jugendlichen dann – es wird ja heute in vielen Schulen das Smartphone, das Tablet, der Laptop, der PC ja als Unterrichtseinheit mit integriert. Das heißt, den Jugendlichen muss neben dem "Wie funktionieren diese Techniken" auch die Sozialkompetenz vermittelt werden, was und wie gehe ich im Internet mit anderen Menschen um.
Pfister: Und dann sprechen Sie ganz klassisch von Seminaren, von Lehrern, die auch extern in die Klassen kommen und den Jugendlichen das beibringen.
Leest: Die Studie zeigt ganz deutlich, dass die Lehrer an sich mit diesem Themenfeld überfordert sind. Das heißt, sie stehen so vor einem Berg, und das sind über 50 Prozent, also jeder zweite Lehrer hat das gesagt. Und da ist es ganz wichtig zum einen, dass man die Lehrer befähigt, sozusagen diesen Berg abzubauen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, das ist eine temporäre Größe, dass man von außen Hilfsangebote wie zum Beispiel das Bündnis gegen Cybermobbing Berater und Referenten zur Verfügung stellt, um dort sozusagen diese Brücke zu schließen.
Pfister: Uwe Leest vom Bündnis gegen Cybermobbing zu einer neuen Studie, nach der Schüler sich in sozialen Netzwerken zwar etwas weniger mobben als vorher, dafür aber viel härter und erbarmungsloser.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.