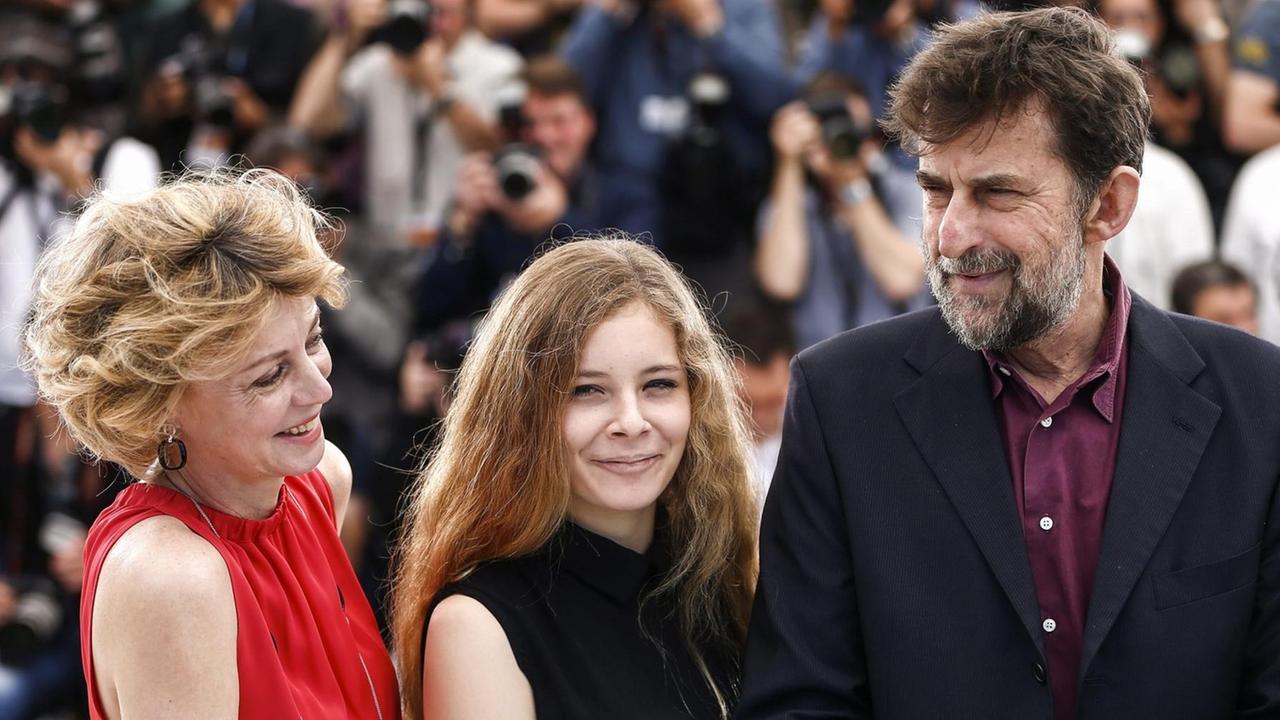Halbzeit in Cannes. Obwohl gerade erst alles begonnen hat. So kommt es mir jedenfalls vor. Aber zehn von 19 Wettbewerbsfilmen sind der Presse schon gezeigt worden. Als Favorit für die Goldene Palme gilt bisher Todd Haynes lesbische Liebesromanze "Carol" nach Patricia Highsmiths Roman "The Price of Salt" aus den 1950er-Jahren. An zweiter Stelle steht bei den zehn internationalen Filmkritikern des britischen Branchenblattes "Screen" der KZ-Film "Son of Saul" des Ungarn László Nemes, dicht gefolgt von Nanni Morettis Frauenfilm "Mia Madre" und dem Schwesternfilm "Our Little Sister" des Japaners Kore-Eda Hirokazu.
"Carol" ist überbewertet, finde ich. Ein besonders schöner, aber null innovativer Film. Bewertet haben die "Screen"-Kritiker-Jury aber noch nicht die beiden Filme, die gestern Abend und heute Morgen liefen: "Louder than Bombs" von Joachim Trier aus Norwegen und "La Loi du Marché" des Franzosen Stéphane Brizé. Die beiden könnten die Reihe der Tabellenführer noch einmal kräftig aufmischen, jedenfalls, wenn man ihre besondere Machart würdigen würde.
Denn Joachim Triers "Louder than Bombs" ist der erste Wettbewerbsbeitrag, der künstlerisch etwas wagt. Endlich einmal eine nicht chronologisch brav heruntererzählte Geschichte, sondern eine, die sprunghaft die Zeiten eines Familienlebens durchstreift und die Stimmen der Figuren, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen und Gespräche und Träume, dazu Kurzgeschichten, Fotos, Filme, Computerspiele und Zeitungsartikel wild assoziiert und zu einer Seelen-Collage komponiert. Das hat Tempo, Rhythmus und Schwung. Das gebündelte Gefühlswirrwarr einer Familie, in der die Mutter – eine berühmte Kriegsfotografin (gespielt von Isabel Hupert) – bei einem Autounfall ums Leben kommt. Der jüngere, pubertierende Sohn droht dem Vater, einem Lehrer, zu entgleiten. Der ältere Sohn ist gerade Vater geworden. Die junge Ehe kriselt schon jetzt. Alles droht zu kollabieren und findet filmisch und psychologisch letztlich doch wieder zusammen. Ein kleines Meisterstück kinematografischer Erzählkunst. Joachim Trier macht seinem dänischen Regisseurs-Verwandten Lars von Trier alle Ehre.
Minimalistisch dagegen die französische Sozialstudie "La Loi du Marché" (Das Gesetz des Marktes) von Stéphane Brizé. Brizé zeigt, wie ein Industriearbeiter den Job verliert, wie er versucht, sich in den Programmen der staatlichen Berufsförderung fit für den Arbeitsmarkt zu machen und schließlich Kaufhausdetektiv wird. Effektivität, Flexibilität, Unterordnung und permanenter Leistungscheck sind die Kategorien, denen sich der 51-jährige Thierry ständig unterwirft, klaglos, stumm, bis er am Schluss entschieden reagiert. Der Film beobachtet in langen Sequenzen sehr genau das aufmerksame und von einem harten Arbeitsleben gezeichnete Gesicht Thierrys. Vincent Lindon ist die Rolle wie auf den Leib geschnitten. So kalt Brizé seine Hauptfigur beobachtet, so entschieden steht er auf ihrer Seite und erzählt die Geschichte einzig aus ihrem Blick. Auch diese dramaturgische Konsequenz macht diesem Film so stark. Die Ursachen für die Krise der Wirtschaft und für den ökonomischen Stillstand des Landes interessieren den Regisseur nicht. Wie manche französischen Filme beim Festival von Cannes zeigt auch "La Loi du Marché" von Stéphane Brizé eine verletztes und gelähmt wirkendes Land, das sich zu einer politischen Agenda à la française nicht durchringen kann.