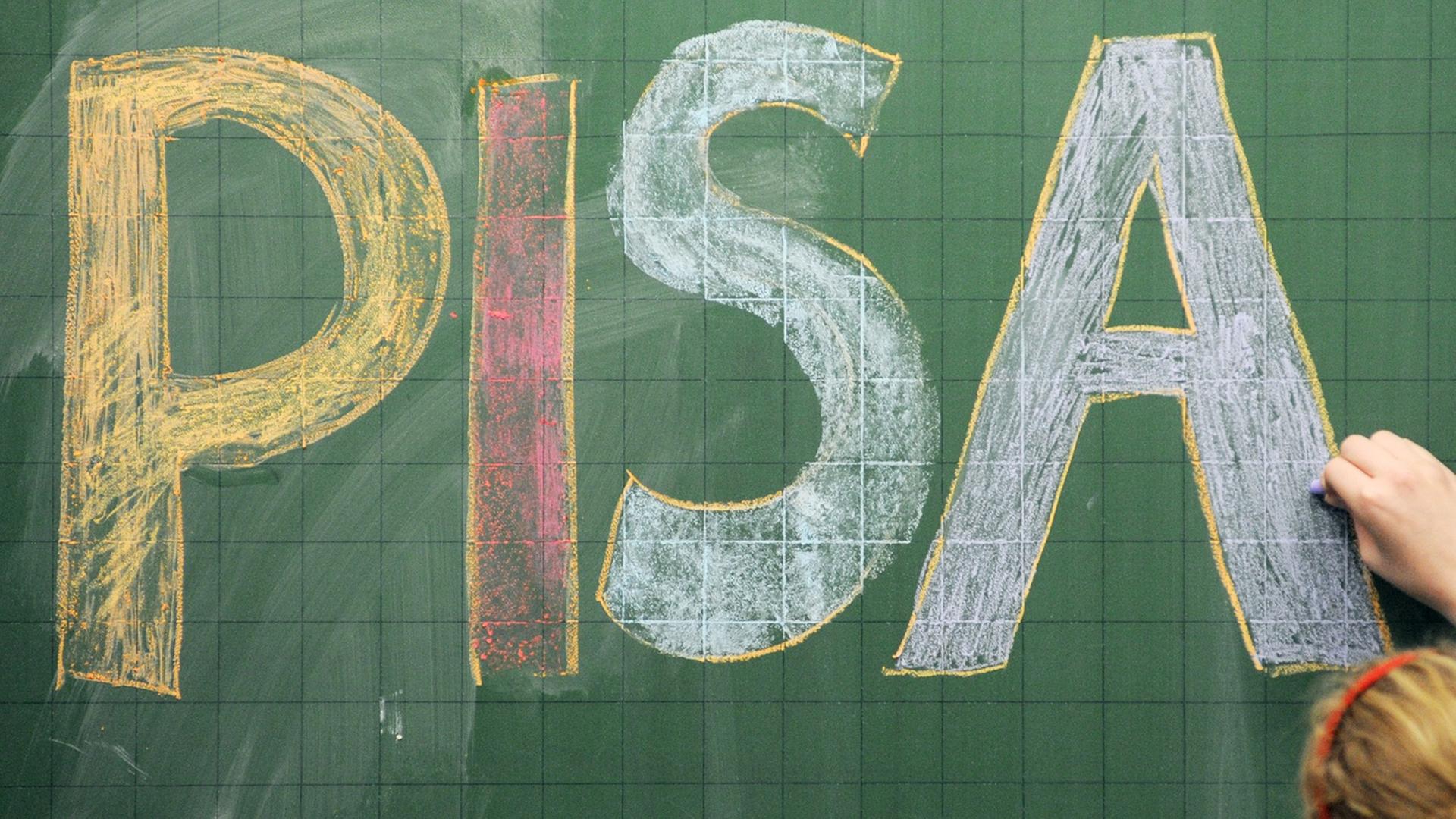Der Haussegen hing mächtig schief – in Dortmund oder Paris ebenso wie in Eisenhüttenstadt: Wann endlich ließ sich der 17jährige Sohn die langen Haare schneiden? Und wann drehte seine Schwester die furchtbare Krach-Musik leiser? Die neue Musik und junge Kultur der 50er und 60er Jahre – sie waren bei Jugendlichen auf der ganzen Welt eingeschlagen; aber diese Jugendlichen sahen sich zugleich konfrontiert mit Anforderungen der Erwachsenen, denen sie nicht so leicht ausweichen konnten: Am ersten Tag der Lehre mußten die langen Haare eben doch fallen. Es waren ganze Konstruktionen von Anforderungen, sagt Dr. Michael Esch von der Universität Leipzig, der Leiter der Tagung.
„Diese Konstruktionen gibt es in Ost wie in West. Eben deswegen, weil Jugend erst mal als ein eigenes Phänomen gesehen wird, das eben die Zukunft von Gesellschaft bedeutet und deswegen besonderer Betreuung bedarf. Das heißt, sie ist auf der einen Seite bedroht. Da sie sich aber eben nicht so verhält, wie die Pädagogen das gerne hätten, ist sie auch bedrohlich! Das heißt, sie muss nicht nur geschützt werden, sie muss auch kontrolliert werden. Und diese Dichotomie, die findet man in West wie in Ost.“
Solche Parallelen waren Thema der Diskussionen in Leipzig. Die Vorträge selbst legten dazu den Grund: etwa in Einzelstudien über Jugendkultur in der UdSSR, über Jugendmedien in Westeuropa oder über Punk und Heavy Metal in der DDR. Warum zum Beispiel eckten Heavy-Metal-Fans am Arbeitsplatz nicht entfernt so sehr an wie Punks? Nikolai Okunev von der Berliner Humboldt-Universität erklärt.
„Das hat unter anderem damit zu tun, viele von diesen Heavys, die waren eben Lehrlinge, und die brauchten schlicht das Geld. Ich glaub, Heavy-Sein war wesentlich teurer als Punk-Sein, weil die Musik und der persönliche Besitz der Musik ‚ne größere Rolle spielt, das heißt, der Verlust der Lehrstelle war ein Problem für viele Heavys – und in den Stasi-Akten finden sich sogar ganz explizite Aussagen von Heavys, die sagen: Wir mögen die Musik, aber mit so Asis wie Punks, die nicht zur Arbeit gehen, wollen wir nichts zu tun haben,“
Die Punkszene gehört zu den am besten erforschten Bereichen der DDR-Jugendkultur. Florian Lipp von der Universität Hamburg allerdings erläuterte Trends, die durch den Eisernen Vorhang hindurch wirkten.
„Die Eskalation der Verfolgungswelle gegen die Punks in der DDR 1983 in einem zeitlichen Kontext steht zu Entscheidungen, die in der Sowjetunion gefallen sind, die einen repressiven Charakter haben, und zum anderen aber wenige Wochen nach den ersten großen ‚Chaos-Tagen‘ in Hannover stattfinden – wo man jetzt darüber spekulieren könnte, dass die Machthaber in der DDR eben gesagt haben: So weit wollen wir das hier gar nicht kommen lassen – und was für die DDR selbst wieder ne ganz wichtige Rolle spielt, dass das genau diese Zeit ist, in der Punkbands vermehrt in Kirchen auftraten,“
Der neue kulturwissenschaftliche Blick wird also differenziertere, weniger simple Bilder zeichnen. Das meiste Material dürfte dabei noch unentdeckt in den Archiven schlummern. Prof. Klaus Weinhauer von der Universität Bielefeld erinnerte freilich an das unentbehrliche Handwerkszeug: solide Quellenkritik.
„Das Plädoyer würde auch in diesem Fall sein wie für jede geschichtswissenschaftliche Arbeit: Eine präzise Fragestellung zu entwickeln, die Aussagekraft der Quellen kritisch zu reflektieren und sich darüber klar zu werden, dass auch diese Quellen – selbst wenn sie kritisch reflektiert sind – nicht die Wirklichkeit wiedergeben, sondern Narrative – wenn zum Beispiel die Stasi ein Protokoll über das Konzert einer Band anfertigt, dann kann man das als Protokoll über den Auftritt einer Band lesen, man kann es aber auch lesen als die Wahrnehmung der Stasi.“
Für einen kritischen Umgang mit Quellen und Zeitzeugenaussagen plädierte etwa Tagungsorganisator Michael Esch: Das Klischee von den unbeugsamen Künstlern, die 40 Jahre vom Staat terrorisiert worden seien, sei auch der Fall einer Selbststilisierung – wie sie unter Popmusikern überall vorkomme. Dem gehe die Forschung nur zu gern auf den Leim. Dr. Rüdiger Ritter von der Universität Bremen stellte heraus, dass es regelrechte Verhandlungen gegeben habe: zwischen Musikern und Staat. Das Plenum des sowjetischen Komponistenverbandes 1962 sei nur ein Beispiel.
„Wenn man jetzt in die Archive geht, stellt man fest – gerade in der Musik kann man das sehen, beim Jazz oder beim Rock – dieselben Musiker sitzen in offiziellen Gremien, die auch die Bands spielen. Wir können nicht mehr so ein eindeutiges Bild zeichnen zwischen den bösen Unterdrückern und dem freiheitsliebenden Volk, sondern wir müssen tatsächlich uns angucken: Wer ist beteiligt, welche Fronten gibt es überhaupt, wie gruppieren die sich jeweils neu,“
Auf dieser Basis könne man sogar besser erhellen, wie das staatssozialistische System an sich funktioniert habe.
„Wir lernen eigentlich, warum es dazu kommt, dass man so eine seltsame Willkürherrschaft da hat! Das ist das, was die Vertreter dieses ‚Wir'-und-'Sie‘-Modells nie begreifen. Die stellen dann fest: Irgendwelche Sachen waren ja doch möglich, und dann denkt man, das liegt an Schwäche der Repressionsorgane. Das stimmt aber nicht! Das liegt einfach daran, dass die Aushandlungsprozesse da möglich gewesen sind.“
Umgekehrt sah sich auch der Westen auf der Leipziger Tagung der Kritik ausgesetzt: Konrad Sziedat von der LMU München zeigte, wie die bundesdeutsche Linke in ihren Solidaritätsaktionen für die polnische Solidarnosc deren tiefe Verwurzelung im Katholizismus ausblendete. Und Christian Werkmeister von der Universität Jena erinnerte daran, dass es Einschränkung der Medienfreiheit nicht nur im Osten gab.
„Das ist dann ein Problem, dass es durchaus für den gesellschaftlichen Zusammenhang notwendige Funktionen einer Zensur gibt – wie ich auch kurz erwähnt hatte mit der Freiwilligen Selbstkontrolle, mit Verboten von Pornografie oder Gewaltdarstellungen –, die wir heute auch noch als ganz natürlich annehmen, die allerdings jetzt gerade im Rahmen der Ost-West-Konfrontation im Kalten Krieg benutzt wurden, um den politischen Gegner zu de-legitimieren.“
Die Parteien im Kalten Krieg legten also jeweils zweierlei Maß an. Nicht zur Sprache kam in Leipzig freilich der unterschiedliche Grad demokratischer Legitimation der Staaten in Ost und West. Aber auch wenn man den im Blick behält, kann man Parallelen ausmachen. Unzufrieden mit dem Leben in der der modernen Welt waren nach 1950 nämlich viele hüben wie drüben. Michael Esch.
„Nur: Die Vermutung oder eher die ideologische Konstruktion, dass es kategoriale Unterschiede zwischen Ost und West gegeben habe – nämlich: Der Westen ist gut und der Osten ist böse – verstellt den Blick genau darauf! Dass es eigentlich unterhalb eines lautstarken politischen Konfliktes sich um moderne sich industrialisierende oder industrielle Gesellschaften handelt mit Entfremdungsproblemen, mit Ausbeutungsproblemen auf jeweils unterschiedliche Weise, auf die bestimmte, besonders sensibilisierte Personengruppen in sehr ähnlicher Weise reagieren.“
Die transnationale Perspektive, die über einen bloßen Vergleich hinausgeht und internationale Trends beschreibt – sie könnte also weitere Impulse geben, wenn es um Erforschung von Jugendkultur geht. Die Leipziger Konferenz machte plausibel, dass man sich mit diesem Ansatz dem Untersuchungsgegenstand adäquat weiter nähern kann. Denn international verbunden waren Jugendliche und Subkulturen schon in einer Zeit, als noch niemand etwas von Facebook und Whatsapp ahnte.