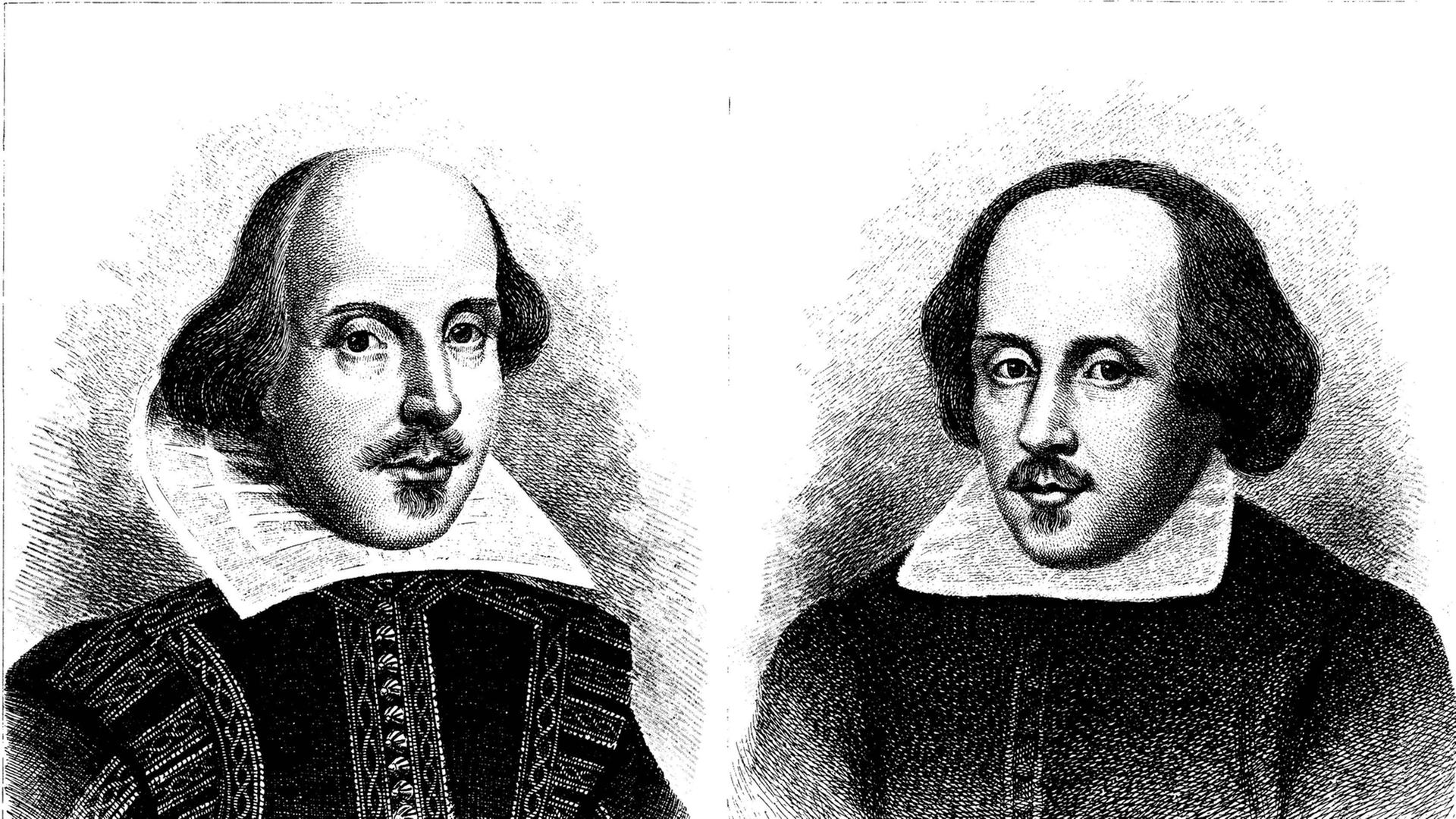„Das mag ich an Shakespeare: Er lässt einem Regisseur eine unglaubliche Freiheit. Man kann unglaublich viel assoziieren und fantasieren dazu, zu diesen enormen Texten und zu diesem Bretterspiel, was er einem anbietet“,
sagt Karin Henkel, durchaus stellvertretend für viele deutsche Theatermacher. In ihrer letzten Shakespeare-Inszenierung – dem „Macbeth“, nach wie vor auf dem Spielplan der Münchner Kammerspiele – macht sie ausgiebig Gebrauch von diesem Freiraum, den Shakespeare bietet: Fünf Darsteller wechseln sich darin nicht nur ab in sämtlichen Rollen, sondern auch hin und her zwischen moralischen Standpunkten, Geschlechteridentitäten und Sprachen.
„Schlecht ist recht und recht ist schlecht“ – Karin Henkel nimmt Shakespeare beim Wort. Konsequent formt sie aus seinen Tragödienhelden Kippfiguren, permanent oszillierend zwischen Gut und Böse. Noch radikaler hat das vor ihr Jürgen Gosch mit seinem legendären Düsseldorfer „Macbeth“ 2005 durchexerziert – mit einem rein männlichen Ensemble: sieben, über weite Strecken der Aufführung nackte Männer, die auf fast leerer Bühne mit Blut und Kot herumsudelten.
Verstörender als Jürgen Gosch erzählte wohl kaum einer im deutschen Theater von der rohen Natur des Menschen. Gosch nahm sich maximale Freiheit im Umgang mit Shakespeares Tragödie und drang gerade damit zum Kern des Stoffes vor. Freiheit ist eben nicht zu verwechseln mit einem anything goes. Karin Beier jedenfalls, Intendantin am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und Shakespeare-Liebhaberin seit Beginn ihrer Regiekarriere, warnt vor Beliebigkeit:
„Es ist ja grundsätzlich im deutschen Theater so, dass man sehr klar sein muss in formalen Entscheidungen, das finde ich bei Shakespeare extrem wichtig. Bei Shakespeare kommt aber wirklich noch dazu: Man muss sich sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, warum man welches Stück erzählt. Vom Blatt, würde ich sagen, spielt sich da gar nichts.“
Philosophische Groteske
Die klare Entscheidung, die Beier bei ihrem Kölner „König Lear“ vor einigen Jahren traf: Sie besetzte sämtliche Rollen mit Frauen und schuf so eine Art weibliches Pendant zu Jürgen Goschs Männer-„Macbeth“.
„Das hatte was damit zu tun, dass ich den Lear als eines der brutalsten und trostlosesten Stücke von Shakespeare empfinde. Dieses Wasteland, was am Ende übrig bleibt, da gibt es keinen Blick auf die Zukunft. Am Ende von Macbeth wird Malcolm gekrönt und da entsteht etwas Neues. Das ist bei Lear nicht der Fall. Der Götterhimmel ist leer gefegt, die Menschenwelt ist leer gefegt, das ist sehr, sehr, sehr trostlos! Ich finde das ein sehr brutales Stück, ich finde den Umgang der Menschen da untereinander unglaublich brutal. Und ich wollte – das war an Jan Kott angelehnt: philosophische Groteske, so was – das war der Versuch, eine Art Groteske zu entwickeln. Groteske im Sinne, dass da das Absolute fehlt. Und ich wollte das verschärfen. Verschärfen, weil man doch mit der Frau gewisse Form von Brutalitäten, auch sexuell aufgeladene Brutalitäten nicht so verbindet. Und dass man das als unangenehmer empfindet, wenn man es mit einem Frauenensemble erzählt.“
Shakespeare heute zu inszenieren bedeutet immer auch: zuzuspitzen, auszuwählen aus einer Vielfalt möglicher Themen, die die meisten seiner Stücke bieten. Am Wiener Burgtheater hat Andrea Breth kürzlich den „Hamlet“ inszeniert, ungekürzt. Breth wollte Alles erzählen, statt zu fokussieren, verzettelte sich und erzählte am Ende: nichts.
Dass sich Shakespeare für die Gegenwart zu erobern auch bedeuten kann, ihn sprachlich neu anzupacken, führte Luk Perceval an den Münchner Kammerspielen vor gut zehn Jahren vor.
Jede Epoche wird bei Shakespeare fündig
Perceval ließ den „Othello“ von Feridun Zaimoglu, dem Erfinder der Kanaksprak, in eine beinahe schmerzhafte Vulgärsprache übertragen. Der zotige Slang, mit dem insbesondere Fähnrich Jago seine Intrige spann, um die Eifersucht seines Generals Othello zu entfachen, erzählte Bände vom moralischen Verfall einer im Krieg verwahrlosten Gesellschaft. Gewährsmann für solche zupackenden Vergegenwärtigungen ist der bereits erwähnte polnische Theatertheoretiker Jan Kott, der in einem epochemachenden Buch 1970 Shakespeare zu unserem Zeitgenossen erklärte:
„Jede Epoche findet das bei ihm, wonach sie selbst sucht und was sie selber sehen will.“
Kotts Thesen dienten über die Jahre leider auch als Rechtfertigung vieler oberflächlicher Aktualisierungen. Da wurden Shakespeares Figuren in Anzüge oder Militärgrün gesteckt, als stellte das allein schon seine Zeitgenossenschaft unter Beweis. Inszenierungen wie beispielsweise Luk Percevals „Othello“ heben sich deutlich von solchen Verkürzungen, ja Kurzschlüssen ab. Die brutale Sprache, die Feridun Zaimoglu den Figuren in den Mund legte, wirkte nicht nur modern, sondern in ihrer Brachialität zugleich archaisch. Das ist vielleicht das Geheimnis aller gelungenen Shakespeare-Inszenierungen: Dass sie in seinen Stücken das uns Vertraute aufspüren, ihnen aber auch die Fremdheit lassen. Oder, wie Karin Beier es formuliert:
„Wenn Shakespeare etwas in Blau schreibt und danach in Rot, dann sollte man nicht von Blau über Lila zu Rot gehen. Da würde man was kaputt machen. Da ist genau diese harte Setzung, Blau und Rot krass nebeneinander, das Tolle. Das heißt, man hat auf der einen Seite etwas, was einem vertraut ist, und auf der Seite was sehr Archaisches. Das ist für einen Regisseur toll. Denn ich finde, das hat eine ganz große Realität, Dinge nicht bis zum letzten Blutstropfen begreifen zu können.“