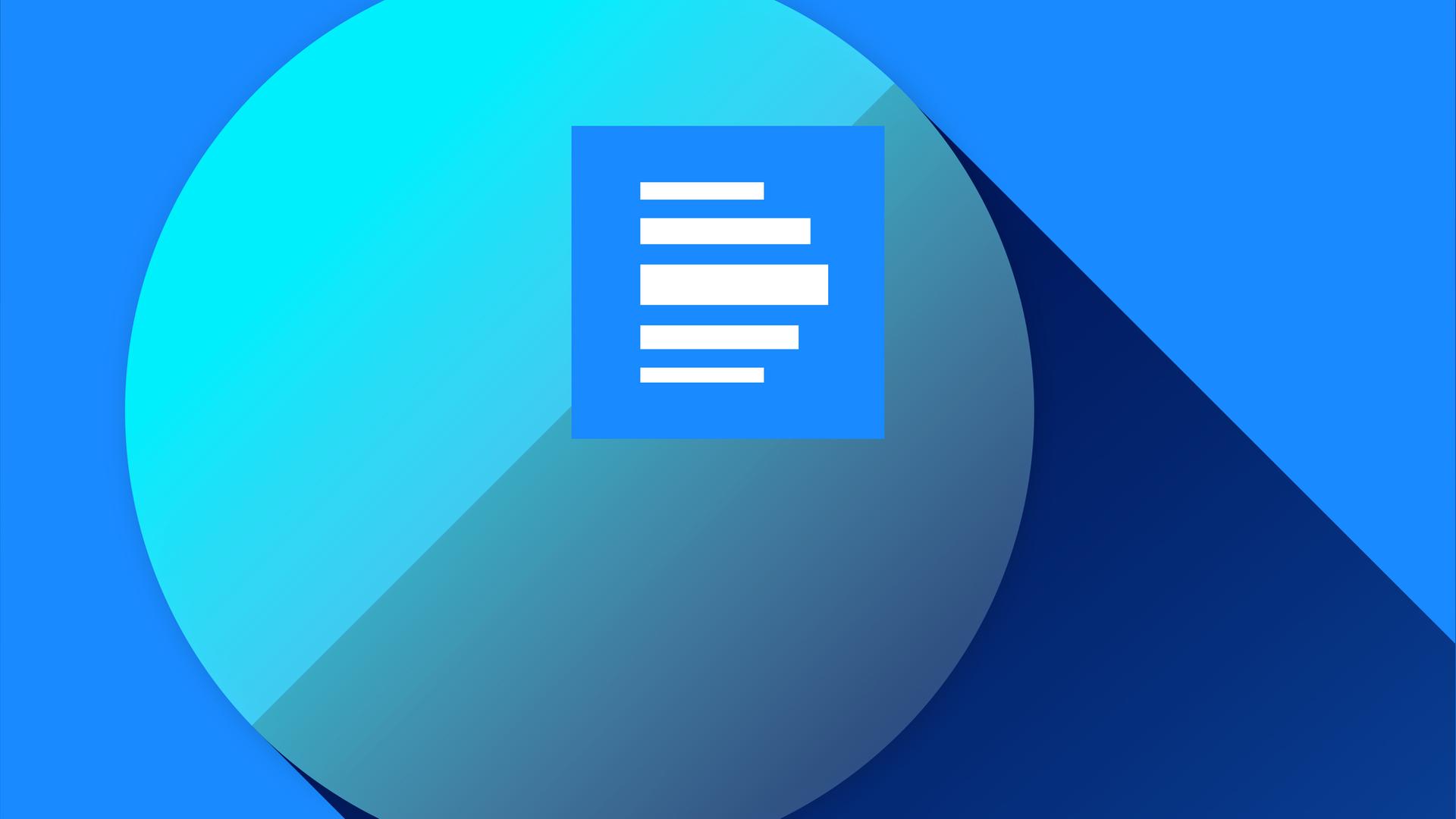Menschen schreien. Jubel. Endlich werden die Leute sich ausruhen können. Endlich können die Seelen schlafen. Selbst die Luft wird besser werden. Endlich wird etwas Neues geschehen!
Die junge Frau, die hier aufspringt und durch den Raum tanzt, ist die burkinabeische Schauspielerin Safourata Kabouré. Soeben hat sie die Nachricht erhalten, dass der Präsident Blaise Compaoré zurückgetreten ist unter dem Druck der Straße – nach 27 Jahren Diktatur. Vier Tage lang ist sie wegen der politischen Unruhen nicht nach Hause ans andere Ende der Stadt gefahren, hat im Bühnenbild geschlafen – in zwei der 14 Produktionen steht sie in dem prächtig geschmückten Festivalviertel der „Récréâtrales“ auf der Bühne, ist in „Sindii“ eine Frau, die Sex vor der Ehe hat und gesteinigt wird und in „Der Geruch der Bäume“ die Schwester eines Auswanderers von Afrika nach Europa.
Ausnahmezustand in Burkina Faso
Vier Kilometer nur ist das Theaterviertel vom Zentrum entfernt, dort wo am Donnerstag die Nationalversammlung brannte. Von hier aus sah man von weitem den Rauch aufsteigen, hörte die Demonstranten vorbeiziehen, roch das Tränengas. In ganz Burkina Faso herrschte Ausnahmezustand, am Abend wird eine Ausgangssperre verhängt, alle Grenzen sind geschlossen, kein Flug geht mehr. Banken, Hotels und das Haus des Präsidentenbruders werden geplündert – alles im Besitz der alten Machtelite.
Und auch das Festival fällt für einen Tag lang aus. Doch die Künstler sind stolz über den ersten echten Volksaufstand in Westafrika, wie elektrisiert. Es gibt wohl heute kaum jemanden, der glücklicher ist als die Schauspielerin Odile Sankara, Schwester des Nationalhelden Thomas Sankara, der vor 27 Jahren vom nun Ex-Präsidenten Compaoré vermutlich ermordet wurde. Sie war damals 15. Für sie, sagt sie, sei nun endlich der Geist ihres Bruders wieder auferstanden: „Ich hoffe, dass man nun endlich die Korruption beendet, alle Güter zurückbringt, die das Regime gestohlen hat und sie in die Allgemeinheit fließen lässt, dass die Leute endlich essen können, wie sie Hunger haben, dass man ihre Wunden heilt, dass sie ihre Kinder zur Schule bringen können.
Ziviler Ungehorsam
Schon am nächsten Tag ignoriert das Festival die Ausgangssperre und nimmt seinen Betrieb wieder auf – auch ein Akt des zivilen Ungehorsams. Da hilft es, dass die acht Bühnen die Innenhöfe der im Viertel ansässigen Familien sind. Selbst am Donnerstag, als die bunt geschmückten Straßen des Festivals wie verwaist dalagen, grillten noch einige Dorfbewohner Fleischspieße und frittierten Bananen. Die vorbeipatrouillierenden Militärs schnorrten allenfalls ein paar Zigaretten – vom Festivalleiter Etienne Minoungou. Der hat zwei Nächte lang nicht geschlafen, weil er stets zwischen Festival und Place de la Nation, wo die Menschen auf der Straße tanzen, hin- und hereilen wollte: „Das Festivalmotto lautet Reiche die Hand der Zukunft, auf dass sie nicht zittere, sondern lächele. Die Stücke, die wir zeigen, scheinen die Zukunft vorauszusehen. Der Diktator, der jetzt gestürzt ist, ist vorher schon längst auf der Bühne gefallen. Es ist, als hätten die Künstler dies alles vorhergesagt.“
Es ist faszinierend, wie in diesen Festivaltagen Politik und Theater zusammenfließen. Es scheint, als seien die Künstler mit ihren Stücken die Vorhut der Revolution. Im Stück „Weiße Nacht von Ouagadougou“ etwa von Serge Coulibaly steht der mittlerweile auch international bekannte burkinabeische Rapper Smockey auf der Bühne und fordert in einer Mischung aus Kunst und Agitprop direkt dazu auf, die Regierung zu stürzen – und endlich den Mord an Thomas Sankara aufzuklären. Dazu tanzen zwei Tänzer den harten Alltag in Ouagadougou, die Arbeit in den Minen, die Suche nach etwas Geld nach. Kurz bevor die Proben zum Stück begangen, ging der Rapper Smockey selbst in die Politik: er führt die Oppositionspartei „Société Civile“ an und verhandelt zwischen den Aufführungen mit dem Militär.
Scheindemokratien afrikanischer Despoten
Auch „La malice des Hommes“, die „Bosheit der Menschen oder die letzten Tage eines Diktators“, vom Altmeister des afrikanischen Theaters Jean-Pierre Guingané vor sieben Jahren geschrieben, wirkt wie eine direkte Aufforderung zur Revolution und behandelt die Scheindemokratien der afrikanischen Despoten. In der grotesken Satire von Regisseur Paul Zoungrana ist der Diktator ein kleinwüchsiger junger Mann, eine Mischung zwischen Greis und Kind. Er lümmelt sich auf dem Thron, fasst doppelt so großen Frauen in den Schritt, pustet Seifenblasen in die Luft, die seine Untertanen mit großmaschigen Netzen vergeblich aufzufangen versuchen. Zwischendurch formiert sich das Ensemble zu einem kommentierenden Klagegesang, der Brecht alle Ehre machen würde.
Und selbst die deutsch-afrikanische Koproduktion von Theater im Bauturm, der Compagnie Falinga und den Récréâtrales, „Coltan-Fieber“, wirkt wie ein Reflex auf die Revolution. „Coltan-Fieber“ ist ein Stück über den Rohstoff, der in allen Handys steckt und im Kongo für blutige Bürgerkriege, Kinderarbeit und Massenmorde verantwortlich ist. Auf der Bühne wird die wahre Geschichte des Schauspielers Yves Ndagano erzählt, mit Hilfe einer rührenden Holzpuppe. Ndagano steht auch selbst mit auf der Bühne. Mit elf Jahren wurde Yves von Rebellen entführt und zum Kindersoldaten gemacht. Als er mit Hilfe einer NGO befreit wurde, musste er in einer Coltan-Mine arbeiten, für zwei Dollar pro Monat. Da entschloss er sich, Schauspieler zu werden. Der deutsche Regisseur Jan-Christian Gockel lässt in „Coltan-Fieber“ Weiße Schwarze spielen, ehemalige Kolonialmächte spielen ehemalig Kolonisierte. Es ist eine elegante Art, deutschen Blackfacing-Debatten zu entgehen, doppelbödig werden so Opfer- und Täterklischees auf den Kopf. Denn Hautfarbe ist nur eine Zuschreibung, ob man im Kriegsgebiet oder Konsumparadies geboren wurde, reiner Zufall. Das Publikum danach ist begeistert. Eine Zuschauerin: „Das zeigt die Realität von Afrika. Dieser Kinderarbeit auch hier in Burkina Faso muss endlich ein Ende gemacht werden. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance dazu.“
Theater spielt eine ganz besondere Rolle
Und so spielt das Theater in diesen intensiven Revolutionstagen in Ouagadougou eine ganz besondere Rolle. Plünderungen? Gefahr? Von Europa aus erhält man besorgte Anrufe, manch einer der zahlreichen europäischen Besucher kann seinen Rückflug nicht antreten. Doch in Ouaga selbst hat man keinen Augenblick das Gefühl, hier würde etwas entgleiten: die Plünderungen sind gezielt, schon zwei Tage später fegen die Plünderer selbst die Straßen wieder sauber.