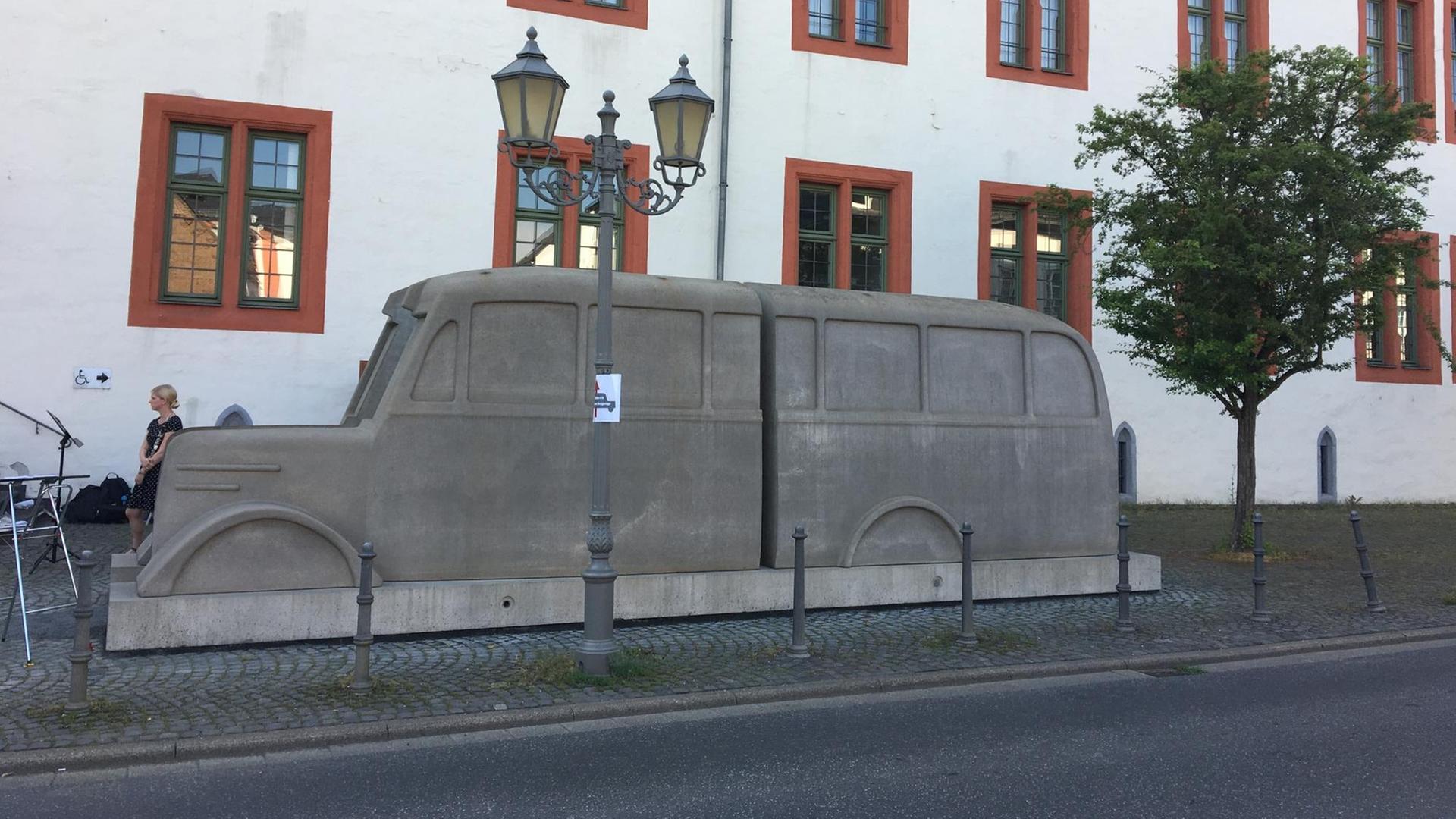Es dauert ein wenig, bis Helmut von der Bey an der richtigen Stelle ist. Eine Ausstellungstafel, darauf die Schwarz-Weiß-Fotografie einer jungen kräftigen Frau, Arme verschränkt, runder Rücken, freundlicher Blick in die Kamera. Bilder wie dieses haben ihn gleich bei seinem ersten Besuch in der Gedenkstätte Hadamar angesprochen. Ungefähr sieben Jahre ist das jetzt her:
"Ich denke, es waren die jüngeren Menschen, weil es bei meinem Bruder ja ähnlich gelagert war."
Seine Geschichte und die seiner Familie drängt von der Bey niemandem auf, deshalb sagt er Dinge wie "ähnlich gelagert". Fragt jemand nach, erzählt der 72-Jährige vom ältesten Bruder Fritz:
"Er ist mit elf Jahren hier nach Hadamar gekommen. Ist als Neunjähriger in eine kirchliche Heil- und Pflegeanstalt gekommen in Mönchengladbach, wurde dann im Mai 1943 nach Scheuern verlegt als Zwischenstation, ist dann am 3. November nach Hadamar transportiert worden, und am 4. November war sein Todestag. Also man kann davon ausgehen, dass damals sehr schnell mit Medikamenten gehandelt wurde und er dann auch relativ schnell umgebracht wurde."
Der tote Bruder "kam in meiner Familie nicht vor"
Fritz und Helmut haben sich nie kennengelernt. Der eine ermordet 1943, der andere geboren 1945. Fritz hatte einen Geburtsschaden, für die Nazis war er deshalb "lebensunwert". So wie mehr als 200.000 andere Kinder und Erwachsene, die zwischen 1939 und 1945 Opfer der NS-Patientenmorde wurden. Helmut hat erst spät erfahren, dass sein Bruder nicht an einer Lungenentzündung im Kinderheim gestorben ist, wie in der Familie kolportiert. Die Mutter, die älteren Schwestern redeten kaum vom Erstgeborenen.
"Ich kannte ihn nicht, er kam in meiner Familie nicht vor."

Ein sogenannter "Trostbrief", den die Nazis standardmäßig an Familienangehörige schickten und den Helmut von der Bey zufällig fand, gab, wenn auch erst Jahre später, den Anstoß nachzuforschen. Er, der jüngste der Geschwister, machte sich schließlich auf den Weg in die Gedenkstätte Hadamar nahe dem hessischen Limburg, sah die Patientenakte von Fritz ein:
"Als ich zum ersten Mal hier saß und mir die Unterlagen anschaute - Briefe meines Vaters, der sich erkundigt hat, wie es sein könnte, dass sein Sohn einen Tag nach der Verlegung gestorben ist und um Aufklärung bat. Da wurde mir erst einmal klar, dass hier ein elfjähriger Junge zum zweiten Mal gestorben ist, als man die Erinnerung an ihn ausgelöscht hat, und das war mir wichtig. Mir war wichtig, ihm wieder seine Existenz zu geben und auch innerhalb der Familie ihn irgendwie zu integrieren."
"Euthanasie"-Morde lange unter den Teppich gekehrt
Fast 70 Jahre hat es gedauert, bis Fritz wieder Familienmitglied wurde.
"Lange Zeit galt es als ein so nebensächliches Thema, dass es immer nur von Initiativen, die nicht ganz ernst genommen wurden, erforscht wurde." - Harald Jenner, Archivar und Historiker.
"Viel Arbeit ist von Juristen geleistet worden, von engagierten Staatsanwälten, die dann mit ihrer Arbeit nicht weiterkamen. Die jahrelang ein Verfahren hatten, aber vor Gericht wurde es nicht angenommen, oder es führte zu winzigen Strafen, oder die Strafen wurden zwar verhängt, aber nicht vollstreckt. Also, da gab es eine Mauer des Schweigens, die dann vielfach Täter deckte."
Viele der am sogenannten "Euthanasie-Programm" Beteiligten, darunter unzählige Ärzte, konnten in der Nachkriegszeit ungehindert weiter ihrem Beruf nachgehen. Erst in den 80er- und 90er-Jahren schafften Betroffene, Angehörige und einige aufklärungswillige Ärzte überhaupt eine breitere öffentliche Wahrnehmung für das Thema. Die alte Ärzteschaft hatte jahrzehntelang blockiert. Harald Jenner:
"Es gab keine Bewegung, die in der Nachkriegszeit direkt sagte, was haben wir da eigentlich gemacht? Warum haben wir das gemacht? Wie sind wir dazu gekommen, und wie können wir damit umgehen? Im Gegenteil, es gab lange auch von ärztlicher Seite her Ärztekammern, die geraten haben, zum Beispiel sterilisierten Menschen keine Entschädigung zu zahlen…"
Ideologische Kontinuität auch nach 1945?
Das liege daran, "dass man sie nach wie vor als 'minderwertig' angesehen hat, dass man dadurch "Entschädigungsneurosen" auslösen würde, wenn man ihnen etwas gäbe", sagt Margret Hamm vom Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten (BEZ). Seit gut 30 Jahren läuft sie mit den Anliegen ihrer Vereinigung vor die Wände der deutschen Bürokratie.
"Ich hab relativ früh erkannt, schon ungefähr 1988, dass diese Opfergruppe keine Lobby zu haben scheint. Das waren ja alles schon ältere Menschen, die auch durch ihre Erlebnisse als Opfer geprägt waren."
Inzwischen ist Margret Hamm, gelernte Lehrerin, selbst über 70. Was sie nach wie vor aufbringt, ist der Unwille der deutschen Politik, die Opfer der NS-Euthanasie als "NS-Verfolgte" anzuerkennen. Im Bundesentschädigungsgesetz, kurz BEG, wurden die Zwangssterilisierten und Euthanasiegeschädigten, also die direkten Nachkommen von Euthanasie-Mordopfern, nahezu nicht berücksichtigt.
"Die Entschädigungen sind ganz lange beeinflusst worden durch NS-Täter, die bis Ende der 80er-Jahre in vom Parlament einberufenen Sitzungen als Gutachter ausgesagt haben und aufgrund dieser Entscheidungen – ich meine besonders den Gutachter-Ausschuss von 1961, von sieben Gutachtern waren drei NS-Täter – und aufgrund dieser Entscheidungen ist im BEG-Schlussgesetz die Entscheidung gefallen, dass die nichts bekamen."
Gut 100 Personen erhalten Entschädigungsleistungen
Circa 400.000 Menschen wurden in der NS-Zeit zwangssterilisiert. Angeordnet wurde der Eingriff von speziellen "Erbgesundheitsgerichten", auf Grundlage ärztlicher Gutachten und des "Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933. Für dieses Unrecht zumindest geringfügig entschädigt zu werden, war und ist bis heute ein umständlicher bürokratischer Prozess. Von denjenigen, die es geschafft haben, leben nur noch sehr wenige: Anfang 2018 waren es nach Angaben des BEZ noch 103 Zwangssterilisierte und ein Euthanasiegeschädigter, die Leistungen erhielten.

Das Thema "NS-Euthanasie" ist damit jedoch alles andere als erledigt.
"Als ich angefangen hab, war ich 21 und war einfach neugierig, wer dieser Opa war, den ich nie kannte."
Julia Gilfert, 28 Jahre alt, Enkelin des Dirigenten und Musikers Walter Frick:
"Er ist 1941 in eine Nervenheilanstalt eingewiesen worden, von seinem eigenen Schwager, der bei der Waffen-SS war, und es handelte es sich wohl – nach allem, was wir wissen – um die Nervenanstalt Bernau bei Berlin, in der er dann mutmaßlich auch ermordet wurde oder zumindest durch Vernachlässigung gestorben ist. In der Sterbeurkunde steht, dass er am 7.8.1941 an Erschöpfung, Depression und trauriger Verstimmung gestorben sei."
Themen, die "auch wiederkommen können"
Julia Gilfert engagiert sich heute unter anderem in der Initiative "Gedenkort T4" – benannt nach der Berliner Tiergartenstraße 4, wo die Nazis einen Teil des "Euthanasie"-Programms zentral steuerten. In diesem Oktober hat sie ein Treffen von forschenden Angehörigen von Euthanasie-Opfern in der Gedenkstätte Hadamar organisiert.
"Ich finde es wichtig, mich damit zu beschäftigen, weil es ein Thema ist, was gerade jetzt in der politischen Situation wieder immens an Wichtigkeit gewonnen hat. Was einfach damit zu tun hat, dass diese ganzen Prozesse von Ausgrenzung, Rassismus, aber auch Behindertenfeindlichkeit, überhaupt Ausgrenzung in jeglichem Sinne nichts sind, was an eine bestimmte Zeit gebunden ist, sondern was jederzeit, wenn sich die Gesellschaft entsprechend verändert bzw. wenn bestimmtes Gedankengut Raum bekommt, eben auch wiederkommen können."
Behindertenteilhabegesetz, Sterbehilfe, Organspende, Pränataldiagnostik – politische Themen, die aktuell sind, aber nicht geschichtsvergessen diskutiert werden sollten, so die Haltung vieler Angehöriger von Euthanasieopfern. Auch Rudolf Hans sieht das so. Er arbeitet in der Heilerziehungspflege:
"Wenn ich höre, dass die Fachkraftquoten gesenkt werden in diesem Bereich, wenn ich höre, dass der Finanzierungsdruck stärker wird, wenn all diese Dinge passieren, frage ich mich, was unter dem Strich für Menschen mit Behinderungen, für Menschen, die chronisch psychisch krank sind, dabei rauskommen wird. Wir hätten die Chance, in dieser Gesellschaft uns gut und qualifiziert um unsere behinderten Mitbürger zu kümmern, ich sehe das allerdings nicht so."
Kleine Erinnerung ans Grundgesetz
Dass die Nazis ganze Generationen von behinderten, kranken, unangepassten oder unbequemen Menschen ermordet haben, macht sich für Rudolf Hans auch unmittelbar in der Gegenwart bemerkbar:
"Wir haben jetzt in diesen Jahren die erste Generation von Menschen mit Behinderungen, die alt werden und die als alte Menschen mit einer höheren Lebenserwartung auch in unseren Einrichtungen, in unseren Diensten betreut, gepflegt werden und das ist natürlich zahlmäßig mehr, was dort aufgebracht werden muss, aber die Menschen sind es wert."
Denn, kleine Erinnerung ans Grundgesetz: Alle Menschen sind gleich wertvoll.