
Können schon Jugendliche wissen, dass ihre Geschlechtsidentität anders ist, als in der Geburtsurkunde vermerkt? Dass da „weiblich“ statt „männlich“ stehen müsste, oder „männlich“ statt „weiblich“ oder auch „divers“. Und sollen sie selbst bestimmen, welcher neue Vorname besser zu ihnen passt und auch im Ausweis zu sehen sein sollte?
Das steht im Kern des geplanten Selbstbestimmungsrechtes. Es wird zurzeit zwischen dem Justiz- und dem Familienministerium in Berlin abgestimmt und soll bald Gesetz werden.
Darauf wartet die Familie eines heute 17-jährigen Transjungen schon lange. Es würde im Alltag einiges leichter machen, sagt die Mutter: „Ja! Denn jetzt ist ja der Name auf dem Pass schlicht und ergreifend falsch. Das bedeutet, dass er, er muss jetzt zum Beispiel ein Führungszeugnis beantragen für ein Praktikum, wo auch der weibliche Name natürlich auf den Dokumenten noch steht. Das bedeutet, wenn wir in den Urlaub fliegen, dass der Ausweis und der Pass in keinster Weise vom Foto her noch passt und das eben ein weiblicher Name ist, aber da jemand mit einer tiefen Stimme und mit einem Bart vor einem steht – und die natürlich sagen könnten: Das ist doch nicht die Person.“
Dass ihr Sohn kein ganz typisches Mädchen ist, war den Eltern früh klar. Seine Vorlieben bei der Kleidung, bei Rollenspielen, die eher für Jungen typischen Kindergeburtstage: Es war nicht zu übersehen, dass er sich nicht auf die soziale Mädchenrolle festlegen ließ. Für ihn ging es dabei wohl früh um mehr, um seine Identität nämlich als Junge in einem Körper mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen.
„Ja, das ist er und das passt auch“
Das erfuhren die Eltern Jahre später von ihrem Trans-Kind am Küchentisch: „Ganz am Anfang waren wir natürlich sehr überrascht. Nicht hundertprozentig überrascht, weil wir natürlich schon gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht. Und es gab auch einen Aspekt von Erleichterungen, als das Kind sozusagen seinen Namen bekam, weil wir auch deutlich gemerkt haben, dass es ihm immer schlechter ging. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich ihn ansehe und denke: Ja, das ist er und das passt auch.“
„Ich glaube, Menschen verstehen nicht, dass, wenn man sich outet, dass da schon ein jahrelanger Reflexionsprozess hinter liegt und dass dann eigentlich nichts anderes passieren sollte als: ‚Krass! Wir unterstützen das'“, sagt dazu Ronja, 25, Filmemacherin und Trans-Frau in der Rückschau auf die schwierigen und auch einsamen Zeiten ihrer Jugend. Selbstzweifel, Essstörungen, als Versuch, die eigene Pubertät zu unterdrücken durch Gewichtsabnahme, Selbstverletzung, das kennen viele transidente Jugendliche. Zahlreiche psychische Störungen und eine hohe Suizidrate bei Transjugendlichen, die ihre Identität verstecken, werden beschrieben, zuletzt wieder in einer Begleitstudie der Charité Berlin.
Dazu Ronja: „Die größte Hürde in diesem ganzen Weg, egal, ob homosexuell, nicht-binär, ob trans, ob einfach irgendwie queer … ist man selber. Ich war für mich selber die transphobste, transfeindlichste Person in meinem Leben. Nicht anderen gegenüber! Nur mir selber gegenüber, weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe: Das darf nicht so sein, du darfst nicht so sein. Sei das nicht.“
Probeläufe in der anderen Idenität
Kleider tragen, den gewünschten Namen ausprobieren, sich unverstellt zeigen: Im Kölner Jugendzentrum „anyway“ ist das möglich: Einmal in der Woche treffen sich queere Jugendliche, vor allem um Spaß zu haben und sich auszutauschen – und für erste geschützte Probeläufe in der anderen, der „eigentlichen“ Geschlechtsidentität, erklärt Max, 21, im anyway aktiv, und non-binär, Max ordnet sich keinem konkreten Geschlecht zu: „Ich hab‘ halt selbst hier das erste Mal, wo ich da war, mich mit meinem Deadname vorgestellt, weil ich mich einfach nicht getraut hatte und die Angst hatte: Okay, wie wird es aufgefasst? Werd‘ ich irgendwie blöd angeguckt, kriege ich dumme Blicke oder so was. Aber habe recht schnell gemerkt: Okay, hier bin ich irgendwie safe, hier kann ich ich selber sein.“
Mit „deadname“ bezeichnet Max seinen ersten Namen, der aus seiner Sicht nicht mehr passt. Viele Monate später folgte der nächste Schritt. Nach einer Beratung durch das Jugendzentrum schaffte er es, seinen Eltern zu erzählen, dass er kein Mädchen ist, sondern Max – zunächst hatte er sich in einem Brief an sie geoutet.
Im Gespräch wäre das schwer geworden, gerade gegenüber dem Vater: „Weil ich mich nicht getraut habe, es ihm ins Gesicht zu sagen. Ich glaub, das waren vier Seiten Text, wo die ganze Vergangenheit aufgelistet war und auch so alte Zitate oder so Sprüche von ihm oder von meiner Mutter, die mir recht im Kopf geblieben sind: Bist du ein Kerl, oder was? Wenn ich meine Cappy aufhatte, und hab da halt geschrieben: Okay, wenn euch das interessiert oder ich euch irgendetwas bedeute, dass sie halt an einem bestimmten Datum ins anyway kommen sollten und ich die Bitte habe, dass sie sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen.“
Es hat geklappt und zumindest der selbst gewählte Jungenname hat sich bei seinen Eltern weitgehend durchgesetzt. Im Pass aber steht bis heute noch der alte Mädchenname – der „deadname“. Und in der Geburtsurkunde der Geschlechtseintrag “weiblich“. Max nennt dafür einen einfachen Grund: „Weil ich einfach für mich sag, okay, lohnt es sich für mich, oder möchte ich diesen nicht gerade schönen Weg über das Transsexuellengesetz noch gehen, mir diese zwei wirklich menschenunwürdigen Gutachten antun? Oder hab‘ ich die Hoffnung und warte, bis das Selbstbestimmungsgesetz raus ist, um den Schritt halt einfacher zu machen.“
Ein Gesetz, das einst als fortschrittlich galt
Das Transsexuellengesetz regelt derzeit noch die Änderung von Name und Geschlecht im Personenstandsregister. Es galt bei seiner Entstehung 1981 als fortschrittlich, gab es doch erstmals ein Verfahren dafür, wie Transpersonen den Geschlechtseintrag ändern können.
Heute sieht man das anders, sagt Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans: „Schon allein im Wortlaut. Also da ist viel von einem Zwang die Rede, unter dem Transpersonen angeblich stünden und diese pathologisierende Vorstellung, dass Transgeschlechtlichkeit eine psychische Störung ist, ist wirklich auch fest in dieses Gesetz eingeschrieben.“
Dass das überholt ist, wird heute von kaum einer Seite mehr ernsthaft bestritten. In insgesamt sechs Urteilen hat außerdem das Bundesverfassungsgericht über Jahre Regelungen des Transsexuellengesetzes kassiert, weil diese fortlaufend Grundrechte verletzten.
„Schreckliche Entscheidung“
Kalle Hümpfner: „Bis 2008 war noch ganz klar, Transpersonen mussten sich scheiden lassen, erst dann war es möglich, den Geschlechtseintrag anzupassen an die eigene geschlechtliche Identität. Bis 2011 war eine Voraussetzung im Transsexuellengesetz, dass Transpersonen sogenannt „fortpflanzungsunfähig“ waren. Also da gab es eine ganz schreckliche Entscheidung, die einzelne Personen treffen mussten: Möchte ich Eltern werden, oder möchte ich in meiner geschlechtlichen Identität rechtlich anerkannt sein?“
Geblieben und bis heute gültig ist: Zur Änderung des Geschlechtseintrages braucht es die Entscheidung eines Amtsgerichtes. Die Basis dafür sind zwei Gutachten, mit denen die Transidentität zu beweisen ist und die aus unterschiedlichen Gründen kritisiert werden.
„Einerseits ist das sehr teuer: Im Schnitt kommen da Kosten von um die 1.800 Euro auf die einzelne Person zu. Und es wird auch kritisiert, dass in den Begutachtungen sehr übergriffige Fragen gestellt werden. Welche Unterwäsche tragen Sie? Wie oft masturbieren sie? Welche sexuellen Vorlieben haben Sie und so weiter und so fort. Da sagen wir als Verband: Das hat in einem bürokratischen Verfahren, wenn es darum geht, welchen Geschlechtseintrag ich habe, überhaupt nichts zu suchen. Das sind alles Fragen, die gehen den Staat nichts an.“
Prozedere soll sich ändern
2.678 Menschen haben sich im Jahr 2020 dennoch diesem Verfahren ausgesetzt. Denn der richtige Name und das richtige Geschlecht sind für ihre Identität unverzichtbar. Dass sich das Prozedere für erwachsene Trans-Menschen ändern sollte, ist im Bundestag weitgehend unstrittig.
Doch das mit dem neuen Gesetz geplante Selbstbestimmungsrecht soll auch für Jugendliche und Kinder gelten. Und das löst erhebliche Diskussionen aus: Mit Zustimmung ihrer Eltern sollen auch Minderjährige die Möglichkeit haben, Vorname und Geschlecht nach eigenen Angaben und ohne Formalitäten beim Standesamt ändern zu lassen.
Sven Lehmann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium für Bündnis90/Die Grünen, traut es den Familien zu: „Mein Wissen aus sehr vielen Jahren mit dem Thema ist, dass in der Regel die Eltern eigentlich unterstützend sind, weil die Eltern kennen ihre Kinder sehr, sehr gut. Die wissen, dass da ein sehr, sehr langer Weg hinter steht und dass Kinder auch nicht aus Lust und Laune das entscheiden, sondern dass es wirklich ein Prozess ist, der über Jahre reift. Also die meisten Eltern sind wirklich unterstützend. Sollte es aber einen Konfliktfall geben, beispielsweise Eltern sind geschieden, ein Elternteil unterstützt und der andere nicht, oder streng religiöse Eltern, die aus tiefster Überzeugung ablehnen, dass ihre Jugendlichen diesen Schritt gehen wollen. Und für diese Fälle können Familiengerichte diese Entscheidung ersetzen.“

Und dem Wunsch des Trans-Jugendlichen entsprechen. Die Selbstbestimmung soll sich allerdings auf den Vornamen und die Geschlechtsangabe beschränken. So sieht es ein Eckpunktepapier vor, das die Grundlage für das Gesetz sein dürfte.
Was für Kinder und Jugendliche gelten soll
Das bestätigt der grüne Queerbeauftragte Sven Lehmann: „Jetzt geht es erstmal ausschließlich um die Frage, was in Ausweisdokumenten steht und was nicht. Die Frage, ob Menschen sich dazu entschließen, auch körperlich angleichende Maßnahmen vorzunehmen, also Hormontherapien oder Operation, ist eine Frage, die durch Fachärzte und Ärztinnen geklärt wird mit den Betroffenen auf der Grundlage von medizinischen Leitlinien. Und es ist wichtig, das zu trennen.
Denn das wird für Kinder und Jugendliche, auch künftig nicht über einfache Selbstbestimmung möglich sein. Sondern da sind weiterhin ärztliche Gutachten und eine psychiatrische Begleitung empfohlen.
Ein Termin in der Kinder- und Jugendendokrinologie am Klinikum Bochum: Familien, in denen ein Transkind aufwächst, kommen hierher, weil sie sich Klärung wünschen, vom Kinderarzt geschickt wurden oder eine weitergehende Behandlung suchen. Professorin Annette Richter-Unruh ist eine gefragte Expertin für „Varianten der Geschlechtsentwicklung“ sowie für Intersexualität.
„Bei transidenten Kindern und Jugendlichen besteht eine Geschlechtsinkongruenz: Das gefühlte erlebte Geschlecht passt nicht zum biologischen Körper. Der biologische Körper ist im Prinzip rein weiblich oder männlich, und alles passt: das äußere Genital passt zu den Hoden, zu den inneren Geschlechtsorganen. Nur die Geschlechtsidentität passt nicht. Und eine Transidentität kann man nicht beweisen. Es kann nur derjenige sagen: Ich bin ein Junge. Und dann ist er auch ein Junge. Denn die Geschlechtsidentität ist schon ein Kern der menschlichen Persönlichkeit. Die kann man auch nicht ändern oder erziehen. Die ist da.“
Hadern mit dem Geburtsgeschlecht
Das steht für Annette Richter-Unruh außer Frage. Und doch wird sie sorgfältig nachhaken – bei einem jetzt anstehenden Erstgespräch mit einer 16-Jährigen und ihren Eltern. Sie hadert seit einigen Monaten mit ihrem Geburtsgeschlecht, fühlt sich mehr als Junge, und möchte männlicher wahrgenommen werden und ihre männliche Seite ausleben. Die Pubertät mit vermehrt weiblichen Hormonen hat längst begonnen, erfährt die Ärztin. Sie fragt nach der körperlichen Entwicklung, dem Monatszyklus und dem Stand der Dinge in der Schule, in der Familie, bei Freundschaften. Einiges kommt da zur Sprache.
„Ich habe viele Jugendliche, die sind so fokussiert auf diese Thematik, dass die überhaupt nicht mehr offen sind für andere Probleme, vielleicht auch in der Schule mit den Eltern. Und die sind wirklich einfach fixiert auf diesen Gedanken, die kommen und wollen ihr Testosteron haben.“
Testosteron könnte unerwünschte Folgen der weiblichen Pubertät abbremsen. Die junge Patientin verspricht sich vor allem eine tiefere Stimme. Doch es gibt auch weitere, nicht immer erwünschte Nebenwirkungen: ein unreines Hautbild oder mehr Muskelmasse zum Beispiel. Die Ärztin macht außerdem sehr deutlich, dass männliche Hormone die Periode verändern könnten. Es ist eine Folgenabwägung: Hormongaben sind ein Eingriff. Aber sie einfach zu verweigern oder zu spät zu handeln, wäre für Annette Richter-Unruh unethisch und könnte wieder andere, schwerwiegende Probleme nach sich ziehen.
„Im Prinzip braucht man eine gute kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik, um zu sehen, kommen die Probleme wirklich durch die Geschlechtsdysphorie oder sind die Probleme anderweitig. Das muss man alles mit Ruhe und Bedacht machen und auf keinen Fall überstürzt.“
Einige Einrichtungen nehmen niemanden mehr auf
Das ist nun der Auftrag an die Familie: Mit Kontakten und Anlaufadressen versorgt verlassen sie die Ambulanz – und der Information, dass die geforderte Klärung vor einer möglichen Hormonbehandlung viel Zeit brauchen wird. Termine sind rar. Und einige der spezialisierten Einrichtungen nehmen zur Zeit niemanden mehr auf.
Doch die Frage bleibt: Ist das Unbehagen mit dem eigenen Geschlecht nur vorübergehend – oder wird es andauern? Werden weitere Behandlungsschritte notwendig und welche sind das? Viel Erfahrung bringt in diesen Fragen Professor Georg Romer mit. Der Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie in Münster hat in den letzten zehn Jahren 600 transidente Kinder auf ihrem Weg begleitet.
Seine Aufgabe versteht er so: „Ich muss mich völlig frei machen von vorgefertigten Schablonen, in die ich dieses Phänomen versuche einzuordnen. Dazu gehört auch eine Ergebnisoffenheit: Es gibt im Jugendalter psychosexuelle Reifungskrisen, in der eine vermeintliche transgeschlechtliche Identifizierung ein vorübergehendes Phänomen sein kann als Lösungsversuch eines anderweitigen Rollenkonflikts, und dafür muss ich sensibel sein. Und dafür brauche ich auch eine gewisse Zeit der Begleitung. Aber ich muss mich auch freimachen von einer Haltung, in der ich als gutachterlicher Gatekeeper, die Macht ausübe, zu entscheiden: Du bist trans und du bist nicht trans.“
Ergebnisoffen sein, ohne Vorurteil zu handeln, das entspricht den Behandlungsstandards. In der Zeit der ambulanten Begleitung, die oft erst nach Monaten beginnt und viele weitere Wochen dauert, muss dazu der Dialog gelingen. Die transidenten Jugendlichen müssen viel erfahren und reflektieren, um entscheiden zu können, wie weit man gehen will. „Einwilligungsfähigkeit“ ist der Fachbegriff dafür. Sie ist Voraussetzung für Therapie. So steht es in den Behandlungsleitlinien: „An dieser Stelle schlägt dann natürlich auch die Stunde der sozialen Erprobung. Der Weg geht über die Erprobung im Außen.“
Wie fühlte es sich an, die andere, die nun passendere Kleidung zu tragen? Die eigene Geschlechtsidentität nicht zu verbergen? Romer rät außerdem, die Videos im Netz zu beachten: Es gibt nämlich nicht nur Erfolgsgeschichten, trotz aller Sorgfalt in der Beratung und Entscheidungsfindung: Sogenannte „De-Transitionierer“, Menschen, die mit der Änderung ihres Geschlechts im Nachhinein hadern, schildern ihr Bedauern nach Hormonbehandlung oder Operation.
Auch das muss man wissen und für sich einschätzen, bevor man sich entscheidet: „Und wenn jemand dann in der sozialen Erprobung, in mehreren Gesprächen über Monate wiederkommt, dann kann man darüber reden: Hat das das Problem schon gelöst? Also fühlt sich das bisherige Mädchen, das sich die Freiheit genommen hat, mit Bürstenhaarschnitt und Khakihosen, mit einem Vornamen Bob oder wie auch immer in der Schule aufzutreten, bereits wohl oder sagt sie: Es geht mir viel, viel besser, aber wenn ich einer Dusche an mir runtergucke, leide ich wie ein Hund. Ich kann es nicht ertragen. Diese Brüste gehören da nicht hin.“
Noch Abstimmungsbedarf in der Koalition
Dann wären das verlässliche Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine bleibende Geschlechtsdysphorie handelt – entscheidend dafür, ob einer Behandlung aus Sicht eines Jugendpsychiaters zugestimmt werden kann. Was das Ergebnis ist, bliebe dennoch den Trans-Jugendlichen überlassen. Bisher gehen sie sehr unterschiedlich damit um: Manche wählen die Hormonersatztherapie und vielleicht außerdem geschlechtsangleichende Operationen. Andere finden sich neu oder arrangieren sich mit dem Geburtsgeschlecht. Und nicht wenigen genügt es vollkommen, ihre Geschlechtsidentität selbstbestimmt ändern zu lassen und einen selbstgewählten Namen endlich in ihren Ausweisen, Zeugnissen und allen amtlichen Einträgen zu wissen. Das angekündigte Selbstbestimmungsrecht der Ampelkoalition biete diese einfache und unschädliche Möglichkeit. Das jedenfalls finden Ronja und Max, die sich im Jugendzentrum anyway in der Beratung engagieren.
„Man hat keinen Nachteil dadurch, wenn sich Trans-Menschen und nicht-binäre Menschen endlich mit dem Namen beim Staat „registrieren“ können, sag ich mal. Wir bewegen uns mindestens grob gesagt, in die richtige Richtung, dass man eben queeren Menschen an sich die Plattform gibt.“
Max plädiert auch dafür, den Kindern und Jugendlichen, um die es geht, bei ihrer Selbsteinschätzung Glauben zu schenken und das Thema nicht unnötig zu dramatisieren. Max will eine Regelung, wie sie auch die Eckpunkte der Ampel-Koalition vorsehen: Jugendliche sollten die Möglichkeit bekommen, ihren Namen und Geschlechtseintrag ändern zu können: Wenn die Eltern nicht zustimmen, notfalls mit Hilfe von Gerichten: „Wenn jetzt eine 14-jährige Person zum Standesamt geht und sagt: Ich bin ein Junge, und ich heiße Tom oder was auch immer. Und fünf Jahre später im dümmsten Fall merkt: Nee, ist vielleicht doch nicht. Dann ist, worum es in dem Selbstbestimmungsgesetz geht, ja erstmal nur Papierkram in dem Sinne. Es ist ja nichts, dass irgendwie ein Eingriff gemacht wurde! Das ist einfach nur Papierkram.“
Die Eckpunkte des Selbstbestimmungsrechtes liegen schon seit dem Sommer 2022 vor. Offenbar besteht immer noch „Abstimmungsbedarf“ zwischen dem grün-geführten Familienministerium und dem FDP-geführten Justizministerium. In den nächsten Tagen, höchstens Wochen soll das Selbstbestimmungsrecht im Bundestag beraten werden.



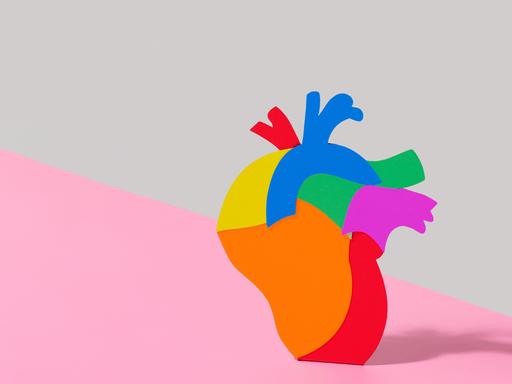











![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


