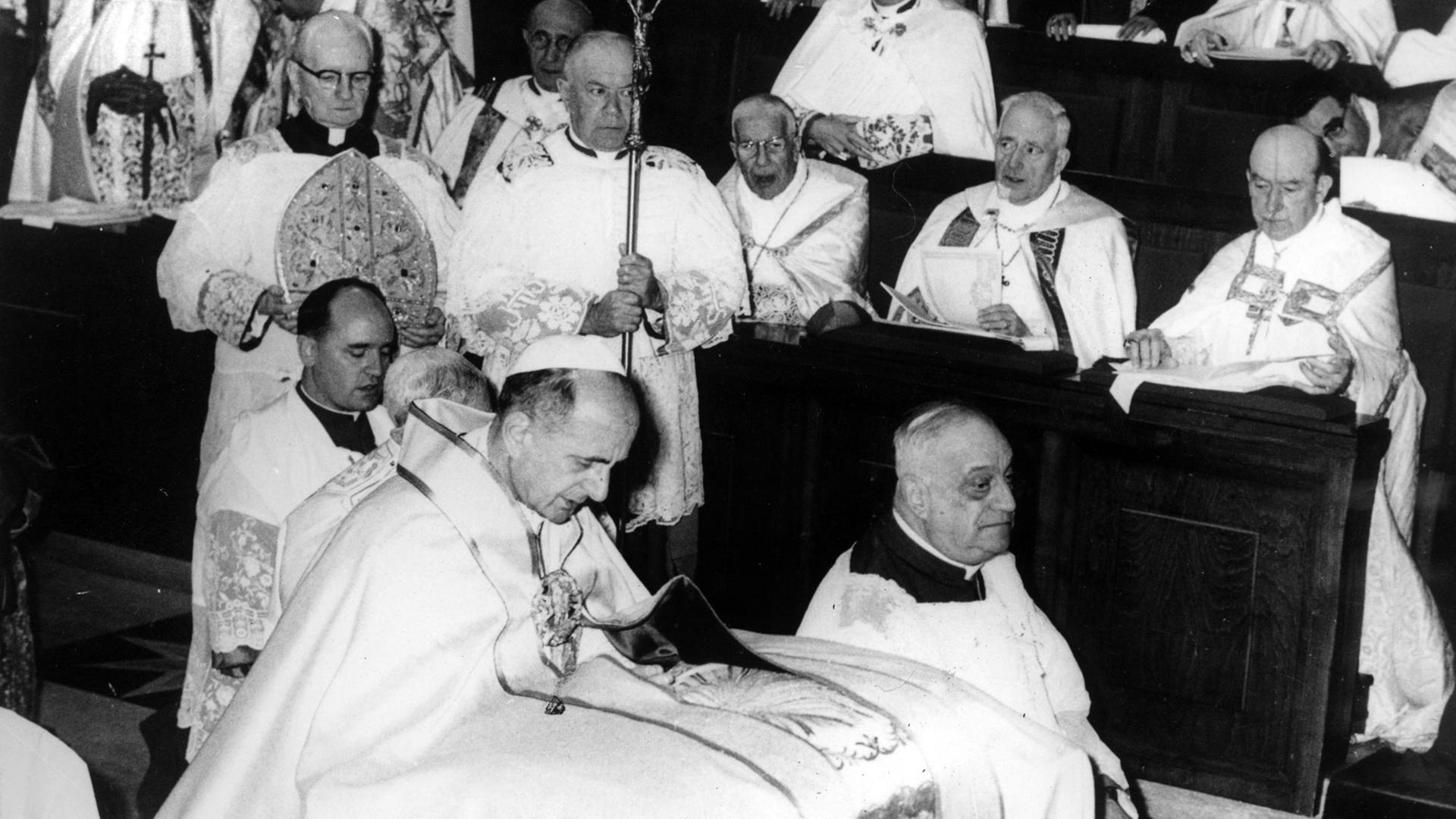Es wirkt wie ein ewig wiederkehrendes Déjà-vu: Der Papst kündigt seinen Besuch in der Türkei an – und wieder einmal keimt bei den griechisch-orthodoxen Christen am Bosporus Hoffnung auf:
„Was wir uns von diesem Besuch erhoffen“, fragt der Sprecher des griechisch-orthodoxen Patriarchats, Peder Dositheos."Wir hoffen auf die Wiedereröffnung unseres Priesterseminars auf Halki. Nach wie vor tut sich dort nichts. Vielleicht wird der Papst in Ankara ein Wort für uns einlegen.“
Halki, immer wieder Halki. Ganz gleich ob der deutsche Bundespräsident in die Türkei kommt, der amerikanische Außenminister oder eben der Papst. Immer wieder hoffen die griechisch-orthodoxen Christen auf die Wiedereröffnung ihres einst so einflussreichen Priesterseminars, das im Jahr 1971 von der türkischen Regierung geschlossenen wurde.
Als diese Hoffnungen auch bei einem im vergangenen Jahr groß angekündigten Demokratiepaket wieder enttäuscht wurden, hatte der damalige Ministerpräsident Erdogan sogar eine Erklärung für die christliche Minderheit parat.
„Es ist für uns kein Problem das Priesterseminar wiederzueröffnen“, sagte Erdogan damals. „Aber ich erwarte im Gegenzug zwei wichtige Dinge. Erstens: In Athen stehen zwei zerfallene Moscheen. Ich habe gesagt: Lasst uns diese Moscheen wieder aufbauen. Die Griechen versprachen es, aber sie tun nichts. Und zweitens: In Westthrakien wird der Obermufti der dortigen türkischen Minderheit immer noch von der griechischen Regierung bestimmt. Aber er müsste von den Türken und von unseren Muftis hier gewählt werden.“
Wie du mir, so ich dir. Die griechisch-orthodoxe Gemeinde am Bosporus fand sich plötzlich als Faustpfand in einer Auseinandersetzung mit Griechenland wieder, die sie – seit Generationen türkische Staatsbürger – doch eigentlich gar nicht betraf.
Türkische Verfassung schützt Rechte der Christen
Die türkische Verfassung schützt die Rechte von griechisch-orthodoxen und armenischen Christen ausdrücklich. Auch ist unbestritten, dass die konservative AKP-Regierung in den letzten Jahren auf die nicht einmal ein Prozent ausmachende nicht-muslimische Bevölkerung zugegangen ist: In der Vergangenheit entschädigungslos enteignetes Stiftungseigentum kann nun zurückgefordert werden, Gottesdienste an symbolträchtigen Orten wie der Kirche zum Heiligen Kreuz im Südosten des Landes sind immerhin zu besonderen Anlässen möglich. Und auch im Dauerstreit um die Ländereien des syrisch-orthodoxen Klosters Mor Gabriel gibt es Fortschritte.
„In der Türkei hat sich in den letzten Jahren viel getan“, bestätigt auch der armenische Priester Kirkor Agbaloglu in Istanbul.
„Wenn sie vor 20 Jahren ein Buch über die Massaker an den Armeniern geschrieben hätten, wäre es konfisziert worden und Autor und Verlag wären vor Gericht gelandet. Aber durch die veränderte Gesetzeslage konnte in den letzten Jahren über viele Themen geschrieben werden.“
Und doch ändert all das kaum etwas an der generellen Einstellung im Land, die auch in der Diskussion um das Priesterseminar auf Halki zum Ausdruck kommt: Nicht-Muslime gelten in der Türkei nicht als echte Staatsbürger. Sie, deren Vorfahren meist schon lange vor der Republikgründung hier lebten, werden bestenfalls als Gäste behandelt, die eigentlich in ein anderes Land gehören. Also mögen sie bitteschön dankbar sein, analysiert Arus Yumul, armenisch-türkische Soziologin an der Istanbuler Bilgi-Universität, die weitverbreitete Haltung der Mehrheitsgesellschaft.
„Was fehlt, ist die Einsicht, dass auch Christen als Bürger dieses Staates ihre Rechte haben. Sie werden als potenzielle Gefahr angesehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es hier einst sogar ein Gesetz gab, das die Minderheiten als sogenannte lokale Ausländer definierte. Das Gesetz ist abgeschafft. Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen immer noch so denkt.“
Armenier gelten bei vielen Türken noch als Verräter
Regelungen, wie die verpflichtende Angabe der Religionszugehörigkeit im türkischen Personalausweis oder die generelle Verpflichtung für Schüler am sunnitischen Religionsunterricht teilzunehmen, bestärken das Gefühl vieler Christen, Bürger zweiter Klasse zu sein. Auch die türkischen Geschichtsbücher fördern dieses Empfinden. Sie stellen die Armenier noch immer nicht selten als Verräter dar. Soziologin Yumul durchsuchte jüngst die sozialen Netzwerke des Landes auf den Umgang mit dem Wort Armenier. Ihre Erkenntnisse brachte ein Interneteintrag auf den Punkt:
„Dort stand: Jemanden in der Politik einen Armenier zu nennen, ist das Schlimmste, was du ihm antun kannst. Das ist so wahr! In diesem Land wirkt es immer noch wie ein Verbrechen, einen Armenier in der Familie zu haben. Und jemanden einen Armenier zu nennen, ist deswegen eine Beschimpfung, für die Leute vor Gericht landen und bestraft werden.“
Und so überrascht es kaum, dass auch 100 Jahre nach den Massakern an der armenisch-christlichen Bevölkerung, immer noch viele türkische Christen ihre Religionszugehörigkeit zu verschleiern suchen, sich muslimisch klingende Rufnamen zulegen oder am Sonntag nur heimlich in die Kirche schleichen.
„Es ist manchmal schwierig, hier in der Türkei Christin zu sein“, bestätigt eine junge Gläubige, die an einem Sonntagmorgen zum katholischen Gottesdienst in der Istanbuler Sankt-Anton-Kirche gekommen ist.
„Ich trage zum Beispiel kein Kreuz, weil ich allein unter muslimischen Türken lebe. Der Besuch von Papst Franziskus ist für mich deswegen vor allem eine geistliche Unterstützung.“