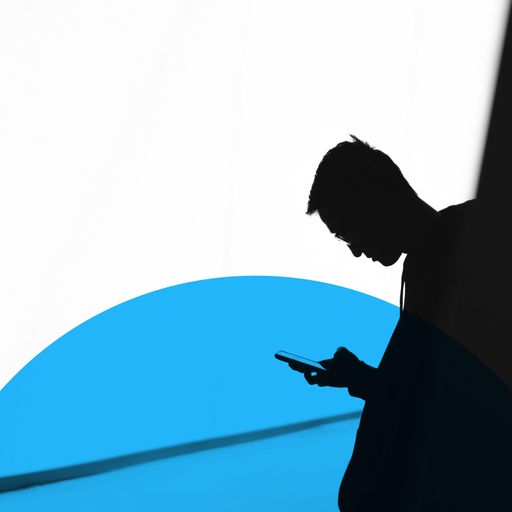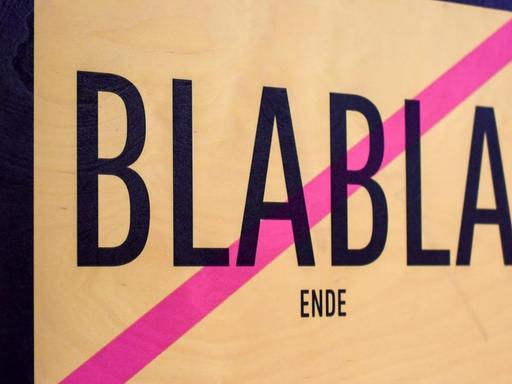Wenn CDU oder CSU mit der SPD eine Koalition bilden, wird der Zusammenschluss gerne „Große Koalition“ genannt. Wie die erste „Große Koalition“ auf Bundesebene 1966 unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Damals vereinten die großen Volksparteien 90 Prozent der Sitze im Bundestag auf sich.
Die Bezeichnung hat sich gehalten, ist aber mittlerweile wenig aussagekräftig. Denn was wir heute Große Koalition nennen, ist meist genauso groß wie jede andere Koalition.
Tatsächliche Größe einer Koalition wird verschleiert
Angela Merkels letztes Bündnis aus Union und SPD etwa vertrat nur noch 56 Prozent der Abgeordneten. Und auf dem Niveau finden wir auch die angebliche "Große Koalition" im Bundesland Berlin. Die damit genauso groß oder klein ist wie die Koalitionen in Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen – wo aber jeweils nur eine der beiden ehemals großen Parteien beteiligt ist.
In Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen CDU und SPD nicht mal zusammen auf eine Mehrheit. Muss man ihre Bündnisse mit Grünen bzw. FDP dann vielleicht eine "wirklich Große Koaltion" nennen?
Wenn Medien von einer "Großen Koaltion" aus Union und SPD reden, verschleiern sie deren tatsächliche Größe. Stattdessen könnten sie ganz leicht benennen, wer da koaliert: CDU oder CSU mit SPD – oder umgekehrt. Schließlich kommt es auch auf die Reihenfolge an.