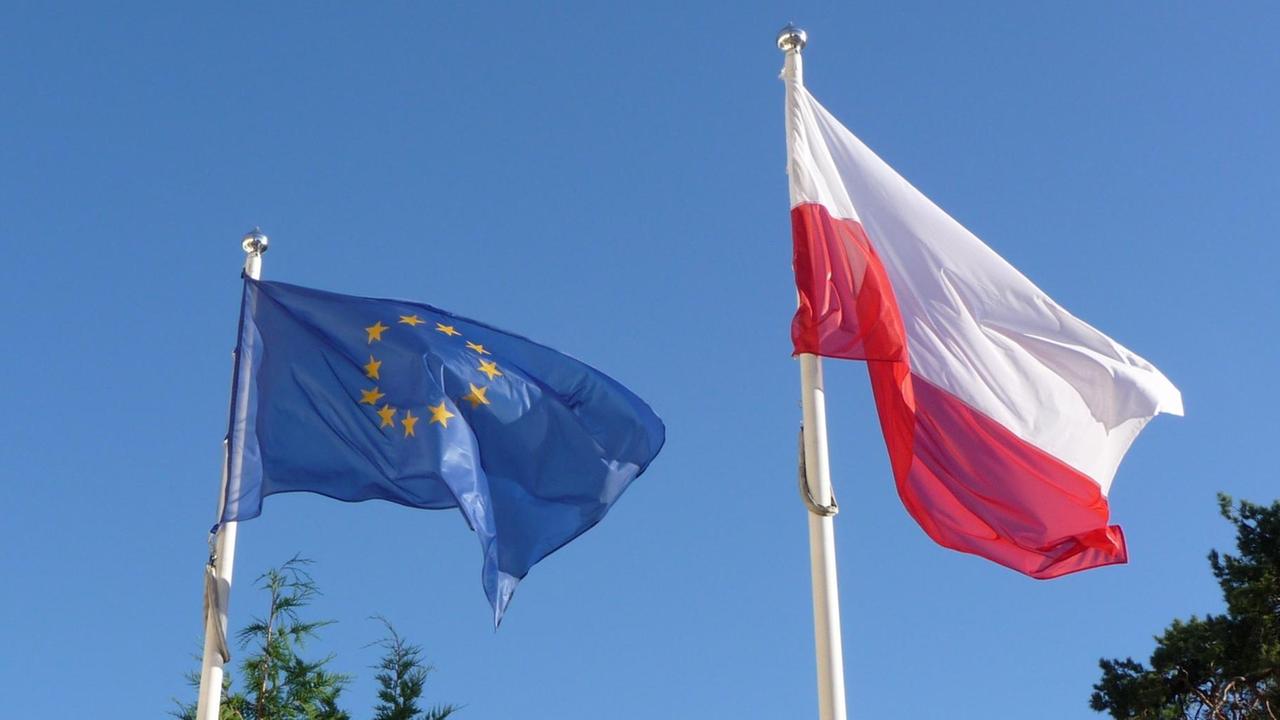Das Café „Dobro dobro“ ist das kleinste in ganz Polen. Auf nur sechs Quadratmetern gibt es italienischen Kaffee, ukrainische Süßspeisen – und auch eine winzige Bank zum Hinsetzen. Sie kenne viele der Kunden schon persönlich, sagt Ljuda Sokalska, die hinter der Theke steht. Sie wisse genau, welcher Kunde, abhängig von der Tageszeit, welchen Kaffee bevorzugt.Von einer Schnur an der Wand hängen Pappbecher – als Zeichen für Kaffee, den man umsonst bekommt. Kunden haben ihn für andere, ihnen unbekannte Kunden gekauft. Caffe sospeso, eine süditalienische Tradition sei das, erklärt Ljuda:
„Das Ganze ist doch eine sehr gute Idee. Es gibt doch so Phasen im Leben, wo es nicht reicht für einen Kaffee. Und wenn es wieder besser läuft, dann spendiert man anderen einen. Die Becher, auf denen die Spender eine Widmung hinterlassen haben, bleiben ziemlich lange hängen bei uns, die anderen gehen schnell weg.“
Ljuda ist Studentin und kommt aus der Ukraine, genauso wie die Eigentümer des Dobro-Cafés. Zwei Millionen Ukrainer gibt es inzwischen nach Schätzungen in Polen. Und das Dobro-Café zeigt, dass die Migranten längst nicht mehr nur billige Arbeitskraft, sondern auch gute Ideen mitbringen. Die Eigentümerin Inna Jarowa zwängt sich in das winzige Lokal, sie ist perfekt, aber auffällig geschminkt. Die 27-Jährige gibt sich als Geschäftsfrau durch und durch:
„Dobro heißt auf Ukrainisch „Das Gute“. Aber es reicht ja nicht, nur den Namen zu haben. Alles muss zu so einem Konzept passen. Der Caffe sospeso ist nur ein Beispiel. Wir haben die Dobro-Box, eine Geschenkbox für Freunde. Vor Weihnachten haben wir den Kunden angeboten, dass wir für sie Briefchen verschicken, nicht nur in die Ukraine.“
Größte Migrationsbewegung in Europa
Die meisten Ukrainer kamen in den vergangenen vier Jahren – nachdem im Osten der Ukraine ein Krieg begonnen hatte und die Wirtschaft des Landes beinahe zusammenbrach. Es ist die derzeit wohl größte Migrationsbewegung in Europa. In beinahe jedem Warschauer Supermarkt sitzt eine Ukrainerin an der Kasse, auf fast jeder Baustelle rufen sich die Arbeiter etwas auf Ukrainisch zu. Noch relativ neu ist, dass auch Menschen wie Inna Jarowa kommen. Sie und ihr Mann waren erfolgreich in Kiew, in der Werbebranche. Sie sind mit eigenem Kapital nach Warschau gekommen.
„Wir sind nicht nach Polen gekommen, weil es in der Ukraine schlecht ist. Wir wollten etwas Neues ausprobieren. Mir wurde eine Arbeitsstelle hier angeboten – das haben wir genutzt, um uns hier selbstständig zu machen. Wer es als Unternehmer schafft, der hat ein unsichtbares Diplom erworben, das so viel wert ist wie alle Wissenschaften.“

Das Dobro-Café liegt in der südlichen Innenstadt. Links und rechts haben sich die großen Ketten angesiedelt. Trotzdem hat das ukrainische Projekt seine Stammkunden. Erfolgreich ist das Dobro-Café, weil es hier zu erschwinglichen Preisen außergewöhnliche und gelungene Kreationen gibt. Kaffee mit aufgeschäumtem Orangensaft zum Beispiel – oder Kaffee kalt mit Tonic. Mit ihrem Konzept wollen es die Unternehmer aus der Ukraine weit bringen. Inzwischen hat auch Ihor das Café betreten, der Mann von Inna.
„Wir wollen ein Netz von kleinen Cafés schaffen, das auch in andere europäische Länder reicht. Warum nicht auch nach Deutschland? Wir haben hier das kleinste Café in Polen, so viel steht fest. Vielleicht sogar in Europa. Bis vor kurzem gab es nur in London ein noch kleineres, aber das ist, wenn man den Informationen im Internet glauben kann, inzwischen geschlossen.“
Den beiden Ukrainern geht es darum, auch anderen Ukrainern zu helfen. Sie sollen keine Angestellten werden, sondern von ihnen die Lizenz für ein Café in diesem Stil erwerben. Sie können es dann an ihren lokalen Markt anpassen. Geklappt hat das schon in Lublin, in Ostpolen. Schließlich würden die Einwanderer aus der Ukraine zunehmend selbstbewusster, sagt Ihor:
„Früher sind die Ukrainer gekommen, um hier Saisonarbeiten zu erledigen und zurückzukehren. Auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Aber immer mehr lassen sich hier nieder. Sie wollen nicht 15, 16 Stunden körperlich arbeiten, sondern hier etwas aus sich machen. Wir haben viele Freunde, die sich selbstständig gemacht, die ihren dritten privaten Kindergarten oder ihr erstes Restaurant mit ukrainischem Schaschlik aufgemacht haben.“
Nur jeder vierte Pole findet Ukrainer sympathisch
Ljuda, die Studentin, hört aufmerksam zu. Sie kann von so etwas vorerst nur träumen. Sie hat vor sieben Jahren klein angefangen in Polen – mit einem Stipendium für polnisch-stämmige Ukrainer. In ihrem ersten Studienfach – Journalistik – hat sie zwar einen Abschluss. Aber der Beruf ist nichts für sie, wie sie inzwischen herausgefunden hat. Nun studiert sie angewandte Linguistik. Als die Chefs wieder weg sind, sie haben den nächsten Termin, beginnt Ljuda zu erzählen. Sie ist nicht nur glücklich darüber, dass ihr so viele ihrer Landsleute nach Polen gefolgt sind.
„Nicht alle benehmen sich hier ordentlich. Das ist nicht gut, so ziehen wir Ukrainer nur noch mehr Aufmerksamkeit auf uns. Schon jetzt spreche ich lieber nicht mehr Ukrainisch im Bus oder in der Straßenbahn. Immer öfter schauen mich die Leute an, böse, das war früher nicht so. Manchen sind es wohl inzwischen zu viele Ukrainer hier. Wenn ich meinen polnischen Freunden davon erzähle, sagen die nur: Sie würden sich ja nicht so verhalten. Sie verstünden nicht, wo das Problem liegt.“
„Nicht alle benehmen sich hier ordentlich. Das ist nicht gut, so ziehen wir Ukrainer nur noch mehr Aufmerksamkeit auf uns. Schon jetzt spreche ich lieber nicht mehr Ukrainisch im Bus oder in der Straßenbahn. Immer öfter schauen mich die Leute an, böse, das war früher nicht so. Manchen sind es wohl inzwischen zu viele Ukrainer hier. Wenn ich meinen polnischen Freunden davon erzähle, sagen die nur: Sie würden sich ja nicht so verhalten. Sie verstünden nicht, wo das Problem liegt.“
Umfragen bestätigen Ljudas Eindruck. Nur jeder vierte Pole erklärte bei einer Befragung in diesem Jahr, er finde Ukrainer sympathisch. Das waren erheblich weniger als noch im vergangenen Jahr. Ein Grund dafür ist die Geschichte. In Polen wird viel über das Massaker von Wolhynien gesprochen, seit das polnische Parlament dazu vor zwei Jahren einen Beschluss gefasst hat. In Wolhynien in der Westukraine begingen ukrainische Nationalisten 1943 grausame Verbrechen an polnischen Zivilisten. Sie töteten Zigtausende. Der Sejm bezeichnete das vor zwei Jahren als Völkermord. Ein Spielfilm kam in die Kinos, der bestialische Szenen zeigt. Ljuda hat ihn sich lieber nicht angesehen.

„Wenn ich sage, dass ich aus der Kleinstadt Berestetschko komme, dann füge ich lieber nicht hinzu, dass das in Wolhynien liegt. Eine historische Stadt ist das, sage ich, 120 Kilometer von Lemberg entfernt. Auf Lemberg reagieren die Leute positiv. Letztens bei einem Picknick hat mir ein Bekannter einen Vortrag über das Massaker von Wolhynien gehalten. Als ob ich daran schuld wäre. Verstehen kann ich das nicht.“
Ein anderes Argument gegen die Ukrainer in Polen klingt rationaler: Sie arbeiteten oft für einen Hungerlohn. Damit würden sie zwar den polnischen Firmen helfen, heißt es, aber die Löhne für die Einheimischen drücken. Aber das stimmt so nicht, sagt Ula Vorobets. Sie muss es wissen, denn sie betreibt eine Arbeitsvermittlung für Ukrainer in Polen:
„Oft höre ich: Die Ukrainer nehmen uns die Arbeit weg. Das ist nicht wahr. Sie füllen nur die Lücken auf dem Arbeitsmarkt. Ein Beispiel: In Polen gibt es keine Schneider oder Schneiderinnen mehr. Auch Elektriker gibt es viel zu wenig. Jetzt sucht schon die Bahn händeringend nach Mitarbeitern. Fast in jeder Branche fehlt es an Arbeitskräften. In Wahrheit retten die Ukrainer die polnische Wirtschaft. Und sie zahlen dabei in die Rentenkasse ein.“
Arbeitslosigkeit bei sechs Prozent
Die Wirtschaftsdaten geben Ula Vorobets Recht: Die Arbeitslosigkeit liegt in Polen bei sechs Prozent – so niedrig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jede zweite Firma klagt, dass sie nicht genug Arbeitskräfte finden kann. Ula Vorobets kommt aus dem westukrainischen Lemberg. In Polen wollte sie genug Geld verdienen, um eine dringend notwendige Operation für eines ihrer Kinder zu bezahlen. Inzwischen wohnt sie im Südwesten von Polen, wo sie einen ehrlichen Arbeitgeber gefunden hat. Von dort aus betreibt sie ein Internetportal. Es bringt polnische Firmen mit ukrainischen Mitarbeitern zusammen – und schützt beide:
„Wir helfen jedem gerne, aber wir helfen auch gerne beim Bestrafen. Einen Unternehmer, der betrügt, melden wir der Arbeitsaufsicht. Und einen unehrlichen Ukrainer dem Grenzschutz – er bekommt ein Einreiseverbot. Glauben Sie mir, das wirkt.“
Ula Vorobets hat sich in einem Café am Warschauer Westbahnhof verabredet. Denn hier kommen die Fernbusse an, mehrere täglich, vor allem aus Osteuropa. Ula geht hinaus in die Wartehalle. Die Halle wirkt frisch renoviert. Die Drogerie, die Lebensmittelläden, der Kiosk – der Busbahnhof hat ein einheitliches, schickes Design bekommen. Aber Ula Worobets blickt mit geschulten Augen auf die Szene:
„Schauen Sie auf die Frau, die dahinten steht. Sie steigt von einem Fuß auf den anderen und beißt sich auf die Lippen. Sie ist gestresst. Vielleicht wartet sie auf ihren vermeintlichen Arbeitgeber. Und die beiden Männer, die gerade zur Tür laufen, das sind Mittler. Sie haben gerade Ukrainer hierher gebracht, nehme ich an. Der Westbahnhof hat sein eigenes Leben, für manche ist das ein Märchen, für andere ein Horrorfilm.“

Diese Wartehalle ist das erste Gebäude, das viele Immigranten in Polen sehen. In der Regel wissen sie schon, wo sie arbeiten werden. Oder vielmehr glauben sie das. Denn nicht wenige werden betrogen. Von den ukrainischen Vermittlern, die sie für eine saftige Gebühr hierher gebracht haben. Oder von ihren künftigen Chefs. Ula Vorobets hat hier schon Menschen getroffen, die völlig verzweifelt waren. Im Winter war da eine Frau, die fast eine Woche auf einer der Bänke geschlafen hat:
„Gute Menschen haben ihr immer mal wieder ein Brötchen oder einen Kaffee gekauft, denn sie hatte kein Geld. Ihr Arbeitgeber hat sie betrogen und sie nicht bezahlt. Und die Ukrainer, mit denen sie hierher zurückgekommen ist, haben sie auch noch bestohlen, als sie eingenickt ist. Sie hatte kein Telefon mehr, kein Essen und keine Hoffnung auf ein besseres Leben. Gott sei Dank habe ich für sie einen besseren Arbeitgeber gefunden, in einem Sanatorium an der Ostsee.“
Die meisten Ukrainer, die einmal in Polen angekommen sind, schaffen es, sich hochzuarbeiten. Wie Ljudmila Daschewska. Sie sitzt in einem ukrainischen Restaurant in der Nähe des Hauptbahnhofs und hat sich Borschtsch bestellt.
„Mein Vater hat mir beigebracht, dass man nie aufgeben soll. Ich konnte nicht als Besiegte nach Hause zurückkehren, höchstens als Siegerin. Klar, am Anfang war ich ein bisschen depressiv, so allein in einer fremden Stadt. Aber mein Vorteil ist, dass ich fast jede Arbeit annehmen kann. Von meiner Oma habe ich sogar gelernt, wie man ein Haus baut.“
Kein Flüchtlingsstatus
Ljudmila stammt aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine, aus dem Bezirk Luhansk. Dort hatte sie eine Arbeit mit viel Prestige: Sie verkaufte an reiche Ukrainer Immobilien in Spanien. Aber als die prorussischen Separatisten kamen und sie bedrohten – weil sie für die Ukraine eintrat – verließ Ljudmila ihre Heimat. Ihr wurde eine Stelle in Posen vermittelt, aber der Arbeitgeber zahlte weniger als vereinbart. Da fuhr sie nach Warschau und mietete sie sich für ein paar Tage ein Zimmer. Im Internetcafé studierte sie die Annoncen von Arbeitgebern und rief sie alle an:
„Ich habe damals nur gebrochen Polnisch gesprochen. Und da haben die Arbeitgeber alle abgewunken. Ich habe verstanden, dass ich erst einmal irgendeinen Job annehmen sollte, um die Sprache zu lernen. Ich habe in der Küche eines Hotels gearbeitet, wo ich auch schlafen konnte – und gleichzeitig bin ich in alle Polnisch Kurse gegangen, die ich finden konnte.“
Obwohl Ljudmila aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine stammt, hat sie in Polen kein Asyl beantragt. Sie war allein und konnte – mit einer Arbeitsstelle – leicht eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Für Familien mit Kindern ist das nicht so einfach. Wie für die Familie von Mychailo und Alona Malyschew. Die beiden stammen aus Donezk. Ihr Haus lag in der Nähe des Flughafens. Dort also, wo die Kämpfe als erstes ausbrachen und wo sie bis heute am heftigsten sind. Mychailo, 28 Jahre alt, erinnert sich:
„Es war der 26. Mai 2014. Ein gewöhnlicher Tag – und da gab es plötzlich einen lauten Knall und dann noch einen und immer wieder. Ich habe gehört, wie ein Schrapnell auf unserem Dach explodiert und wie etwas in den Hof gefallen ist. Da habe ich meine Familie unter den Arm genommen, ins Auto und weg.“

Eine gute Entscheidung: Inzwischen wurde das Haus der Malyschews mehrfach von Granaten getroffen. Schließlich entschieden sie sich, zu Bekannten nach Polen zu fliehen. Hier fühlt sich die Familie wohl. Wäre da nicht ein Problem:
„Wir bekommen hier keinen Flüchtlingsstatus. Aber wir wären ja schon froh über irgendeinen Status. Ich kann mir nicht vorstellen, in die Ukraine zurückzukehren. Mir ist immer wieder, als würde ich aus einem schlimmen Traum erwachen: Wie gut, dass ich nicht in der Ukraine bin, denke ich dann.“
Der kleine Timofej wirft die Klötzchen seines Baukastens um. Er ist schon in Warschau geboren. Die Familie hat hier, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Rand der polnischen Hauptstadt, ein neues Zuhause gefunden: Mychailo zeigt ein Luftschiff, eine Art Zeppelin, das sein älterer Sohn im Kindergarten aus Flaschen gebastelt hat. Er hat dafür einen Preis gewonnen. Im Kindergarten werde Matwiej auch psychologisch betreut, sagt seine Mutter Halina:
„Die Psychologin hat bestätigt, dass er sich hier sehr gut eingefunden hat. Schließlich spricht er Polnisch, singt polnische Lieder und hat polnische Freunde. Darüber bin ich froh, schließlich hat er den Krieg mitbekommen. Die Psychologin hat uns schriftlich bestätigt, dass er unbedingt hier bleiben sollte, in der ihm vertrauten Umgebung.“
Der kleine Timofej wirft die Klötzchen seines Baukastens um. Er ist schon in Warschau geboren. Die Familie hat hier, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Rand der polnischen Hauptstadt, ein neues Zuhause gefunden: Mychailo zeigt ein Luftschiff, eine Art Zeppelin, das sein älterer Sohn im Kindergarten aus Flaschen gebastelt hat. Er hat dafür einen Preis gewonnen. Im Kindergarten werde Matwiej auch psychologisch betreut, sagt seine Mutter Halina:
„Die Psychologin hat bestätigt, dass er sich hier sehr gut eingefunden hat. Schließlich spricht er Polnisch, singt polnische Lieder und hat polnische Freunde. Darüber bin ich froh, schließlich hat er den Krieg mitbekommen. Die Psychologin hat uns schriftlich bestätigt, dass er unbedingt hier bleiben sollte, in der ihm vertrauten Umgebung.“
Argument gegen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten
Halina weiß nicht mehr genau, wie oft die polnischen Behörden ihren Asylantrag schon abgelehnt haben – etwa sechsmal dürften es sein, sagt sie. Die Begründung lautet: Schließlich könne die Familie ja in den Teilen der Ukraine wohnen, wo kein Krieg herrscht. Auch ein Schreiben der evangelischen Kirchengemeinde, in der die Familie aktiv ist, half nichts. Das passt so gar nicht zu dem, was die polnische Regierung sagt. Sie spricht gern von den vielen ukrainischen Flüchtlingen, die sie aufgenommen habe. Das Argument kommt immer dann, wenn Polen erklärt, warum es auf keinen Fall Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufnehmen könne.
Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wiederholte vor dem jüngsten EU-Gipfel:
„Mein Standpunkt zur möglichen Umverteilung von Flüchtlingen in der EU und zur Immigration: Polen unterstreicht hier seine Rolle am östlichen Rand der EU. Darüber habe ich auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen, und sie hat sich dazu mit großer Anerkennung geäußert. Bei uns befinden sich 25.000 Tschetschenen, außerdem Personen aus Zentralasien, aus Usbekistan, Turkmenistan und anderen Ländern. Natürlich auch Flüchtlinge aus der Ostukraine, die wegen der russischen Invasion kein Dach mehr über dem Kopf haben.“
Zurück zur Studentin Ljuda. Ihre Schicht im Café „Dobro dobro“ geht bald zu Ende. Auch sie kann sich vorstellen, für immer in Warschau zu bleiben. Das einzige, was sie sich von den Polen wünscht: Dass sie wieder mehr Anteil nehmen am Schicksal der Ukraine, so wie damals, während der Massenproteste in Kiew und als der Krieg im Donezbecken begann:
„Vergangene Woche ist meiner Heimatstadt Berestetschko die Leiche eines 26-Jährigen angekommen. Er war aus meiner Schule, zwei Klassen über mir. Gerade war seine erste Tochter getauft worden, da ist er an der Front von einem Sniper erschossen worden. Ich wollte mit meinen Freunden hier darüber reden, aber sie haben mich nicht verstanden. Ob der Krieg in der Ukraine nicht seit Jahren vorbei sei, haben sie mich gefragt.“