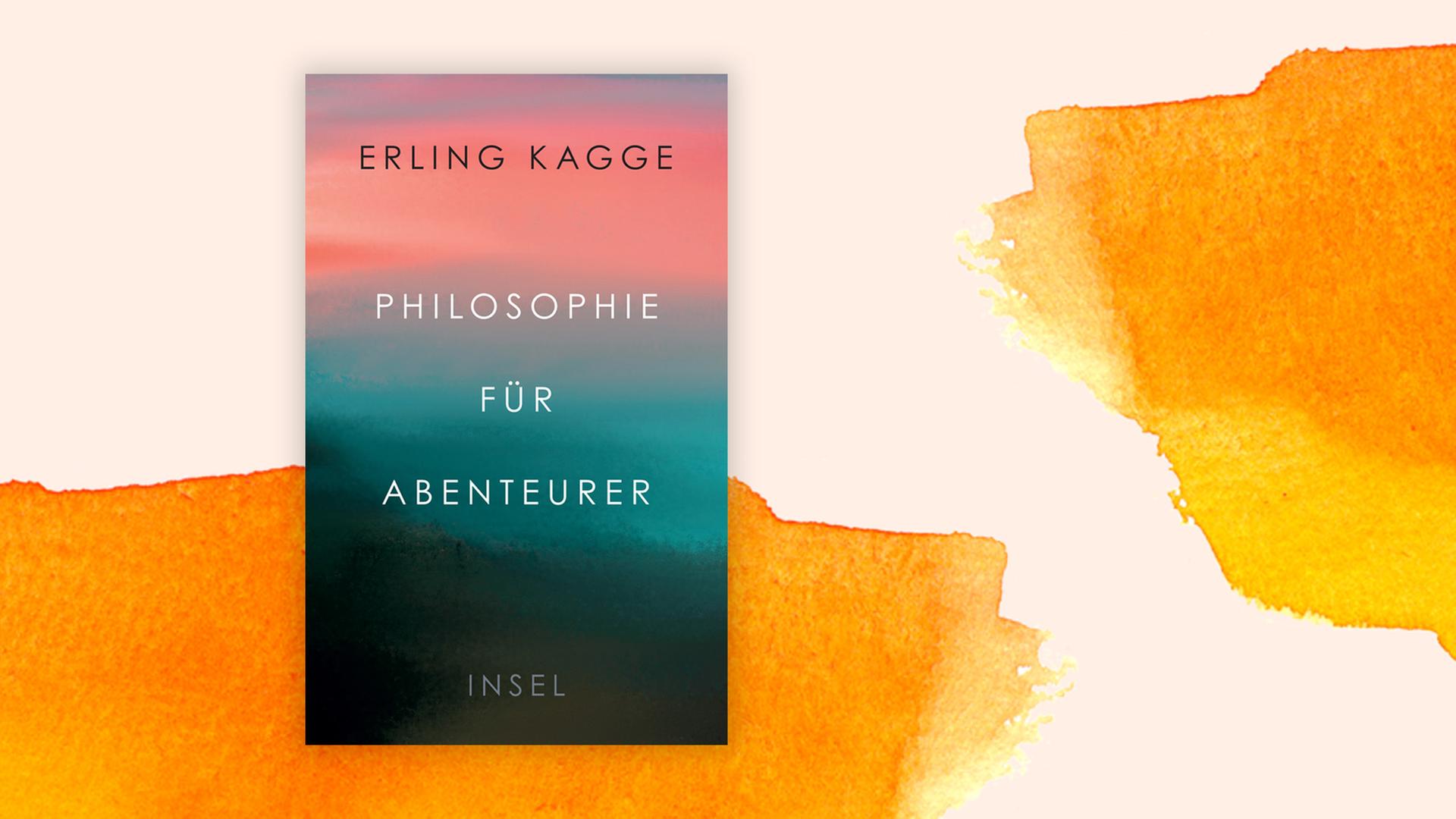Nur durch Abwendung so könne eine Gesellschaft den inneren Frieden wahren, findet Peter Strasser. Die Welt sei erdrückend eng geworden. Und nicht jeden Streit müsse man bis zum bitteren Ende durchfechten. Nicht jeder, der sich abwende, sei gleich ein feiger Diskursflüchtling. Ein Drückeberger. Ein Feind der Aufklärung.
Peter Strasser begründet das mit einem suggestiven Bild: Ratten, die in zu enge Käfige miteinander gesperrt werden, haben keinen nötigen Mindestabstand mehr. Sie verbeißen sich und verletzen sich am Ende sogar selbst.
Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat das schon in den 7oer-Jahren gerne angeführt, um vor der Überbevölkerung der Erde zu warnen. Peter Strasser wiederum zitiert diesen Befund gern – wenn auch mit Vorbehalt.
Das komplette Interview zum Nachlesen:
Pascal Fischer: Herr Strasser, klären Sie uns auf: Wie ist Ihrer Ansicht nach die Weltlage beschaffen, sodass Sie sagen, wir sollten ruhig einmal auf mehr Abwendung setzen? Offensichtlich sticht Ihnen da ja die Überbevölkerung unseres Planeten ins Auge.
Peter Strasser: Natürlich, wir sind zurzeit dabei, acht Milliarden zu werden, acht Milliarden Menschen auf der Erde. Und die Voraussage für 2050 ist etwa zehn Milliarden, also das ist schon etwas Gewaltiges. Aber wenn ich vom Umdrehen und Weggehen spreche, dann beziehe ich mich gar nicht sosehr auf diese unglaubliche Anzahl von Menschen auf der Erde, sondern mehr darauf, dass es in unseren Gesellschaften immer mehr zu einem Privileg zu werden scheint, dass wir uns nicht streitend und diskursiv ineinander verkeilen, sondern einfach, ohne aufeinander böse oder sonst wie revanchistisch gesinnt zu sein, weggehen können, dass wir auch den anderen in seiner Meinung belassen können, ohne deswegen ständig darauf zu sinnen, wie man ihm sozusagen in die Quere kommen kann mit seiner eigenen Meinung.
Fischer: Das heißt, es geht nicht nur um ein räumliches Weggehen, es kann darum gehen, muss es aber nicht. Erläutern Sie doch mal, warum wir Menschen nicht so aufeinanderhocken müssen wie Ratten, die in Käfigen eingesperrt sind, was können wir, was diese Ratten nicht können?
Kulturelle Medien zur Entdichtung
Strasser: Na ja, Ratten sind natürlich Tiere, die in Gemeinschaften leben, und solche Tiere haben, wie insbesondere das seinerzeit Konrad Lorenz betonte, sozusagen einen Respektsabstand notwendig. Sie dürfen über eine kritische Grenze sich nicht im Rudel verdichten. Nun leben wir aber gerade in einer Gesellschaft, vor allem in den Metropolen, in den großen Städten, wo ja der Zuzug stattfindet, wo eine immer größere Verdichtung auch der Fall ist. Da bedarf es eben dann kultureller Medien, um so etwas zu leisten wie eine Entdichtung. Das heißt, auch wenn wir körperlich, räumlich eng beieinander sind, haben wir in der Zwischenzeit verschiedene Arten kultureller Möglichkeiten gefunden, uns nicht oder nur sehr partiell wahrzunehmen, und das ermöglicht es uns dann, nicht aggressiv übereinander herzufallen.
Über Peter Strasser
Peter Strasser ist emeritierter Philosophie-Professor an der Karl‑Franzens-Universität Graz. Sein jüngstes Buch ist 2020 im Braumüller-Verlag erschienen und es trägt seine Empfehlung schon im Titel: "Umdrehen und Weggehen!"
Peter Strasser ist emeritierter Philosophie-Professor an der Karl‑Franzens-Universität Graz. Sein jüngstes Buch ist 2020 im Braumüller-Verlag erschienen und es trägt seine Empfehlung schon im Titel: "Umdrehen und Weggehen!"
Fischer: Das heißt, auch wenn sich Menschen ballen, sagen wir mal jetzt abseits von den Corona-Zeiten in einem Museum, dann kann ich dieses Museum trotzdem erleben als jemand, der das für sich allein erlebt, der von diesen Menschen um sich erst mal absehen kann. Was für eine Leistung muss ich da erbringen, um das zu erleben?
Strasser: Das Interessante ist, dass Sie gar keine Leistung mehr erbringen müssen, wenn die Institution einmal so funktioniert, dass Sie den anderen als Nebenmenschen zwar wahrnehmen, aber nicht als signifikanten anderen, das heißt nicht als jemanden, indem er neben Ihnen steht, Sie stört. Er ist zwar da, aber er ist so da, als ob er sozial nicht wirklich relevant wäre. Das ist ein interessantes kulturelles Phänomen, das, glaube ich, in erster Linie nur Menschen wirklich herstellen und auf Dauer stellen können, nicht zuletzt natürlich durch Regulative, die für Museen und andere Orte der engen Begegnung – nehmen wir öffentliche Verkehrsmittel oder auch Schulen, in denen sich ja viele Menschen drängen – gilt.
Ohne Ressentiments trennen
Fischer: Würden Sie sagen, Ihre Position, um sich etwas mehr anzunähern, Ihre Position steht in einer gewissen liberalen Tradition, ist es so ein bisschen "leben und leben lassen", es ist etwas davon, dass man Ärgernisse in der Öffentlichkeit aushalten muss, dass andere Menschen andere Meinungen und Haltungen haben?
Strasser: Das würde ich schon meinen, dass hier die liberale Position im Zentrum dieser ganzen Angelegenheit steht, wobei liberal ja interessanterweise auch meint, dass wir uns bemühen, unsere Meinung mit anderen Meinungen in Verbindung zu bringen, sie sozusagen am Argument des Andersdenkenden zu messen, damit wir die Bedeutung unserer eigenen Meinung besser verstehen. Aber es so tun, dass wir für den Fall, dass keine Einigung möglich ist – und das ist ja meistens der Fall –, dann auch die Möglichkeit haben, uns ohne Ressentiments zu trennen. Darin sehe ich einen großen Vorteil liberaler Gesellschaften, dass sie diese Balance ermöglichen, also eine Ethik der Abwendung – das ist ein großes Wort natürlich. Aber eine Ethik der Abwendung würde darauf zielen, solche Balancen nicht zu zerstören – also einerseits die Neugier zu erfahren, was denken die anderen, und andererseits aber die Möglichkeit, bei der Kompromissbildung so zu verfahren, dass wenn ein Kompromiss nur geringfügig oder gar nicht möglich ist, sich dann auch wieder zu trennen, ohne den anderen deswegen dämonisieren zu müssen oder bekämpfen zu müssen.
Trotzdem miteinander friedlich umgehen
Fischer: Ich würde das gern etwas konkreter erfahren von Ihnen, was das heißt. In Ihrem Buch geben Sie auch einige Beispiele zur Diskussion, zum Beispiel Handschütteln oder die Kopftuchdebatte. In beiden sind Muslime beteiligt, und was dem einen als besondere Respektbezeugung gilt, gilt dem anderen als Respektlosigkeit, wenn es um dieses Handschütteln und das Verweigern des Handschlags geht. Erzählen Sie doch mal, wenn Sie diskutiert haben, wie ist so etwas abgelaufen, ab welchem Punkt geht man da auseinander und wendet sich ab.
Strasser: Ich habe lange Zeit an der Universität unterrichtet und auch mit Lehrern gesprochen, die in sogenannten Brennpunktschulen arbeiten, wo sehr viele Muslime auch ihre Kinder hinschicken und dann zu den Elternsprechtagen kommen, um sich zu erkundigen, wie es den Kindern geht. Und da gibt es die Lehrerinnen, denen wird nicht die Hand gegeben. Was soll man da machen? Es gibt die einen, die sagen, da darf man nicht wegschauen, da muss man etwas unternehmen dagegen, möglichst in gesetzesartiger Form, falls das überhaupt möglich ist – beim Kopftuch geht das, beim Handschütteln wird es schon schwieriger. Mir persönlich haben alle diese Lehrer, die in diesen Schulen waren, versichert, sie geben zwar den Männern – denn es dreht sich ja um das Mann-Frau-Verhältnis – zu verstehen, dass man in unseren Breiten, in unserer Kultur so etwas eigentlich als unhöflich empfindet, haben es aber damit belassen. Das ist ein entscheidender Punkt. Umdrehen und weggehen muss ja nicht heißen, ich gehe wirklich weg, sondern ich sage dem Mann nur, bitte schön, das billige ich zwar nicht, dieses Verhalten, aber wenn es so ist, dann sollten wir trotzdem miteinander friedlich weiterhin umgehen.
Dlf-Denkfabrik 2021 – Auf der Suche nach dem "Wir"
Wenn sich eine Gesellschaft nicht mehr auf grundlegende Werte einigen kann, entzieht sie sich selbst den Boden – sei es in der analogen Welt oder im digitalen Raum. Wenn wir uns nicht mehr einig sind, was wahr und was falsch, was gut und was böse ist, dann können wir uns nicht mehr sinnstiftend miteinander auseinandersetzen. Wie viel Differenz halten wir aus und wer baut Brücken für den notwendigen Diskurs und Zusammenhalt?
Wenn sich eine Gesellschaft nicht mehr auf grundlegende Werte einigen kann, entzieht sie sich selbst den Boden – sei es in der analogen Welt oder im digitalen Raum. Wenn wir uns nicht mehr einig sind, was wahr und was falsch, was gut und was böse ist, dann können wir uns nicht mehr sinnstiftend miteinander auseinandersetzen. Wie viel Differenz halten wir aus und wer baut Brücken für den notwendigen Diskurs und Zusammenhalt?
Fischer: Ein anderes Beispiel ist ja die Kopftuchdebatte, ich hab es gerade schon angesprochen. Bei Ihnen in Österreich ist das ähnlich wie in Deutschland, da streitet man darüber, wo und wie darf, soll, muss das Kopftuch getragen werden von gläubigen Musliminnen. Wenn ich das lese bei Ihnen, dann habe ich den Eindruck, da spricht gar nicht so sehr Herr Strasser als Teilnehmer eines Diskurses, der am Ende eine Wahrheit sucht, sondern das ist eher Herr Strasser persönlich, der sich auch mal die Freiheit nimmt, den Fernseher abzuschalten.
Strasser: Na ja, Sie haben natürlich recht, ich sehe hier so viele Leute, die plötzlich für mein Gefühl in scheinheiliger Weise immerfort die Ungleichheit von Mann und Frau und die Unterdrückung der Mädchen und auch der Frauen in der islamischen Kultur beargwöhnen und meinen, hier müsse man auch gesetzlich Abhilfe schaffen. Mir kommt vor, dass man dadurch Integration nicht fördert, sondern durch die Abwertung des anderen und seiner Kultur eher die Disintegration vorantreibt. Deshalb sollte man, was das Kopftuch betrifft – und ich rede jetzt natürlich von den Mädchen und Frauen aus den gebildeteren Schichten –, sich liberal verhalten. Wenn sie es tragen wollen, dann sollte man ihnen nicht per Gesetz verbieten, es nicht tragen zu dürfen. Da haben wir die Möglichkeit, einfach zu sagen, schön, ich trage kein Kopftuch, falls ich weiblich bin, sondern verhalte mich so, wie man es bei uns gewohnt ist, aber wenn du es trägst, dann bitte schön. Das geht aber nur so lange – deswegen habe ich von Balance gesprochen –, solange nicht klar ist, dass es hier um Mädchen und Frauen geht, die zu Hause wirklich und effektiv unterdrückt werden. Wenn es um Frauen und Mädchen geht, die zu Hause wirklich effektiv unterdrückt werden und man weiß, dass das natürlich die unteren Schichten eher betrifft, dann müsste der Gesetzgeber einschreiten und müsste sagen, bis hierher und nicht weiter. Nur das Kopftuch generell zu verbieten, es aus den Schulen weg zu eskamotieren und aus anderen Bereichen, das kommt mir eigentlich irgendwie so vor, als ob man den Leuten sagen wollte, wir dulden eure Kultur nicht, ihr müsst weggehen, wir sind da. Da ist dann diese Balance nicht mehr gewahrt.
"Wir können noch miteinander reden, ohne uns bekämpfen zu müssen"
Fischer: Heißt das, wir werden als angeblich so tolerante Gesellschaft dann doch zu schnell hysterisch? Wenn ich Sie höre, dann könnte ich den Eindruck gewinnen, die Ethik der Abwendung ist auch eine Art, ein wenig Dampf aus der Diskussion zu nehmen, nicht immer gleich den Untergang des Abendlandes auszurufen, wenn eine Muslima das Kopftuch nicht ablegt. Ist es das, ein bisschen auch eine Strategie der Deeskalation?
Strasser: Ja, genau das ist damit gemeint. Besser könnte ich es auch kaum ausdrücken. Es geht nämlich darum, dass unsere Gesellschaften ursprünglich der Ansicht waren, wir sollten immerfort miteinander diskutieren. Ich erinnere an diese Idee, dass man im Diskurs sozusagen eine Art zwanglosen Zwang hat, das heißt, es gilt nur der Zwang des besseren Arguments. Da ist nichts Handgreifliches im Spiel, da ging es nur um das vernünftige Sich-aufeinander-zu-Bewegen, aber das geht nicht immer in Gesellschaften. Und wo es nicht geht, dort ist es dann wirklich Teil einer, ja, wenn man will noblen Gesinnung zu sagen, schön, hier geht es nicht weiter, wir können uns auch so verständigen, dass wir uns miteinander eben inhaltlich nicht verständigen, das heißt, wir können noch miteinander reden, ohne uns bekämpfen zu müssen.
Fischer: Ich finde diesen Zwang zur Hinwendung, von dem Sie oft sprechen, sehr interessant, weil ich mir gedacht habe, vielleicht lässt sich so dieses Phänomen der Querdenker verstehen – Querdenker jetzt im neuen Sinne von Corona-Leugner. Das sind skeptische Menschen, die die Erkenntnis der Wissenschaft leugnen, ob nun bei Corona oder in anderen Bereichen. Vielleicht ist das gar kein inhaltliches Nichtübereinstimmen, sondern vielleicht ist das bei diesen Menschen eher ein Widerstand gegen einen großen Konsens, der den Betroffenen vielleicht zu groß, zu harmonisch, zu überwältigend scheint, so eine Art Reaktanz, wie man es aus der Psychologie kennt. Würden Sie zustimmen?
Strasser: Ja, ich würde mit Vorbehalten zustimmen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Sie völlig zu Recht bemerkt haben, Querdenker, das war früher ein Prädikat positiver Art. Man hat immerfort in den Medien nach den Querdenkern gesucht, die der allgemeinen Meinung widersprochen haben, aber mit Argumenten. Nun ist da aus dem Querdenker plötzlich etwas, wo man das Gefühl hat, das ist eine Rotte von Leuten, die schreiend durch die Gassen rennen und die Politiker beschimpfen, und da zwischendrinnen sitzen dann schon die Nazis, die da fleißig mitmachen. Es mag durchaus der Fall sein, wie Sie sagen, dass das eine Reaktion darauf ist, dass eine Art common sense über die Politik jetzt, zumal auch wegen Corona, vorgespiegelt wird und der Bevölkerung draufgedrückt wird, dass es also viele Leute gibt, die dann sagen, vielleicht auch aus ihrer Isolation heraus, nein, das wollen wir nicht, wir wollen das nicht. Natürlich ist das irrational, wie wir wissen, aber es gibt einen Grund, und der zeigt, dass hier eine Balance verlorengeht – einerseits zwischen der Zuwendung, die notwendig ist, und dem Hören auf gute Argumente und andererseits der Möglichkeit, sich auch aus dem Diskurs zurückzuziehen.
"Ein System der Unterdrückung, genannt Political Correctness"
Fischer: Blicken wir doch mal auf die andere Seite des politischen Spektrums, bei dem wir jetzt gerade schon mal an die Rechten gedacht haben, ich meine, die identitätspolitische Linke: Man könnte ja sagen, es gibt da schon ein Set von neueren Regeln, die unser Zusammenleben jetzt neu gestalten wollen, insbesondere das Zusammenleben in der multikulturellen Gesellschaft, mit dem Ziel, möglichst viele zu integrieren, wenige zu verletzen, Menschen natürlich auch sprechen zu lassen. Es gibt diese Trigger-Warnings, es gibt Save Spaces, das scheinen mir doch alles schon Techniken zu sein, die ein bisschen Distanz schaffen wollen. Aber jetzt lese ich bei Ihnen, Sie sprechen sogar von Denunziantentum. Warum diese harsche Ablehnung dieser neuen Regeln?
Strasser: Diese Regeln, die unter Political Correctness ja bekannt sind und an den Hochschulen auch natürlich ganz besonders beliebt, vielleicht nicht, aber ganz besonders gefordert werden, die haben einen merkwürdigen Effekt: Sie sind nämlich entstanden eigentlich aus der Überlegung, dass man die Schwachen schützen sollte vor den Starken, die sie beleidigen, die sie kleinmachen und so weiter und so fort, auch schützen sollte vor Ausdrücken, die beleidigend sind und alles das. Aber jetzt ist daraus eben eine Bewegung geworden, die alle, die nicht mitmachen wollen – beim Gendern oder bei anderen Dingen –, alle die werden gezwungen, hier auf eine Linie zu gehen, andernfalls werden Sanktionen ins Auge gefasst. Das ist das Problem, dass aus einem Versuch, die Schwachen zu befreien aus ihrer Position, geworden ist eigentlich ein System der Unterdrückung, genannt Political Correctness. Es kann doch nicht sein, dass man Leuten, die ihre Diplomarbeit nicht durchgendern wollen, obwohl sie über das Thema schreiben vielleicht, der Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass man die dann zwingt, es zu tun, ansonsten wird die Arbeit nicht benotet. Das passiert aber bei uns an den Universitäten, und deswegen habe ich diese eher stärkere Ausdrucksform benützt.
Fischer: Aber ist das von Ihrer Seite jetzt nicht immer noch sehr aus einer Perspektive der Mehrheit oder eben, wie Sie vielleicht sagen, der Starken gedacht?
Strasser: Ich glaube nicht. Ich glaube, mittlerweile hat sich das gedreht. Wir haben im öffentlichen Dienst – das wird in Deutschland so sein und in Österreich ist es so – zum Beispiel die Verpflichtung, dass alle Dokumente, die ausgefertigt werden, alle Schriftstücke durchgegendert sein müssen. Ich habe ja gar nichts gegen das Gendern. Jetzt haben wir bereits drei Varianten des Genderns: Wir haben das Männliche, das Weibliche und das X. Es soll den Personen freigestellt werden, welche Variante sie wählen, aber im Dokument muss man darauf achten, dass hier alles so steht, dass das ja dem offiziellen Strom der Diskussion, wie sie von bestimmten Leuten vorgegeben wird und der Political Correctness entspricht. Also ich kann nicht sehen, dass hier den Schwachen noch geholfen wird. Die Situation hat sich mittlerweile eben geändert, und es wird den Leuten, die da nicht mitmachen wollen, auch nicht gestattet, rauszugehen aus der Situation.
Fischer: Das heißt, da sind wir wieder an so einem Punkt, der, der sich abwendet und vielleicht gar nicht abwendet als jemand, der den anderen verachtet oder ihm die Diskussionsfähigkeit abspricht, der, der sich abwendet, der ist dann eher der Drückeberger, der Verräter, der Diskursflüchter, der Böse.
Strasser: Ja, genauso ist es. Ich habe Studentinnen, die bei mir Dissertationen geschrieben haben, aber ihre Arbeiten nicht durchgendern wollten, weil sie ein bestimmtes Stilempfinden hatten, dann geraten, sie sollen in einem Vorwort vermerken, dass sie die Arbeit nicht durchgendern aus diesen oder jenen Gründen. Mehr kann man nicht machen, aber immerhin, das konnte man noch machen. Nur ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das nicht akzeptieren und dann unbedingt ihren Standpunkt hier durchsetzen wollen, das heißt, keinen mehr rauslassen wollen aus dem System, das einmal eingeführt wurde und auf einer Engführung basiert, auf einer Engführung, die einst fortschrittlich war und jetzt aber eigentlich ins Gegenteil kippt.
"Was es zu bekämpfen gilt, ist der Rassismus in seiner tatsächlichen Form"
Fischer: Mir fällt dabei ein, es gibt so Antirassismusfragebögen, die sind in der guten Absicht geschrieben, dass man sich seiner eigenen Privilegien, seiner eigenen Blase, in der man lebt, bewusst wird, und da tauchen dann oft so Fragen auf, wie viele Menschen kennst du, die Wurzeln im Iran, in Vietnam, in Syrien haben zum Beispiel. Ich begreife den guten Willen hinter dieser Frage, aber ich frage mich dann, bin ich jetzt aufgefordert, in meinem Privatleben meinen Freundeskreis so zu strukturieren, dass ich mich nach außen als Weltbürger verkaufen kann. Ist das nicht eine extreme Form des Zwangs zu einer Hinwendung?
Strasser: Ich sehe, wenn das so gehandhabt wird, dann diesen Zwang natürlich. Ich meine, es ist meine Angelegenheit, wie viel Bekannte ich aus anderen Kulturen haben möchte oder auch haben kann. Das ist zum Teil auch eine Frage der Gelegenheit und der Bildung. Wenn ich an der Universität bin und ein Auslandssemester mache, dann werde ich Bekannte aus anderen Kulturen haben und diese Kontakte auch weiterpflegen. Aber es gibt viele Leute, die diese Gelegenheit gar nicht haben. Was es zu bekämpfen gilt, ist der Rassismus in seiner tatsächlichen Form, das heißt, der Versuch von Leuten – und das sind nicht immer nur Leute mit wenig Bildung –, andere Menschen, die nicht unsere kulturellen Präferenzen teilen, runterzumachen, sie schlecht zu machen, sie abzudrängen oder gar nicht reinzulassen. Diese Fragebögen, das ist ein Ausdruck von – wenn die ernst gemeint sind und wenn die irgendwelche Folgen haben sollten – eben dieser Political Correctness, die übersteuert ist.
"Man hat gelernt, dem anderen freundlich zu begegnen"
Fischer: Es sind nun gerade die jungen Menschen, die solche neuen Regeln sehr befürworten. Wie schätzen Sie denn die Ethik der Abwendung ein, wenn es um diese unterschiedlichen Generationen geht? Sie selber meinen zum Beispiel, es könnte ein Vorschlag sein, wieder mehr in die Bibliotheken zurückzugehen, sich dort zu bilden. Sie haben mir gesagt, Sie bezeichnen sich als Hocker. Viele junge Menschen gehen ja vielleicht gar nicht mehr so sehr in die Bibliothek, die sind ständig im Netz, die suchen Anschluss, die müssen sich beruflich behaupten, die brauchen einfach noch viel mehr als ältere Menschen, glaube ich, den Kontakt und können da auch nicht mehr so schnell austreten, weil die dauernd online sind mitunter. Würden Sie sagen, die Ethik der Abwendung ist für junge Menschen doch viel schwieriger?
Strasser: Nur dann, wenn man davon ausgeht, dass es tatsächlich eine Ethik ist. Ich hatte ursprünglich eigentlich das Wort Ethik gar nicht verwenden wollen, sondern eher den mir auch nicht besonders sympathischen Ausdruck Lebenskunst in den Titel setzen wollen. Das wollte der Verlag dann nicht, weil Ethik halt besser klingt. Es kann hier keine allgemeinen Regeln geben. Es gibt wahrscheinlich junge Leute, die sind froh, dass es die Dating-Portals gibt, weil sie sind allein. Das hat natürlich seine Berechtigung, und warum sollten die sich umdrehen und weggehen, die suchen ja jemanden. Wir haben aber das Problem, dass in unseren Gesellschaften immer stärker eine Verbissenheit um sich greift zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen, zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, zwischen verschiedenen Ansichten, wie man mit Corona umgeht. Mittlerweile haben die Kirchen, die christlichen Kirchen zumindest, längst begriffen, dass es so etwas wie eine Ökumene geben muss, das heißt, man trifft sich, man spricht miteinander, man weiß, dass man sich am Schluss nicht einigen wird, aber man hat gelernt, dem anderen freundlich zu begegnen. Auch das ist eine Möglichkeit, vom Dogma wegzugehen, sich umzudrehen, aber sich dem Menschen als einem Wesen, das eigentlich freundlich gesinnt ist, zuzuwenden.
Fischer: Wo Sie die Kirchen gerade ansprechen: Man könnte ja sagen, unsere Kultur hat ein reiches Reservoir an Techniken der Selbstbescheidung, der Askese, des Rückzugs, wenn wir an Mönche, Nonnen, an Kloster nur im Christentum denken, wenn wir vielleicht auch an mystische Traditionen im Islam denken. Warum muss denn jetzt Peter Strasser kommen und uns wieder so eine Art Abwendungslebenskunst beibringen, ist da zu viel verloren gegangen?
Strasser: Das Eigenartige ist, während wir jetzt sprechen, habe ich den Blick auf eine Kirche. Diese Kirche hat ein Kloster im Anschluss, und das Problem des Klosters ist, es steht leer. So. Und so geht es den Klöstern allerorten. Das heißt, die Klöster sind überhaupt keine Rückzugsorte mehr für junge Leute, sondern es sind diese Wellness-Oasen, die Orte der Stille versprechen, und solche Sachen. Das sind modische Formen des Rückzugs, die man sich leisten kann, wenn man viel Geld hat, und das sind Statussymbole von Leuten, die zeigen wollen, wir können auch einmal oder wir wollen und müssen einmal aus unserem Stress heraus und müssen einmal ein, zwei Wochen ausspannen. Die Klöster machen das zum Teil mit, aber nur einige ausgewählte Klöster im Ausland, wo wir im Augenblick ohnedies nicht hinfahren können, um dort dann ihre Gäste unterzubringen. Die sitzen dann halt in ihrer, was weiß ich, in ihrer Klause und schauen vor sich hin und kommen dann geläutert wieder zurück, wie sie denken, obwohl das alles – ich jedenfalls – unter diesen Begriff der Wellness subsummieren würde, der längst ein Geschäft geworden ist.
"Es gibt Situationen, in denen wir absolut aufgefordert sind, uns nicht abzuwenden"
Fischer: Gibt es eigentlich Grenzen einer solchen Lebenskunst der Abwendung, gibt es Themen, bei denen Sie sagen würden, nein, hier funktioniert das nicht, hier kann und soll man sich nicht abwenden?
Strasser: Ja, natürlich, es gibt Grenzen, in denen einfach die Pflichtethik, die schlichte Pflichtethik greift, wie wir sie in unserem – muss man schon sagen – noch immer christlichen Kulturkreis kennen. Da gibt es eben einen Imperativ der Caritas, dass man Leuten, die flüchten, dass man denen hilft und nicht einfach zynisch sagt, ja, bitte schön, um die brauchen wir uns eigentlich nur insofern zu kümmern, als wir dort Hilfsgüter anliefern. Und wie die dann verteilt werden, das ist dann Landessache. Also es gibt Situationen, in denen wir absolut aufgefordert sind, sofern wir überhaupt noch ethisch denken wollen, uns nicht abzuwenden, nicht wegzugehen. Im Gegenteil, hier müssen wir Zuwendung optimieren, die im Augenblick verloren geht, aber das hängt von der jeweiligen Regierung ab. Da ist Deutschland besser im Augenblick dran gewesen, an der Humanität, an der humanitären sozusagen Strömung, als es Österreich war.
Fischer: Wie sieht das aus, würden Sie sagen, eine Ethik der Abwendung ist vielleicht tendenziell eher etwas für den privaten Bereich? Sie schreiben ja auch viel über die Ehe, über die Liebe, und wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann wendet man sich ab. Das kann man, weil es nicht gleich um das große gesellschaftliche Ganze geht. Oder doch?
Strasser: Na ja, es ist eine Sache, die eben nicht nur den Privatbereich betrifft. In erster Linie geht es darum, dass Menschen, die zusammenleben, aber nicht mehr zusammenleben können, weil sie einander nicht mögen, weil sie einander hassen oder weil einer der beiden Ehepartner – meistens ist das der Mann – gewalttätig wird, dass hier die Möglichkeit geschaffen wird, dass solche Beziehungen auch auseinandergehen können. Sodass noch beide Teile in irgendeiner Form eine weitere Existenz zu führen imstande sind. Aber damit das geht, brauchen sie Gesetze, und hier kommt der Staat ins Spiel. Der Staat als Gesetzgeber muss eben auch beachten, dass er Privatverhältnisse vor sich hat, in denen ein friedliches Miteinander nur möglich ist, wenn sie die entsprechenden rechtlichen Regelungen haben. Und die sind allerdings seit gar nicht so langer Zeit nun tatsächlich weitgehend geschaffen. Man hat die Art und Weise, wie die Kinder dann zu Mutter oder Vater kommen und wie Geldflüsse dann bei der Erziehung der Kinder zu laufen haben, das alles ist gesetzlich geregelt. Erst diese gesetzliche Regelung, die ja nicht privat ist, ermöglicht es im Privaten, diese unbedingt notwendige Abwendung zu vollziehen, damit nicht der gegenseitige Hass zu schrecklichen Auswirkungen führt.
Fischer: Ist am Ende die Ethik der Abwendung auch eine Ethik, die eine gewisse Stärke einfach braucht, die vielleicht nicht jeder hat, ist es insofern eine Luxusethik?
Strasser: Das Wort Luxus gefällt mir nicht, ansonsten würde ich sagen, es ist eine Ethik, die schon eine gewisse Fähigkeit zur Reflexion auch voraussetzt, abgesehen davon, dass ein gewisser Mut vorhanden sein muss. In vielen Situationen bedarf es eines gewissen Mutes, um einfach wegzugehen, um sich abzuwenden und nicht einfach mitzuklatschen, mitzumachen, bei den Massen mitzumarschieren. Das hängt zu einem gewissen Grad, aber nicht nur, vom Bildungsstand, glaube ich, ab, also eine gewisse Bildung ist nicht schlecht für eine derartige Lebenskunst.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.