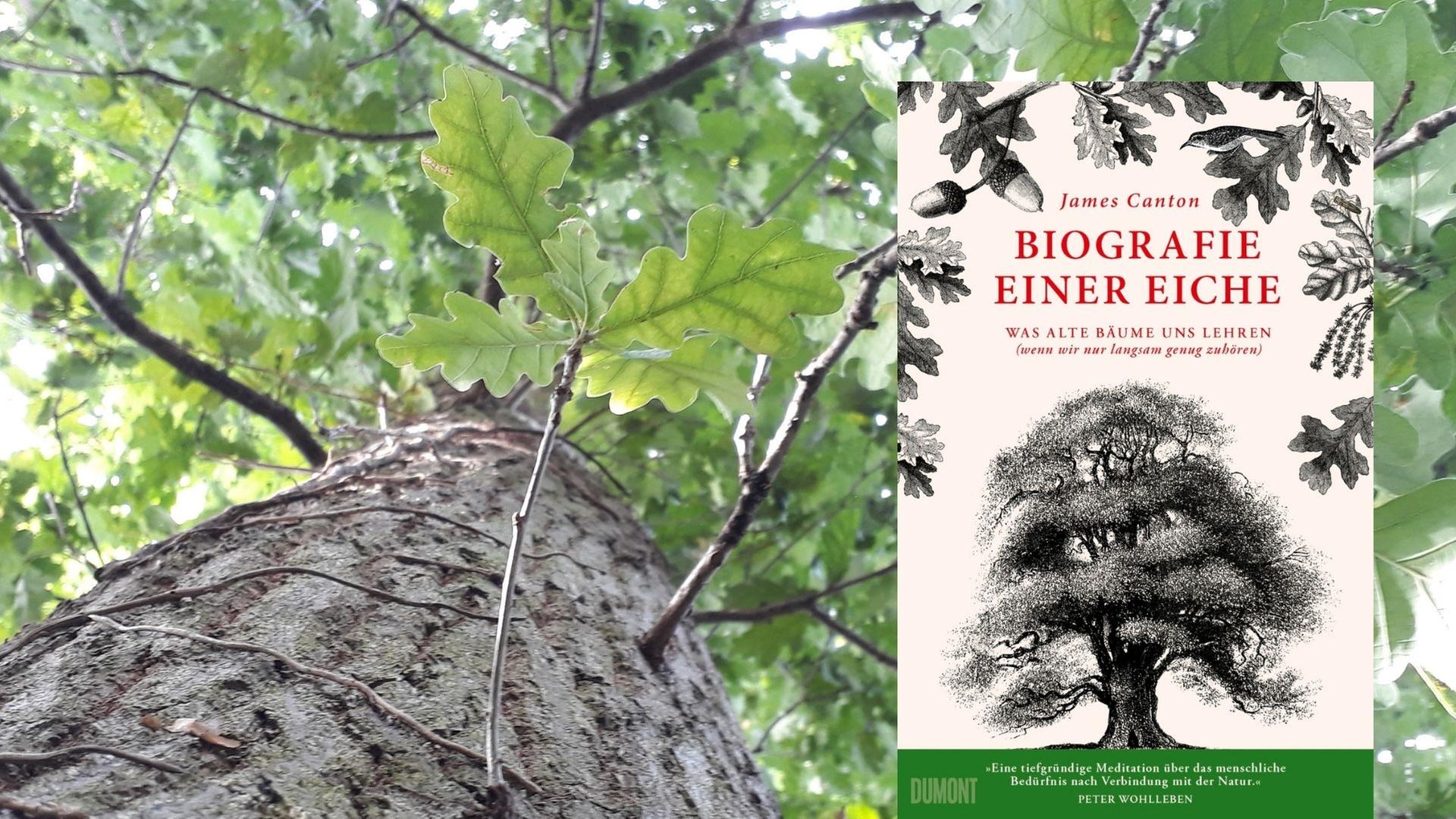Was ist Landscape Writing ? In welcher Sprache sprechen wir, wenn wir über die Zerstörung der Landschaften reden? Passt diese Sprache zu den Problemen, die wir mit dem Klimawandel haben? Die Literatur eröffnet andere sprachliche Zugangsweisen zu Natur, Landschaft, ökologischen Lebensräumen. Das dichterische Sprechen, im Sinn eines ecocriticism, wird hier zur Gegensprache und beleuchtet die Formelhaftigkeit und das anthropozentrische der Umweltdebatten.
Essayist Volker Demuth fragt, ob die mediale Dauerthematisierung nicht eine wirkungsvolle Sozialtechnik „des sehenden Verbergens, des sprechenden Beschweigens“ ist, wie er in der "Zeit" las.
Landscape Writing - brauchen wir eine ökologische Poetik?
Ein Essay von Volker Demuth
Werfen wir zu Anfang den Blick auf eine Late-Night-Talkshow, so, als klickten wir durch eine Mediathek.
Werfen wir den Blick also auf ein mediales Format, in dem Politik und Gesellschaft zur allmählichen Verfertigung der öffentlichen Meinung zusammengeschaltet werden:
Am Vorabend der jüngsten Bundestagswahl antwortete da auf die empörte Frage einer jungen Klimaaktivistin – Luisa Neubauer –, weshalb Klima- und Umweltpolitik kaum eine Rolle im Wahlkampf spielten, ein junger, aufstrebender Politiker – Kevin Kühnert – mit dem bemerkenswerten Satz:
„Wir haben keine Sprache für die Klimakrise.“
Fehlt es dem Zeitalter des Ökozids, der Vernichtung unzähliger Lebewesen und Lebensräume, also an einer angemessenen Redeweise für die nichtmenschliche Mitwelt, für die ausgebeuteten Landschaften und die destabilisierten Klimazonen? Umgibt uns denn nicht rund um die Uhr die Rede von biologischem Massensterben, der schmelzenden Arktis und Temperaturrekorden? Von Extremwetter, Klimapfaden, Kipppunkten, Keeling-Kurve, planetaren Belastungsgrenzen?
Trotzdem wachsen nach Jahrzehnten derartiger Krisenterminologie berechtigte Zweifel: Erreicht uns, als einzelne und als Gesellschaft, diese Sprache? Oder gibt es da etwas, das wie eine Blockade wirkt? Ist Umweltkrise auch Sprachkrise?
Der isländische Autor und Kandidat der vorletzten Präsidentschaftswahl Andri Magnason sieht die Hindernisse in der Dimension des Problems. Er schreibt:
Die Bedrohungen unseres globalen Lebensraums „übersteigen all unsere bisherigen Erfahrungen, sie übersteigen die Sprache und die Metaphern, die wir benutzen, um unsere Realität zu verstehen. (…) Bei einer so unendlich großen Sache, die dazu noch die Grundlage unseres Lebens ist, reagieren wir nicht angemessen. Als könnte unser Gehirn ein solches Ausmaß nicht erfassen.“
Ganz ohne Zweifel hat sich der menschliche Handlungsbereich, in geschichtlichen Zeiträumen betrachtet, noch nicht lange durch die Technosphäre ungeheuer ausgeweitet. So weit, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns durch räumliche Fernwirkungen oder zeitliche Skaleneffekte unmöglich zu erfassen und uns vorzustellen imstande sind. Der Technikphilosoph Günther Anders bezeichnete das als „prometheische Scham“: Wir können uns einfach nicht vorstellen, was wir herstellen können, ob Atombombe oder ökologische Vernichtung.
Damit jedoch beginnt unsere Unfreiheit, indem Menschen gegen ihre eigenen Lebensinteressen und die ihrer Nachkommen handeln. Tatsächlich machen wir Dinge, von denen wir sinnvollerweise nicht wollen können, dass wir sie tun: Wir verhalten uns gegenüber dem Leben auf der Erde hochgradig zerstörerisch. Als stünden wir unter einem rätselhaften, irrwitzigen Bann.
Nur, obschon sich das schwerlich abstreiten lässt, könnte man doch denken, die Präzision und Reichweite wissenschaftlicher Studien würden hier Abhilfe schaffen. Wenn die immensen Folgen auf der Grundlage von Fakten deutlich werden, müsste sich doch die Richtung unseres kollektiven Tuns ändern.
Dieser Auffassung zeigt sich eine Generation, deren Lebensspanne das gesamte 21. Jahrhundert durchmessen wird. Von Hunderttausenden bei Demos von Fridays for Future vehement vorgebracht, ist es durch sie geradezu zum Mantra dieser Jahre geworden: Wir alle sollen auf die Wissenschaft hören. Doch ist das wirklich der Königsweg? Bietet sich durch Erhebung empirischer Daten und informatischer Modellierungen eine Lösung für die Kultur umweltzerstörerischer Handlungsmuster?
Zwei Zahlen, ebenfalls wissenschaftlicher Herkunft, stimmen skeptisch. 2021 stieg hierzulande trotz gesunkenem Flugaufkommen und gedrosselter Wirtschaft der Ausstoß an Klimagasen um vier Prozent. Und im gleichen Jahr erbrachte eine Studie, dass 80 Prozent der 14- bis 29-Jährigen keinesfalls auf ihr Auto und beinahe Dreiviertel nicht aufs Fliegen verzichten wollen. Dieselbe Generation, die fordert, auf Wissenschaft zu hören, ist nicht bereit, deren Erkenntnissen zu folgen. Was kommt da nicht an? Oder verlängert sich hier gerade ein Problem, das man als eine Art Geburtsfehler der Wissenschaft ansehen kann, zumindest als ein ernsthaftes Handicap?
Um das zu beantworten, müssen wir zurückblenden. Im 18. Jahrhundert trennt sich die Wirklichkeit in eine objektive, von Wissenschaften erforschte Empirie und in eine subjektive, von Dichtung vermittelte Erfahrungswelt. Das gilt insbesondere für die Natur und Landschaft. Die einzigartige Erfahrung, das, was Landschaften in Menschen auslösen, hat in der bewusst gefühllosen Untersuchung durch Wissenschaften nichts zu suchen. Das Individuum, die subjektive Wahrnehmung, fällt aus dem Bild, das Wissenschaft von Landschaften erzeugt, methodisch heraus. Naturwissenschaftliche Sprache will ohne ein besonderes Ich auskommen, das spricht, wahrnimmt und erkennt. Man kann sagen, die Schrift der Natur wechselt das Alphabet.
Die epochale Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Wie kann eine Wissenschaft, die das Individuelle und Menschliche ausschaltet, Landschaften und Naturräume abbilden, welche für menschliches Leben tauglich sein könnten? Wenn strikt davon abgesehen wird, was Landschaften mit uns machen, wie sollen wir ein angemessenes Wissen davon entwickeln, was wir mit der Landschaft machen dürfen und was nicht? In dieser Frage steckt noch eine weitere gravierende Schwierigkeit.
Denn die Wissenschaft der Landschaft und die optimale Nutzung von Landschaften gehen seit der sogenannten Aufklärung eine bis in unsere Gegenwart tragende Verbindung ein. Dabei verbirgt sich in der wissenschaftlichen Vorstellung von Natur bereits ein Motiv der Bemächtigung, von dem man schon früh ein Bewusstsein ausgebildet hat. Die Erforschung natürlicher Abläufe wird als Grundlage dafür erkannt, bestimmte Prozesse selbst in die Wege leiten, manipulieren und gewünschte Ergebnisse herbeiführen zu können. Natur lässt sich, heißt das, bei genügender Erkenntnis durch Menschen steuern.
Der französische Aufklärer Buffon formuliert es in seiner Histoire naturelle so: Der Mensch „befiehlt allen Geschöpfen“ und ist aufgrund seiner Wissenschaft ermächtigt, „eine neue Natur“ zu erschaffen. Diese Leitformel wird insbesondere für die Wirtschaft wichtig. Die Verwertung von Landschaften, die aufgrund moderner Techno-Wissenschaft optimiert wird, stellt Ertragsinteressen in den Vordergrund. Seither bilden Zahlen, Formeln und Diagramme die Grundlage für unentwegte Produktionssteigerungen, die Landschaften abverlangt werden, bis dahin, wo die Ausbeutung in unumkehrbare Zerstörung übergeht.
In welcher Sprache sprechen wir also, wenn wir über die planetarische Verheerung der Landschaften reden? Passt diese Sprache zu den Problemen, die wir mit dem Klimawandel haben? Sicher ist: Die öffentliche Sprache der Umweltkrise wird selbst nie zum Thema, obwohl wir in anderen Gesellschaftsbereichen, zum Beispiel Gender, Kolonialismus, Rechtspopulismus, genau und zu Recht die Sprache kritisch in den Mittelpunkt stellen.
Neben der Wissenschaft gibt es allerdings noch einen zweiten Sprachraum, in den ein Blick zu werfen ist: die mediale Öffentlichkeit. Die Diskursivierung der ökologischen Krise ist weit vorangeschritten, sowohl wissenschaftlich wie medial. Das will heißen, es wird viel und ständig darüber geredet. Dabei haben sich die Gesellschaften an ein Muster gewöhnt, das in etwa so aussieht:
Es herrscht ein Alarmismus durch ständig noch gefährlichere Entwicklungen, noch bedenklichere Zahlen, noch erschreckendere Bilder. Experten erklären, in wenigen Jahren bereits werde es zu spät sein, der selbstzerstörerischen Entwicklung Einhalt zu gebieten, aber noch bestehe eine Chance.
Dieses mediale Setting wird seit mehreren Jahrzehnten gespielt. Das Spiel der Panik reiht sich dabei ein in die Erregungsprozeduren heutiger Medienwirklichkeit. Doch es ist wie mit der Geisterbahn: Man erschrickt nur beim ersten Mal so richtig. Der Schock der Berichte nutzt sich ab, die Katastrophenbilder verblassen. Entgegen ihrer Absicht aufzurütteln, führen angstgeleitete Mechanismen der Problemverarbeitung hauptsächlich dazu, dass wir eine Distanz herstellen, durch die es gelingt, eine vermeintlich souveräne Sachlichkeit, einen Übersättigungsüberdruss oder schlichte Resignation zwischen unser Leben und dessen massive Gefährdung zu schieben.
Das Verschweigen, Abschirmen und Verdrängen ist in der Dauerthematisierung aktiv. Hinzu kommt, um den Pegel der Aufmerksamkeit hoch zu halten, gerät man unweigerlich in die Spirale der Sprachvernutzung hinein. Aus prägnanten Begriffen wird phraseologischer Öko-Sprech: Klimakatastrophe, Nachhaltigkeit, umweltschonend, zukunftsfähig und so weiter. Jeder – ob Wirtschaftsführer, Politikerin, Umweltaktivist oder Klimawandelleugnerin – kann sie in seinem und in ihrem Sinne benutzen. Der Sinn der Wörter versauert dabei wie die Meere durch CO₂.
Niemand wird sich daher wundern, wenn sich im Rahmen moderner Mediengesellschaften die Sprache als ein Teil des Problems erweist. Wie groß jedoch muss die Verzweiflung inzwischen sein, wenn unlängst aus der Politikredaktion der ZEIT an die Literatur die Aufforderung ergeht, „zur Hölle“ noch mal endlich Ökokrisentexte zu verfassen.
Der Auftrag, wie ihn Bernd Ulrich formuliert, drängt die Schriftsteller zu Werken, „die von der ökologischen Katastrophe handeln, (…) die sich bislang ungebremst entfaltet und so oder so das Leben der Menschen zutiefst verändern wird“.
Natürlich hätte ein Blick in die neuere Dichtung des Landscape Writing genügt, um zu sehen, wie leidenschaftlich Autoren längst von dieser Problematik umgetrieben werden. Von ökologischer Verödung, ausbeutender Verwüstung und Zerstörung ausgewogener landschaftlicher Lebensräume, aus denen sich Profit generieren lässt.
Bei Peter Huchel, dem 1971 aus der DDR in die BRD übergesiedelten Lyriker, ein Menetekel über die Systemgrenzen hinweg, liest man:
„Die Öde wird Geschichte.
Termiten schreiben sie
Mit ihren Zangen
In den Sand.
Und nicht erforscht wird werden
Ein Geschlecht,
Eifrig bemüht,
Sich zu vernichten.“
Termiten schreiben sie
Mit ihren Zangen
In den Sand.
Und nicht erforscht wird werden
Ein Geschlecht,
Eifrig bemüht,
Sich zu vernichten.“
Doch selbst wenn die Funktion der Kassandra mittlerweile nicht schon ziemlich überbeansprucht wäre, könnte es sich bei dem Wunsch nach literarischen Begleittexten zur Katastrophe doch um ein grundsätzliches Missverständnis handeln.
Landscape Writing? Worum geht es da? Selbsterklärend um Landschaft. Dabei ist Landschaft jedoch nicht Natur an sich, nicht reine, unberührte Ursprünglichkeit, sondern ein wechselseitiges Beziehungsgeflecht natural-sozialer Lebensbereiche, von denen das Leben insgesamt getragen wird. Getragen nicht allein im Blick auf Ernährung, mehr noch auf die naturbasierte Qualität des Lebens überhaupt: Wasser, Luft, Klima oder der Fortbestand einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Mit einem Wort: unser evolutionäres Erbe.
Was auch immer man in Landschaften rund um den Globus sieht, sie stellen nicht bloß ein Thema unter vielen anderen dar. Nicht zuletzt der Dichtung drängt sich Landschaft als Kernfrage derzeitiger Zivilisation literarisch auf, weil die Verstädterungszonen gerade mal drei Prozent der Erdoberfläche bedecken, obschon sich die Hälfte der Weltbevölkerung in diesen Städten zusammenballt und man davon ausgehen muss, in wenigen Jahrzehnten werden es bereits dreiviertel aller Menschen sein.
Das bis in die feinsten Lebenskapillaren hinein vernetzte Land-Stadt-Gefüge umreißt den ökologischen Horizont, worin literarisches Schreiben über Landschaften in diesem geschichtlichen Augenblick stattfindet. Poetische Landschaften werden, vor dem Hintergrund einer sich in ihren Lebensgrundlagen selbst beschädigenden Menschheit, zur Schnittstelle von Ästhetik und Ökologie. Einer Schnittstelle, die beides ist: Verbindung und Wunde.
Seit der Antike, seit Theokrits Idyllen und Vergils Bucolica, ist Landschaftsdichtung ein ins kulturelle Gedächtnis eindringender Ausdruck menschlicher Begegnung mit dem nichtmenschlichen Leben. Landschaftspoesie als jeweils besondere sprachliche Wahrnehmung zeichnet die komplizierte Geschichte des Verfehlens und des Fremdseins auf, aber auch des Geborgenseins und der Euphorie, die sich in dieser Begegnung ereignen.
Leicht sieht man, wie sich dabei die subjektive künstlerische Wahrnehmung allen Überlegungen von Nutzen und Gewinn entzieht, um eine Erfahrung zu triggern, welche die irisch-englische Autorin Iris Murdoch „selbstlose Aufmerksamkeit“ nennt.
„Ein Hagel aus Feuerschwanz-(mi)-Finken ins Saatgras hinein
blitzt fütternd auf (mi) in Grautönen und roten, reimenden Prisen.
(…) Leben ohne Tod, nur Furcht, keine Ergebnisse, nur Achtsamkeit –
alle wieder hochgesaugt, auf tiefe Äste, von einem Wechsel im Licht,
Gegenwart und mehr Gegenwart bringt den Schritt, der Grillenzirpen bricht.“
blitzt fütternd auf (mi) in Grautönen und roten, reimenden Prisen.
(…) Leben ohne Tod, nur Furcht, keine Ergebnisse, nur Achtsamkeit –
alle wieder hochgesaugt, auf tiefe Äste, von einem Wechsel im Licht,
Gegenwart und mehr Gegenwart bringt den Schritt, der Grillenzirpen bricht.“
Die achtsame, sinnlich begeisterte Hinwendung zur Landschaft, wie man sie beim Lesen des australischen Lyrikers Les Murray erfährt, ist eine Form natural-sozialer Begegnung, bei der man sich als Mensch selbst zurücknimmt. Ein Moment humaner Souveränität, auch – so meint Iris Murdoch – wenn viele „darüber erstaunt wären, dass (…) das Beobachten von Turmfalken irgendetwas mit Tugendhaftigkeit zu tun hätte“. Doch Tugend, das gute Leben, umfasst für sie „die Qualität all unserer Beziehungen zur Welt“.
Ist es das, was Landscape Writing bei Philippe Beck, der in Paris lebt und schreibt, zum „moralischen Stück“ macht, ohne im mindesten moralisierend, politisch agitierend oder ökoaktivistisch zu sein?
„Überrest singt also eine weise, die
erzählt die geschichte der brücke.
Stück von Schlichtem, hartes schilf, singt allein,
wegen eines hauchs,
eines ländlichen.
Moralisches stück.
durch ländlichkeit.
Wahrheit ist aufgedeckt.
Bruder des Abends gesteht es.“
erzählt die geschichte der brücke.
Stück von Schlichtem, hartes schilf, singt allein,
wegen eines hauchs,
eines ländlichen.
Moralisches stück.
durch ländlichkeit.
Wahrheit ist aufgedeckt.
Bruder des Abends gesteht es.“
„Wahrheit ist aufgedeckt“, in Lebenslandschaften, die als ein Du, als das Andere von uns selbst, angesprochen und als unfassbar wundersame, fantastisch lebendige Welt spürbar werden.
Spätestens an dieser Stelle ist es lohnenswert, danach zu fragen, ob es neben dem ästhetischen Reiz und der Schönheit solcher Literatur auch einen gesellschaftlichen Mehrwert gibt? Eine der hartnäckigsten Überzeugungen von Politikern und Ökonomen besagt, es bedürfe lediglich bestimmter Anreize und Angebote, um bei Menschen Verhaltensänderungen zu bewirken. Umso erstaunter zeigt man sich, wenn das, wie sich mittlerweile herausstellt, nicht wirklich funktioniert. Die Leute fliegen weiterhin, man isst Fleisch und beharrt auf gewohnten Konsumstilen.
Aus welchem Grund fällt es so schwer, auf all die ökologischen Fehlentwicklungen mit einer angemessenen Veränderung unseres Handelns und unserer Lebensweise zu reagieren? Weil es der menschlichen Natur entspricht, sich in Stereotypen und Routinen einzubunkern und sich hinter den Barrikaden altbewährter Weltvorstellungen zu verstecken? Bleiben wir also, wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen glaubte, unverbesserliche „rational fools“?
Wahrscheinlich überschätzt man Individuen tatsächlich, womöglich schätzt man sie aber auch bloß falsch ein, wenn man sie als Akteure einstuft, die nach weitsichtigen Vernunftmaßstäben handeln. In Wahrheit sind sie sinnlich, spielerisch, emotional, spontan, offen, freihändig und manchmal auch lustbetont anarchisch. Genau wie gute Gedichte.
Anstatt wissenschaftlicher Objektivierung und rationaler Distanzierung, die natürliche Lebewesen zu brauchbaren oder unbrauchbaren Gegenständen verwandeln, entfaltet Literatur eine gleichzeitig sinnliche, emotionale und geistige Begegnung. Wir beginnen uns dabei zu fragen, was spüren, hören, riechen wir, wenn wir uns in bestimmten Landschaften aufhalten? Wo öffnen oder verschließen sich unsere Sinne?
Denkwürdig macht die subjektive poetische Sprache aber noch etwas Weiteres: Wie nehmen wir wahr, und wie wird, was wir wahrnehmen, zu dem, was ist, was unsere Realität ausmacht? Damit rührt Dichtung an eine grundlegende Erfahrung: Weltwahrnehmung und Weltbewahrung hängen aufs Engste zusammen. Was mir nicht nahegeht, geht mich nichts an. Was mich nicht berührt, kann leicht von mir weggeschoben werden. In andere Kontinente, in die Zukunft, irgendwohin.
Literatur ist immer auch Sprache, die sich selbst beobachtet. Und stets ist sie ein Spiel, das uns in den von Schiller so bezeichneten ästhetischen Zustand versetzt, wo wir ohne Nutzenkalkül und ohne Erkenntnisabsicht den Eigen-Sinn bestimmter Realitäten erfassen, etwa jene von Landschaften. Dichtung, ob Rap, DADA oder Nonsense-Poesie, ist ein Gebiet maximaler Sprachfreiheit. Diese Freiheit mit allen Mitteln zu entfalten, bietet die gerade für unsere Gegenwart unverzichtbare Chance, Denkschablonen und Stereotypen der Wahrnehmung abzustreifen, um die eingespielte Ordnung einträglicher Sichtweisen und den vertrauten Rahmen eines komfortablen Konsenses aufzulösen.
Weit mehr als der literarische Escort Service zur Umweltkrise zu sein, ist Landschaftsdichtung von dem Bewusstsein erfüllt, die intensive Beziehung von menschlichen und nichtmenschlichen Wesen sprachlich zu modellieren. Landscape Writing wird zu einem Labor veränderter Wahrnehmungsweisen und Denkformen. Gerade weil ihre Texte nicht das sind, was sich als niederschwellige Sprachprodukte geschwind mal konsumieren lässt, gelingt es ihnen, verführerisch, rätselhaft, bezaubernd zu sein. Und allem voran: Sie führen ins Offene.
Viel spricht dafür, Umweltdichtung im Sinn des angelsächsischen ecocriticism zu begreifen, nämlich in dem von Heinrich Detering beschriebenen Sinn, „dass diese Literatur als Laboratorium von Anschauungsformen und Denkweisen erscheint, die das Wort ‚ökologisch‘ resümieren wird“.
Literatur, und insbesondere Lyrik, ist die Kulturtechnik der Offenheit. Bereitschaft des Ausprobierens und Sich-Einlassens war ihr von Anfang an eingeschrieben. Poesie ist eine Pioniersprache, sie erkundet, sie wagt sich vor. Sie spricht auf eine Art, die wir uns sonst nicht trauen würden. Gedichte tasten sich voran, versuchen neue Methoden der Erfahrung. Sie beschreiben keine Erlebnisse, sie machen erlebbar. Und das oftmals nicht auf die sanfte Tour. Kreativität, sprich das Umbauen geistiger Gewohnheiten und Sichtweisen, ist destruktiv und konstruktiv zugleich. Darin zeigt sich eine markante Parallelität zur ökologischen Transformation.
Dies so zu sehen bedeutet, Landschaftsdichtung als mentales Trainingsgelände aufzufassen, als sprachliches Spielfeld, um vom romantischen Areal, in dem die Seele in die ewige Natur einschwingt, zur Biosphäre weiterzugehen, dorthin, wo heute der dramatische Konflikt unserer globalen Zivilisation ausgetragen wird. Ein Konflikt, bei dem die parasitäre, menschenbezogene Naturbenutzung in ein Verhältnis achtvoller Gegenseitigkeit umgewandelt werden muss und, falls das nicht gelingt, in dessen Folge das einstmals feste Gewebe kosmischer Ordnung von Natur und Mensch, ausgedrückt in der Landschaft, porös und brüchig wird. Bis es irgendwann zerreißt. Ein Riss, der auf die Wirklichkeit insgesamt durchschlägt. Was sie ist, noch ist, sein soll, nie wieder sein kann.
Der nigerianische Autor Wole Soyinka macht dies mit so großer poetischer Präzision wie tiefer Betroffenheit erfahrbar:
„Doch die Natur ist ungerührt, beugt sich der Menschenhände
grimmiger Tüchtigkeit beim Verschwenden.
Nur scheinbar sind diese Schakale gestellt oder fliehen.
Eine neue Meute sammelt sich im Unterholz,
das Geschnatter ist vertraut und ohne Reue. Sie kennen
die Bäume, an denen sie ihr Hinterbein
das letzte Mal hoben –
(…) Die Landschaft ändert sich, die Landschufte bleiben. Entlang
ihrer Urinspur weichen die Bäume Straßenlaternen.“
grimmiger Tüchtigkeit beim Verschwenden.
Nur scheinbar sind diese Schakale gestellt oder fliehen.
Eine neue Meute sammelt sich im Unterholz,
das Geschnatter ist vertraut und ohne Reue. Sie kennen
die Bäume, an denen sie ihr Hinterbein
das letzte Mal hoben –
(…) Die Landschaft ändert sich, die Landschufte bleiben. Entlang
ihrer Urinspur weichen die Bäume Straßenlaternen.“
„Die Landschaft ändert sich“, doch spiegelt sich stets in ihr die Geschichte: Kolonialismus, Gewalt, Ausbeutung. Allerdings sind kolonisierte Landschaften nicht auf einstmalige Kolonien beschränkt. Sie sind die allgemeine Form der Moderne, getragen von einer technokratisch-ökonomischen Sprache, mit landschaftlichen Räumen auf eine Weise umzugehen, die zu totaler Beherrschung, Gewinnmaximierung und nicht zu heilender Verwundungen führt.
Und wieder: Welche Sprache haben wir für die globalen Landschaften?
In Gedichten vernetzen sich die Landschaften, bilden internationale Myzele, die über Kontinente und Sprachgrenzen hinweg den zivilisatorischen Untergrund mit Verästelungen durchwachsen. Statt der Dominanzformeln der Technowissenschaft und Ökonomie bedarf es einer Sprache, die berührt, bewegt, irritiert, aufweckt, neu ausrichtet. Wissenschaftsgeprägte Diskurse und politische Formeln, dazu Planungssprache, Konstruktionssprache, Projektsprache sind allesamt Sprachweisen, die besagen, was wir als Menschen mit der Landschaft machen. Doch verschweigen und verdecken sie hartnäckig, was die Landschaft mit uns Menschen macht.
Die Konstruktion von Natur als etwas wissenschaftlich Äußeres, Objektives, das menschlicher Verfügungsgewalt preisgegeben ist, hat ihre Überzeugungskraft eingebüßt. Wir leben nicht außerhalb von Landschaften, wir leben in der Landschaft, in die wir, gleichgültig wie lange und wie oft wir uns in ihr aufhalten, auf die eine oder andere Weise hinein verwoben sind. Wenn nun selbst unter Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten inzwischen häufiger das epochale Sprachdefizit dafür verantwortlich gemacht wird, weshalb es nicht zu dem erforderlichen Lernprozess, zu Änderungen des Verhaltens und politischen Handelns kommt, gilt es, hellhörig zu werden. Dennoch gleicht es einer neuerlichen Ausflucht, nun von Schriftstellern zu fordern, jene Gesellschaften literarisch zu orchestrieren, die sich in ihren Lebensgrundlagen selbst bedrohen. Worum es tatsächlich geht, ist eine Dichtung, die wie ein Kontrastmittel wirkt, der Gesellschaft injiziert, um die in ihr unentwegt wachsenden, raumfordernden Schatten genauer sehen und behandeln zu können.
Die Veränderung, die das erfordert, beginnt bereits bei den Sinnen, beginnt in der Sprache. Dort findet die Ummöblierung unserer mentalen und seelischen Inneneinrichtung statt. Denn menschliche Sinnlichkeit agiert immerfort innerhalb einer symbolischen Ordnung, durch die sie geformt und informiert wird. Wo der eine einen herbstlich leuchtenden Kalkbuchenwald sieht, sieht der andere eine ergiebige Starkholzernte und ein Dritter lukratives Bauland. Solche symbolisch antrainierten Lenkungen sind es, nach denen wir wahrnehmen, weil wir kognitiv danach ausgerichtet sind. Sie verbinden Sinne und Sollen, Wissen und Gewissen.
Diesen Quellcode umzuschreiben, der unser Erleben und Empfinden von Landschaften zutiefst prägt, daran arbeiten Schriftsteller. Was vor allem bedeutet, sie sinnlich zu erfahren, intelligent zu beobachten und emotional beteiligt zu sein. Sicher ist Wissenschaft grundlegend für modernes Dasein, mehr und mehr zeigt sich jedoch, ästhetische Kulturtechniken, und nicht zuletzt die Landschaftsdichtung sind dafür unerlässlich.
Kurz: Dichtung wirkt am Ethos einer so sprachbewussten wie teilnehmenden Sinnlichkeit maßgeblich mit. In diesem genauen Sinn darf Umweltpoesie als politisch bezeichnet werden. In einem Zeitalter, wo kein planetarischer Ort sich der bedrohlichen ökologischen Wirklichkeit entziehen kann, geht es der Lyrik um die innerste Fragwürdigkeit heutiger Zivilisation und ihrer Sprache. Landschaftspoetik wird zum gesellschaftlichen Unruheherd, zum Störfaktor jenes Konsenses, der unsere Sensitivität abschirmt, nicht nur, doch insbesondere vor jenen versehrten Lebensräumen, die als endlos manipulierbare Objekte behandelt werden.
Dichterische Sprache widerspricht nicht direkt, doch radikal in der Weise, wie sie spricht. Literatur sagt, was sie sagt, nicht in einem vorpolitischen Raum. Vielmehr redet sie inmitten heutiger Gesellschaften. Alle ihre Stimmen lassen sich als ein Netzwerk poetischer Lebensräume lesen, die sich zu einem globalen Raum verknüpfen. Zu einer Welt-Literatur der Landschaft.
Doch am Ende kann es auch ganz einfach sein. Plötzlich kippen die Maßstäbe einer wirtschaftsgetriebenen Epoche, die Zeit verschiebt ihre Gewichte, die Verhältnisse stürzen um. Wenn wir beispielsweise der polnischen Dichterin Wisława Szymborska zuhören:
„So weit ist es nun gekommen, dass ich unterm Baum sitze
am Ufer des Flusses
im sonnigen Morgen
(…) der Fluss heißt Raba und fließt nicht erst seit heute
(…) Bei solch einem Anblick verläßt mich stets die Gewißheit,
dass das Wichtige wichtiger ist
als das, was für unwichtig gilt.“
am Ufer des Flusses
im sonnigen Morgen
(…) der Fluss heißt Raba und fließt nicht erst seit heute
(…) Bei solch einem Anblick verläßt mich stets die Gewißheit,
dass das Wichtige wichtiger ist
als das, was für unwichtig gilt.“