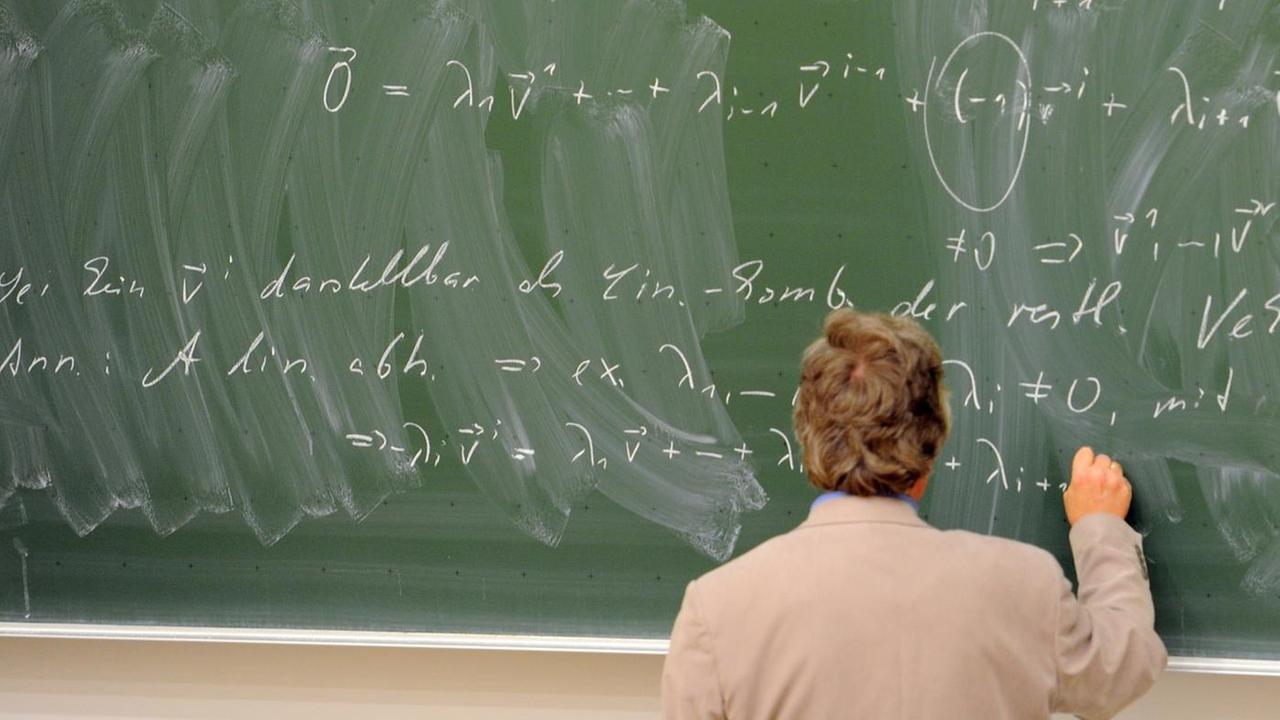
Benedikt Schulz: Die Rolle der Hochschulleitung, die stand in den vergangenen Jahren immer mehr im Vordergrund. Früher – früher heißt jetzt so ungefähr bis in die 90er-Jahre hinein –, da war das so, dass viel Gestaltungsspielraum, viel Macht bei den Dekanaten lag und den Fachbereichen. Das ist auch immer noch so, aber die Rolle der Rektoren und Präsidenten, die ist immer wichtiger geworden. Und da ist die Frage natürlich naheliegend: Wer ist das denn eigentlich, der oder die unsere Hochschulen führen? Das Zentrum für Hochschulentwicklung CHE hat sich das mal angeschaut, und zwar ein bisschen genauer, genauer insofern, als dass man die Biografien der Hochschulchefs ausgewertet hat. Kurz gefasst: weiß, alt, westdeutsch und vor allem männlich. Autorin der Studie ist Isabel Roessler und sie ist jetzt am Telefon. Frau Roessler, hallo! Frau Roessler, hören Sie mich?
Isabel Roessler: Ja, ich höre Sie gut.
Schulz: Gut. Kurze Frage vorweg: männlich und weiß – waren Sie überrascht?
Roessler: Nein, überhaupt nicht. Ich war eher erschrocken, dass sich das Bild, das man landesüblich im Kopf hat, wenn man an einen Universitätspräsidenten denkt, sich so extrem bestätigt hat.
Schulz: Was haben Sie denn konkret herausgefunden?
Roessler: Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es bei den Universitäten so ist, dass die meisten der Universitätspräsidenten oder Universitätsrektoren in Deutschland geboren wurden, nämlich 95 Prozent, lediglich vier im Ausland. Und aus den ostdeutschen Bundesländern, also vor der Wende Ostdeutschlands, ist keiner.
Unterscheidungen nach Fächergruppe
Schulz: Und jetzt haben Sie auch die Ausbildung der Chefs genauer in den Blick genommen, habe ich gerade schon gesagt. Wie würden Sie denn sagen, wie sieht denn so der klassische Karriereweg des Hochschulchefs aus?
Roessler: Also das ist so, dass man etwas unterscheiden muss. Zum einen unterscheidet es sich nach der Fächergruppe, die studiert wurde, die ist nämlich etwas anders, wenn man sich diejenigen anschaut, die unter 60 sind, und das vergleicht mit denjenigen, die über 60 sind. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass die jüngeren LeiterInnen hauptsächlich, schwerpunktmäßig, zu 37 Prozent, nämlich in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promoviert sind, und unter den Über-60-Jährigen nur 14 Prozent. Die älteren Generationen haben im Gegensatz dazu im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften und in Geisteswissenschaften promoviert, nämlich zu jeweils 30 Prozent. Das ist ein enormer Unterschied. Das ist das eine. Das andere ist, dass es Unterschiede dahingehend gibt, wie der Werdegang der Universitätsleitung ist. Nur 29 Universitätsleiterinnen und -leiter wurden nämlich als Externe auf ihre derzeitige Position berufen. Heißt: Alle anderen waren bereits zuvor als Professor in der Regel an ihrer jetzigen Universität tätig. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich meine, wir reden von 81 staatlichen Universitäten und nur 29 waren vorher nicht in dieser Hochschuleinrichtung. Und das andere, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass das Amt einer Vizepräsidentin, also Vizepräsidenten oder auch einer Prorektorin, Prorektor gerade mal 35 der Hochschulleitungen zuvor innehatten und da auch nur 12 an einer anderen Hochschule.
"Mentalität der Suche nach Sicherheit"
Schulz: Gehen wir mal von den Zahlen ein bisschen jetzt in die konkreten Befunde. Kein einziger Rektor beziehungsweise kein einziger Präsident kommt aus Ostdeutschland. Wie kann das denn 30 Jahre nach dem Mauerfall sein?
Roessler: Da muss man eine Sache vorweg sagen. Es ist so, dass wir hier eine Momentaufnahme haben, nämlich Stand Dezember 2018. In der Vergangenheit gab es bereits ostdeutsche Universitätspräsidentinnen und -präsidenten. Das ist aber, wie gesagt, im Dezember 2018 nicht der Fall. Und das kann natürlich verschiedene Gründe haben, und der Soziologe Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau/Görlitz hat da ganz frisch sozusagen Begründungen geliefert, woran das wohl liegen könnte, und der hat nämlich gesagt, dass viele Ostdeutsche nicht den Habitus der Oberschicht hätten und nicht über die Geschmacksurteile und das selbstbewusste Auftreten eben der Oberschicht verfügen, das ist eine Sache, und auch, dass häufig eine Mentalität der Suche nach Sicherheit bestünde. Viele Familienmitglieder von ostdeutschen Familien haben ihren Job damals verloren nach der Wende, haben also Verlusterfahrungen erlitten, und was auch dort zu sehen war, war ein abgrundtiefer Sturz der früheren Eliten. Das ist vielleicht auch durchaus etwas abschreckend oder erschreckend.
Schulz: Deutschlandfunk "Campus und Karriere", wir sprechen über das Thema Gleichstellung bei Hochschulleitungen in Deutschland mit Isabel Roessler vom CHE, die die Biografien deutscher Hochschulchefs ausgewertet hat. Und bis hierhin mitgehört hat auch Marion Woelki aus dem Vorstand der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen und dort Sprecherin der Kommission Hochschulgovernance und Gleichstellung. Auch Ihnen herzlich willkommen, Frau Woelki!
Marion Woelki: Hallo, Herr Schulz!
Programme bringen nur kleine Erfolge
Schulz: Natürlich muss ich auch Sie fragen: Waren Sie überrascht von den Ergebnissen?
Woelki: Nein. Also auch wir waren eigentlich nicht überrascht, weil diese 23 Prozent, die spiegeln das Geschlechterverhältnis auch bei den Professoren wider. Und daher ist das Grundproblem sozusagen nicht, dass zu wenig Frauen in den Rektoraten sind, sondern das Grundproblem ist, dass wir zu wenig Frauen unter den Professoren haben in Deutschland.
Schulz: Und wie kann man das ändern?
Woelki: Ja, also um es zu ändern, muss man erst mal wissen, warum es so ist, und da gibt es natürlich jede Menge Gründe. Und einige Gründe sind ähnlich wie bei anderen Fragen, warum wir so wenig Frauen in Führungspositionen haben, und andere sind spezifisch im Wissenschaftssystem verankert. Und das Interessante ist, dass wir seit 20 Jahren an diesem Thema arbeiten und dass es sowohl in den Bundesländern Gesetze gibt und es gibt Bundesprogramme, zum Beispiel das Professorinnen-Programm, aber die alle eigentlich immer nur kleine Erfolge bringen und zu langsam sind und dass sich grundlegend was ändern muss. Und wenn wir jetzt überlegen, also wir haben immerhin 50 Prozent Studentinnen und dieser Anteil wird dann über die verschiedenen Qualifikationsstufen immer geringer, woran das denn irgendwie liegen könnte, und dann haben wir, sagen wir mal, so drei, vier Gründe, die sind auch alle gut erforscht. Es gibt so was wie eine vermeintliche Selbstselektion, das heißt, dass Frauen auch aufgrund von den unsicheren Perspektiven auf eine Professur oder auf eine Dauerstelle, die wird in Deutschland immerhin oft erst mit 40 Jahren erreicht, sozusagen sich selbst aus diesem System nehmen und nach Alternativen suchen. Und das andere ist, wir haben natürlich auch die Fremdselektion, das heißt, aufgrund von gewissen Stereotypen und Vorurteilen, kurzer Begriff Gender Bios, wird Frauen immer noch weniger zugetraut, ihre Leistungen werden anders beurteilt. Auch da gibt es einige Untersuchungen dazu, wie sich das bei Gutachten und bei Vorträgen und so auswirkt. Und also wir haben einen weiteren Grund, den nennen die SoziologInnen homosoziale Kooptation. Da spielt auch der Habitus mit rein, den Frau Roessler vorher genannt hat. Wir finden das besonders bei Geschlecht, dass Männer eben andere Männer bevorzugen, die ihnen ähnlich sind. Also das gilt auch für andere Diversity-Kriterien, durchaus, da spielt auch eben die Frage rein, warum so wenig Ostdeutsche, warum so wenig Internationale, das ist auch übertragbar auf andere Diversity-Kriterien, wirkt aber besonders stark eben bei Geschlecht. Und man sieht in gewisser Weise dann eben auch noch solche Machtstrukturen, also sogenannte Old Boys Networks.
Tenure-Track-Professuren in Deutschland
Schulz: Aber wie kann man das denn, trotzdem muss ich das konkret nachfragen, wie kann man das denn ändern? Sie sind noch in der Analyse, ich suche noch nach der Lösung.
Woelki: Ja, ja. Na ja, also sagen wir mal, die Analyse zeigt ja, dass es eigentlich so ein fundamentaler Fehler auch ist im System, und dass man zwar auf der einen Seite durchaus viele individuelle Maßnahmen hat, um Frauen konkret zu fördern, aber so lange es zum Beispiel keinen sicheren Karriereweg gibt, also so lange wir auch nicht umstellen wie ein US-amerikanisches System oder ein englisches System, die schon sehr viel früher Dauerstellen anbieten, haben Frauen auch keine sicheren Karrieren. Also da gibt es eben auch erste Ansätze, es gibt ja jetzt sogenannte Tenure-Track-Professuren in Deutschland, und da ist es auch ersichtlich, dass, wenn Frauen schon früher auf die Stellen kommen, schon mit 30 eine sichere Perspektive haben, übernommen zu werden, dann wird auch die ganze Planung drum herum, zum Beispiel auch eine Familienplanung, einfacher. Das heißt, das System der Stellen muss sich auf jeden Fall ändern. Und das Zweite, was sich auf jeden Fall auch ändern muss, ist, dass diese - bislang gibt es immer noch eine Ausrichtung an sogenannten männlich tradierten Normbiografien. Das heißt, individuelle Lebensumstände und dann dadurch auch diversere Karrierewege werden viel zu wenig berücksichtigt, auch bei der Leistungsbeurteilung. Das heißt, man muss einfach zum Beispiel klar regeln: Wenn in so einer sehr harten Phase beim Postdoc eben jetzt Familienverantwortung reinkommt, wie geht man damit um, dass dann jemand in der Zeit weniger publiziert hat?
Schulz: Wir sprechen über das Thema Gleichstellung bei Hochschulleitungen in Deutschland, und mit mir gesprochen haben Isabel Roessler vom CHE, sie hat die Biografien deutscher Hochschulchefs ausgewertet, und gesprochen mit mir hat auch Marion Woelki aus dem Vorstand der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen und dort Sprecherin der Kommission Hochschulgovernance und Gleichstellung. Frau Woelki, Frau Roessler, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden!
Woelki: Ich danke auch.
Roessler: Herzlichen Dank!
Woelki: Tschüss!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.


