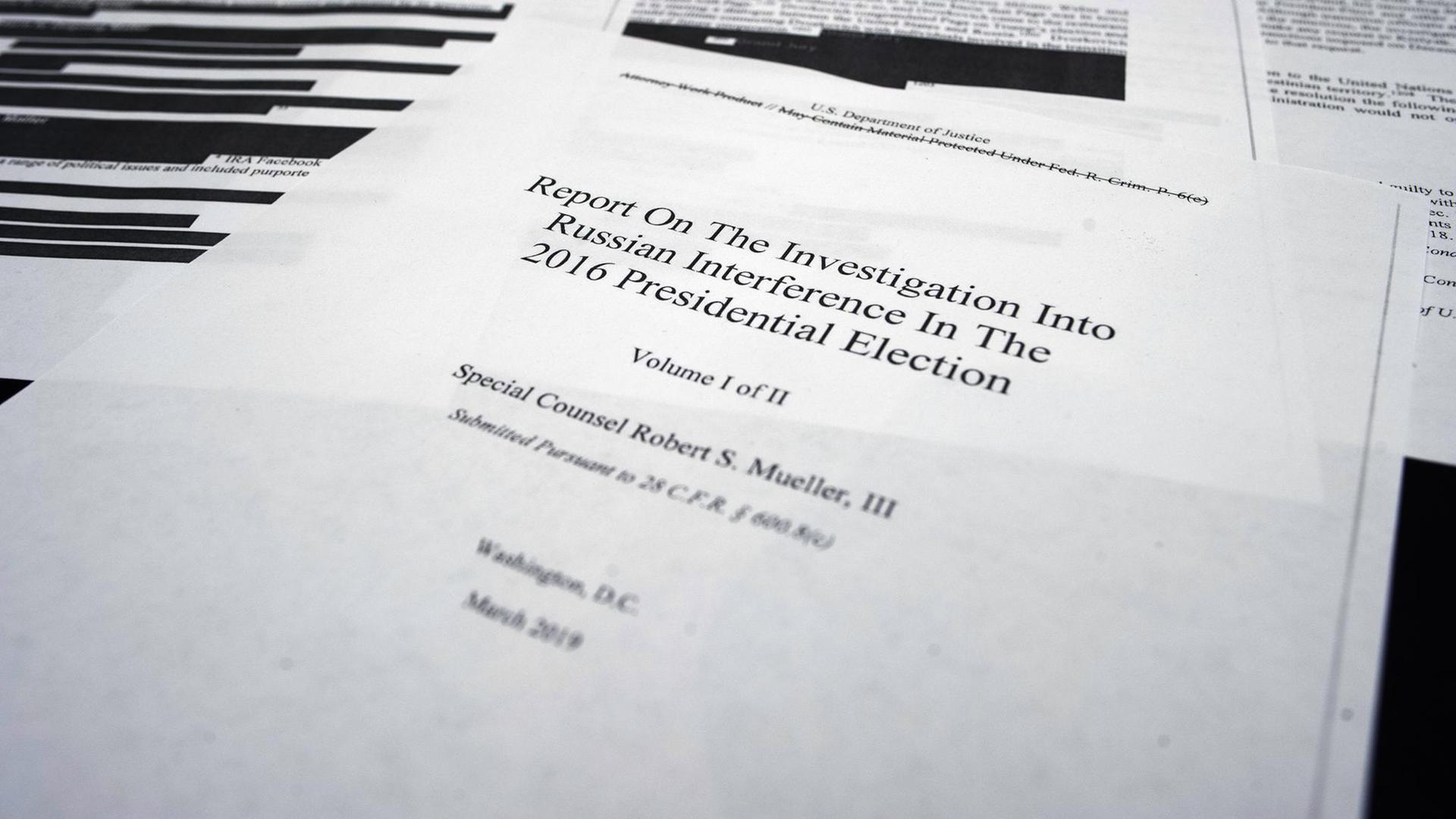Christine Heuer: Noch 17 Monate bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in den USA – ziemlich lange hin also. Aber der Wahlkampf nimmt bereits an Fahrt auf. Amtsinhaber Donald Trump hat seine Kandidatur in Florida bejubeln lassen; jetzt sind die Demokraten dran. Fast zwei Dutzend von ihnen können sich vorstellen, gegen Trump anzutreten – so viele, dass für die ersten TV-Debatten der Anwärter gleich zwei Abende genutzt werden. Der erste ist heute zu Ende gegangen.
Am Telefon begrüße ich Sigmar Gabriel, gestern Abend gewählt zum neuen Vorsitzenden der Atlantik-Brücke, des Vereins, der seit 1952 versucht, die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu vertiefen. Guten Morgen, Herr Gabriel.
Sigmar Gabriel: Guten Morgen! Ich grüße Sie!
Heuer: Zuerst einmal: Herzliche Gratulation!
Gabriel: Vielen Dank!
Heuer: Wieso gerade Amerika, Herr Gabriel? Warum sind die USA für Sie ein Herzensanliegen? Sie könnten sich ja auch mit tausend anderen Staaten beschäftigen.
Gabriel: Erstens bin ich noch in einer Generation aufgewachsen, dass wir schon wussten, dass die Tatsache, dass wir hier damals im alten Westdeutschland frei und sicher leben konnten - ich war selber Soldat bei der Bundeswehr -, im Wesentlichen deshalb für uns so stabil war, weil wir die Vereinigten Staaten von Amerika als Partner hatten. Das war schon uns jedenfalls klar, auch wenn wir manches in der damaligen Regierungspolitik der USA auch kritisiert haben. Aber das war und ist der wichtigste Verbündete, den wir haben. Ganz Europa gäbe es nicht ohne die Vereinigten Staaten.
Heute ist es so, dass wir zwar Schwierigkeiten mit dem haben, was der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten macht. Aber eines stimmt auch: Ohne die Vereinigten Staaten ist der Westen und ist Europa schwächer, und ich glaube, dass es gerade jetzt darum geht aufzupassen, dass wir nicht als Europäer zwischen die Mühlsteine geraten der Chinesen und der Amerikaner. Deswegen, glaube ich, ist das gerade jetzt ein spannendes Thema.
"Atlantik ist nicht mehr das große Kraftzentrum der Welt"
Heuer: Ja, das kann ich gut verstehen. Wie erleben Sie denn die USA heute? Wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie gestern in Ihrer Antrittsrede gesagt, das Verhältnis zu den USA ist nicht besser oder schlechter, es ist anders. Wie ist es denn anders heute, als es früher war?
Gabriel: Ich wollte damit ausdrücken, dass wir, glaube ich, den Fehler machen, zu sehr zu schauen, was der aktuelle Präsident macht, und dabei übersehen, dass die Vereinigten Staaten sich seit dem Fall des Eisernen Vorhangs dramatisch verändert haben. Die Tektonik der Weltpolitik ist ganz anders geworden. Wir erleben gerade das Ende auch des Opazentrismus in der Welt. Nicht mehr der Atlantik ist das große Kraftzentrum der Welt, sondern der Pazifik. Die Vereinigten Staaten haben sich unter Obama bereits verändert. Alle Vorgänger haben immer von den USA als transatlantische Nation gesprochen. Das zeigt, die Orientierung der Vereinigten Staaten geht in eine andere Richtung der Welt, und das ist natürlich was ganz anderes, als was wir in den letzten 70 Jahren gewohnt waren, und das fordert uns auch heraus, denn wenn man ehrlich ist, hatten wir es auch ziemlich bequem. Wir Deutschen und wir Europäer konnten uns um uns selber kümmern.
Für die schwierigen Aufgaben in der Welt hatten wir ein bisschen die Franzosen, ein bisschen die Briten, aber vor allem die Amerikaner. Wenn es schiefging, hatten wir auch immer einen Schuldigen, und das war auch bequem für uns. Jetzt merken wir, die Zeiten ändern sich dramatisch schnell, und das ist eine tektonische Veränderung in der Weltpolitik. Deswegen haben wir es heute schon seit längerer Zeit mit einem anderen Amerika zu tun. Ich glaube, Amerika wird nicht so bleiben wie unter Donald Trump, aber es wird nie wieder so werden, wie es mal war.
Heuer: Ein Demokrat im Weißen Haus ändert die Situation nicht mehr grundsätzlich?
Gabriel: Der wird vermutlich als erstes im Grundsatz wieder ändern, dass er sich darüber im Klaren ist – das tun ja auch immer Gott sei Dank noch viele Republikaner -, dass die eigentliche Kraft der USA darin bestand, Alliierte, Partner, Freunde zu haben. Das ist ja der große Unterschied zwischen den USA und anderen Großmächten. Kein Land der Erde hat es geschafft, so wie die USA Partnerschaften aufzubauen. Die anderen kennen maximal Gefolgschaften, aber nicht Partner. Trump ist das scheinbar egal. Jedenfalls sucht er nicht die Abstimmung mit den Alliierten. Manchmal erscheinen wir sogar als seine Gegner. Das ist vermutlich oder hoffentlich der größte Unterschied, falls es zu einem neuen amerikanischen Präsidenten kommt. Aber die Interessenlage der USA, dass sie China als den großen Antipoden sieht, dass sie weniger investieren wollen in Europa oder in Afrika, dass sie sich raushalten wollen oder stärker raushalten wollen aus einem Teil der Konflikte in der Welt, um ihre Kraft Richtung China zu konzentrieren, das wird sich nicht ändern.
"Donald Trump hat die Chance, wiedergewählt zu werden"
Heuer: Aber es wäre bestimmt ein großer Vorteil, wenn man wieder wirklich gesprächsfähig würde mit einer US-Regierung. Wie sehen Sie das denn? Wir haben ja gerade vom Aufgalopp möglicher demokratischer Kandidaten für das Präsidentschaftsamt gehört. Was sagt Ihr Bauchgefühl da, Herr Gabriel? Haben Die eine Chance gegen Donald Trump?
Gabriel: Ich möchte mich lieber nicht auf mein Bauchgefühl verlassen, auch wenn der groß genug ist. Aber ich glaube, es ist so, dass alle die recht haben, die sagen, das ist eine offene Frage. Donald Trump hat die Chance, wiedergewählt zu werden. Es gibt auch die Chance, dass es einen neuen Präsidenten gibt, und es wird sehr davon abhängen, wen die Demokraten aufstellen. Deswegen ist der Prozess so wichtig. Aber noch ist das alles ziemlich unüberschaubar, wer da wirklich eine Chance hat anzutreten. Aber beide Seiten haben eine Chance.
Heuer: Hätten Sie da einen Favoriten?
Gabriel: Nein. Und wenn ich einen hätte, würde ich ihn öffentlich nicht sagen. Wir würden uns als Deutsche auch verbieten, wenn sich Amerikaner in unsere Wahlkämpfe einmischen.
Heuer: Wir haben über die Gesprächsfähigkeit gesprochen zwischen den USA und Deutschland. Man hat ja zunehmend den Eindruck bekommen in den letzten Monaten und Jahren, dass Angela Merkel einfach nicht gesprächsfähig ist mit Donald Trump, und sie bemäntelt das ja auch immer weniger, dass da einfach der rote Faden abgebrochen ist. Macht sie da gerade als Kanzlerin einen schweren Fehler?
Gabriel: Ich würde erst mal umgekehrt sagen: Wenn Sie einen amerikanischen Präsidenten haben, der den Eindruck vermittelt, als sei Europa eine Verschwörung gegen die Interessen der USA, dann ist es schwer für deutsche und europäische Staatsregierungschefs, da, wie Sie sagen, einen roten Faden zu finden. Angela Merkel macht aus ihren Unterschieden zur amerikanischen Politik keinen Hehl. Für sie ist absolut klar, dass die Welt aufgrund von Regeln existieren soll und nicht die Macht des Stärkeren existieren soll, und das bringt sie in Konflikt mit Donald Trump. Aber ich finde, dass man solchen Konflikten auch nicht ausweichen darf. Trotzdem muss man gesprächsfähig bleiben, natürlich! Aber jetzt die Konflikte zu verheimlichen oder zu verschleiern, das, glaube ich, wäre auch nicht vernünftig.
"Wir haben in keinem der Konflikte wirklich was zu sagen"
Heuer: Donald Trump hat ja auch nicht so viel Anlass, auf die Europäer Rücksicht zu nehmen, wenn man mal anschaut, dass das europäische, das deutsche Gewicht in den wichtigen, drängenden geopolitischen Fragen gerade nicht besonders groß ist. Wie kann man denn da wieder stärker werden, mächtiger, selbstbewusster, einflussreicher?
Gabriel: Da haben Sie in der Tat den zentralen Punkt erwischt. Wir gelten nicht nur den USA gegenüber, auch im Rest der Welt als reich, aber politisch unbedeutend als Europäer. Wir haben in keinem der Konflikte wirklich was zu sagen: in Syrien nicht, im Irak nicht, im Golf nicht, im Iran nicht. Das hat was damit zu tun, dass Europa nie gegründet wurde, um sich außenpolitisch groß zu engagieren. Im Gegenteil! Europa ist eigentlich gegründet worden, damit wir uns raushalten, weil auch die Sorge bestand, wenn die Europäer und vor allen Dingen die Deutschen sich einmischen in der Welt, dann wird es wieder gefährlich. Deswegen war schon die Konzeption so: Die Europäer sollen sich umeinander kümmern, sollen aufpassen, dass sie nicht wieder selber in Kriege geraten, und ansonsten kümmern sich die Großen, die USA wie gesagt, Großbritannien und Frankreich um den Rest. Das hat dazu geführt, dass wir so was sind wie geopolitische Vegetarier.
Heuer: Wie werden wir wieder Karnivoren?
Gabriel: Na ja, das ist möglicherweise privat gesund. Aber wenn der Rest der Welt Fleischfresser ist, dann nehmen die sie nicht richtig ernst, und in der Lage sind wir. Deswegen werden wir viel dafür tun müssen, dass wir ein globaler Akteur werden – nicht, dass wir auch zum Fleischfresser werden, nicht falsch verstehen, aber dass wir ernst genommen werden. Das beginnt mal damit, dass wir als Europäer die gleiche Sicht auf die Welt haben müssen. Das haben wir nicht. In Libyen zum Beispiel gibt es zwei europäische Staaten, die jeweils einen anderen Kriegsgegner unterstützen. Das führt natürlich nicht dazu, dass wir irgendwo ernst genommen werden. Wir haben keine gemeinsame europäische China-Strategie und wir haben auch keine gemeinsame USA-Strategie. Ich glaube, das müssen wir entwickeln und da fand ich den Vorschlag des französischen Präsidenten Macron gut, so was wie einen europäischen Sicherheitsrat zu bilden, bei dem wir beginnen, uns gemeinschaftlich den gleichen Blick auf die Welt anzueignen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt ernst genommen wird.
"Die Menschen wollen Führung sehen"
Heuer: Man hört den Außenminister, der Sie waren, Herr Gabriel. Es wird Sie nicht wundern: Wir müssen zum Schluss noch mal ganz kurz auf Ihre Partei zu sprechen kommen, auf die SPD. Das ist ja auch eine Art machtpolitischer Vegetarier im Moment. Gesine Schwan hat gesagt, wenn sie gefragt würde, dann würde sie schon mal übergangsweise im Parteivorsitz helfen, das zu ändern. Halten Sie das für eine gute Idee?
Gabriel: Jede Sozialdemokratin und jeder Sozialdemokrat hat das Recht, sich zu überlegen, ob sie diesen Vorsitz nicht ausüben kann. Ich würde nur raten, es bald zu tun, weil das Führungsvakuum ja auch seltsam wirkt. Wenn man öffentlich erklärt, die SPD soll regieren, aber keiner will die SPD regieren, das wirkt auf Bürgerinnen und Bürger seltsam. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht unglaublich viel investieren in innerparteiliche Prozesse und Verfahren, die aber draußen keinen interessieren. Die Menschen wollen Führung sehen. Sie wollen wissen, wohin soll das Land gehen, wohin geht die Zukunft in Deutschland, was tun Parteien dafür, Personen. Ich glaube, dass es darum gehen muss. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir jetzt alle gucken auf Personen, aber die eigentliche Frage ist, welche Rolle soll Deutschland in der Welt übernehmen, in Europa. Wir sind am Anfang einer Wirtschaftskrise; wie bewältigen wir die eigentlich. Wir müssen, glaube ich, diese Dinge beantworten. Dann wird es daraus auch Personen geben, die das am besten managen können.
Heuer: Aber Sie sagen ja selber, Herr Gabriel, das muss schnell gehen. Ich habe jetzt auch mit Ihnen fast keine Zeit mehr, aber den Namen Kevin Kühnert will ich noch ins Spiel bringen und Sie fragen, ob der gut wäre im Parteivorsitz.
Gabriel: Ich glaube, dass das ein sehr talentierter, ein guter junger Mann ist. Aber es gibt zwei Regeln, die ich in der Politik gelernt habe, als ich jung war. Erstens: Der Ratschlag, erst mal eine Weile Indianer zu sein, bevor man Häuptling wird, das ist etwas, was ich als junger Mann nicht gerne gehört habe, aber ich glaube, da ist was dran. Und das zweite ist: Wenn die Kirche im Dorf brennt, dann müssen die Brandmeister schon selber hin und können nicht die Jugendfeuerwehr schicken. Das ist jemand, der ist ein großes Talent. Der wird auch was werden in der SPD. Aber eine solche Aufgabe, eine Volkspartei zu übernehmen in der tiefsten Krise seit ihrer 156-jährigen Existenz, und in Deutschland zu zeigen, wir können das Land regieren, da, finde ich, darf man und muss man ihn ein bisschen auch davor schützen, jetzt schnell verheizt und verbrannt zu werden. Ich mache mir eher Sorgen, dass er dabei verbrannt wird, als dass er diese Aufgabe bewältigen kann. Aber er ist ein großes Talent!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.