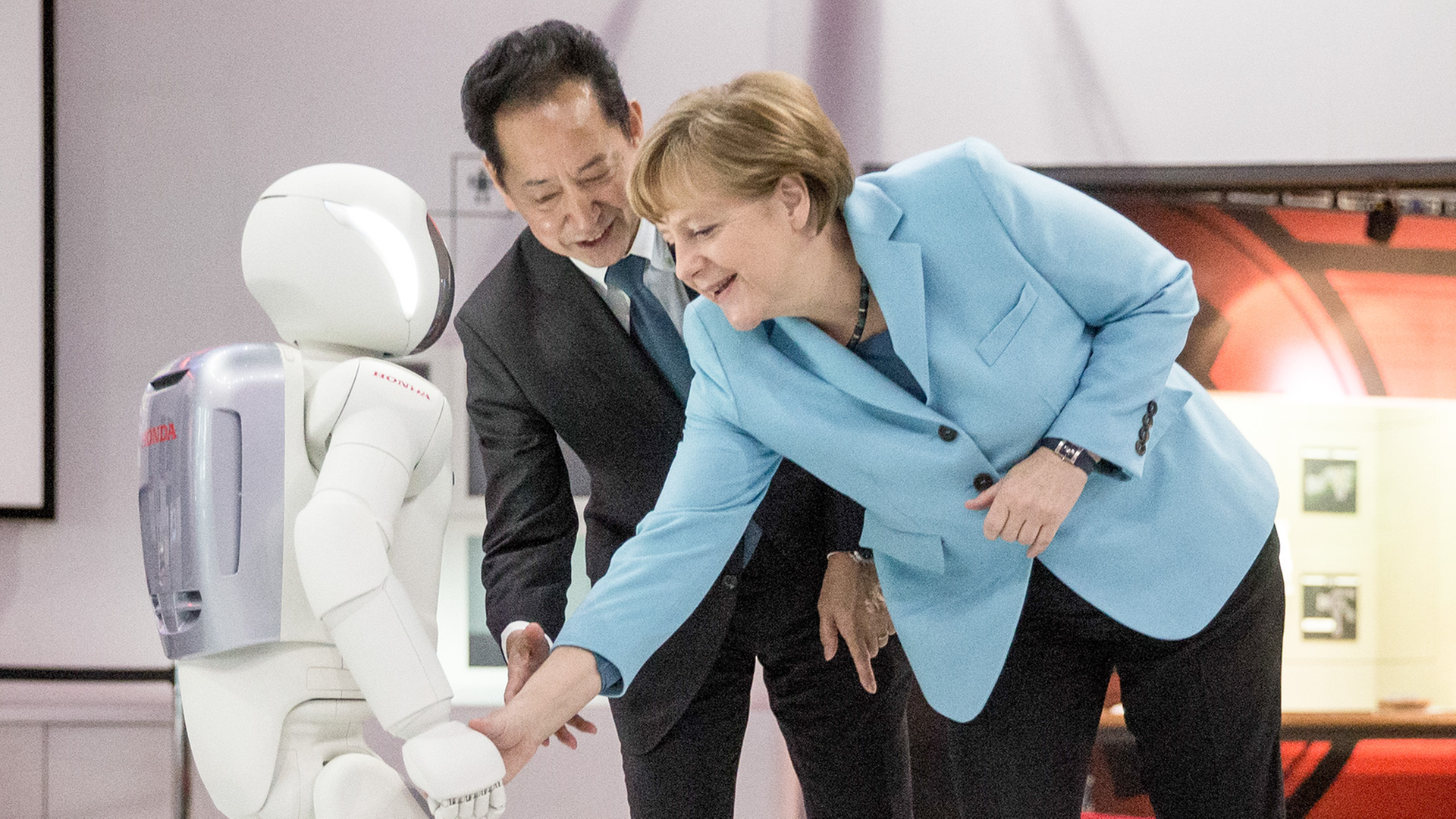Drei winzige Räume in einem hellhörigen Blechcontainer. Hier ist Ichiro Takano - nein, nicht zuhause - allenfalls untergebracht, aufs Allernötigste reduziert, seit er vor vier Jahren über Nacht vom Bauarbeiter zum Flüchtling wurde. Das Aquarium im Eingang unterstreicht die Freudlosigkeit seiner Bleibe. In einer Ecke plappert der Fernseher vor sich hin.
"Das ist doch ein Witz. Ich bin jetzt 64 und soll in dreißig Jahren in mein Dorf zurückkommen dürfen. Mein Haus ist schon jetzt nicht mehr bewohnbar. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Beide sind weggezogen. Die Familie ist zerrissen, ich bin allein. Unsere Eltern liegen auf dem Friedhof im Sperrgebiet. Da darf keiner hin. Wie sollen wir ihre Gräber pflegen? Wer kümmert sich darum?"
Ichiro Takano gehört zu den sogenannten Nuklearflüchtlingen, jenen mehr als 125.000 Menschen, die am 11. März 2011 im näheren Umkreis des Atomkraftwerks wohnten und sich nach dem Super-GAU Hals über Kopf in Sicherheit bringen mussten. Sein Dorf, Futaba, ist so schwer verstrahlt, dass dort auf lange Sicht niemand mehr leben kann. Deshalb wohnt er, wie die meisten seiner Leidensgenossen, in einer Behelfsunterkunft: Die Containersiedlung, 200 Stahlboxen für 300 Menschen auf einem baumlosen Schotterplatz, liegt im 50 Kilometer südlich gelegenen Ort Iwaki. Arbeit findet er hier nicht.
"Das Geld, das wir vom Staat bekommen, reicht nicht, um davon etwas aufzubauen. Den Bauern wird ja wenigstens Entschädigung angeboten."
Verseucht Erde ein Säcken gelagert
Auf der fieberhaften Suche nach einem Zwischenlager für radioaktiven Abraum ist die Regierung auf die Idee gekommen, den rund 2000 Bauern aus Futaba einen Handel vorzuschlagen. Wo ohnehin keiner mehr wohnen kann, wäre doch Platz für Atommüll, so die Logik.
Schon seit Anfang Februar planieren gelbe Baumaschinen ein Gelände, das einer Firma gehörte. Es liegt nur einen Kilometer vom havarierten Kraftwerk entfernt. Hier soll die kontaminierte Erde zwischengelagert werden, die zur Zeit noch überall in der Präfektur Fukushima zusammengekratzt und in schwarze Plastiksäcke gepackt wird. Die Halden der zentnerschweren Beutel zeichnen die Landschaft wie Pocken ein Gesicht. 57.000 Stellen hat das japanische Fernsehen gezählt. In einer höchst umstrittenen Entscheidung hat sich der Bürgermeister von Futaba, Shirou Izawa, bereit erklärt, die Säcke auf der Gemarkung seiner Gemeinde zu lagern.
"Die Präfektur Fukushima hat 59 Dörfer und Städte. Und fast überall türmen sich diese schwarzen Säcke. Solange sie nicht in einem Zwischenlager verschwinden, haben unsere Produkte einen schlechten Ruf. Aber natürlich verstehe ich auch die Gefühle der Grundbesitzer."
Die sind vor allem sauer. Der 73-jährige Kazuo Sato beklagt sich vor allem über die Arroganz der Regierung:
"Wir trauen dem Staat nicht mehr. Seit vier Jahren hat er nichts für uns getan. Und nun bieten sie uns einen Preis für unser Land an, der 30 Prozent unter dem Wert vor dem Atomunfall liegt. Als könnten wir etwas dafür! Diesen Boden haben wir über drei oder vier Generationen beackert. Das müssen die doch verstehen! Deswegen hat keiner den Vertrag unterschrieben."
Unterbringung gegen das Gesetz
Auch in Japan gelten Bauer als stur. Wenn es so bleibt, dann kratzen die Bagger ein Gelände frei, auf dem weniger als 0,1 Prozent der schwarzen Säcke Platz finden. Doch weil die Aktion unbedingt jetzt, zum vierten Jahrestag beginnen sollte, hat man pressewirksam gehandelt - anstatt ehrlich zu verhandeln. Auch der Bürgermeister zweifelt an der Lauterkeit der Regierung. Sie ist nicht bereit, den Bauern faire Preise zu zahlen, und nicht in der Lage, die Opfer menschenwürdig unterzubringen. Noch immer haben zwei Drittel der 7000 Bürger von Futaba keinen neuen Wohnort gefunden. Bürgermeister Shirou Izawa sagt:
"Für ein zivilisiertes Land ist es eine Schande, wie der Staat mit seinen Bürgern umgeht. Im Gesetz steht, dass die Flüchtlinge höchstens zwei Jahre in den Containern untergebracht werden dürfen. Aber jetzt sind es schon vier!"
Eine lange Zeit, in der die seelischen Probleme der Opfer ihre wirtschaftlichen allmählich überwiegen: ein Gefühl der Nutzlosigkeit stellt sich ein, sagt Chuichi Watanabe, ehemals Taxifahrer:
"Ich versuche, möglichst lang im Bett zu bleiben und abends früh schlafen zu gehen. Dazwischen treffe ich manchmal Bekannte, mache einen Spaziergang oder sehe fern. Außerdem kümmere ich mich um meine alte Mutter."
Und sein Nachbar im Container, der 78-jährige Bauer Kazumi Watanabe, der sein Leben lang Reis und Gemüse angebaut und ein paar Milchkühe gehalten hat, kann sein Schicksal noch immer nicht fassen:
"Als es losging, habe ich mich nicht mal umgezogen. Ich dachte, nach zwei, drei Tagen bin ich wieder zurück. Das war vor vier Jahren. Vor vier verlorenen Jahren."