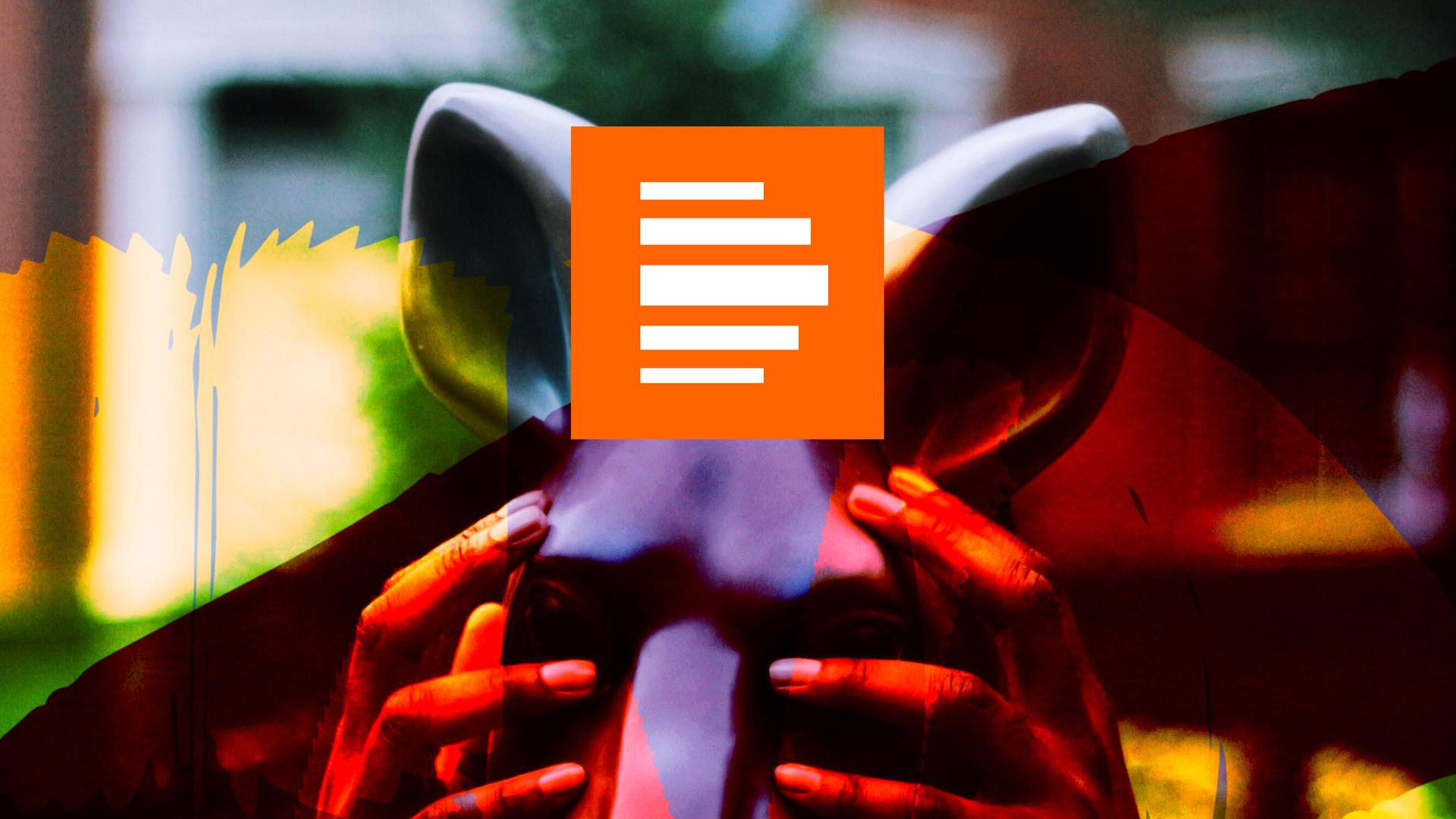So sehr über die Wichtigkeit des Lesens Konsens besteht, so sehr ist die Geschichte des Lesens zugleich die Geschichte einer fortschreitenden Beunruhigung. Denn Bücher waren nicht nur Gegenstände der Begierde, Zeichen des sozialen Aufstiegs, sondern auch lange Zeit Objekte zahlreicher Ängste. Das exzessive Lesen galt als Bedrohung für den sozialen Zusammenhalt oder den individuellen Eskapismus.
Heute ist es allerdings nicht mehr das übermäßige Lesen, sondern das verminderte Lesen, das Sorge bereitet. Führt die digitale Ausweitung des Lesens etwa zum Ende des Buchs, wie wir es kennen? Leben wir in einer postliterarischen Zeit, in der Bücher wertgeschätzt werden, weil sie in unserem Alltag nicht mehr selbstverständlich sind? Oder wird nicht weniger gelesen, nur eben keine Bücher mehr?
Carolin Amlinger lehrt am Institut für Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Basel. Bereits in ihrem Buch Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit (2021) beschäftigte sie sich mit der Wirklichkeit des Literaturbetriebs. Ihr gemeinsam mit Oliver Nachtweih geschriebenes Buch Gekränkte Freiheit (2022) wurde breit diskutiert und war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Von der Zeitschrift politik & kommunikation wurde Carolin Amlinger 2023 mit dem Young Thinker-Award ausgezeichnet.
Auf meinem Schreibtisch stapelt sich eine Mittelgebirgslandschaft aus Büchern. Die Anmut der Bücherberge wirkt zweifelsohne imposant. Doch habe ich sie alle gelesen? Natürlich nicht. Bücher zu sammeln und sie zu lesen sind zwei sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Walter Benjamin hielt 1931 einen Vortrag mit dem Titel „Ich packe meine Bibliothek aus“. Als er nach einem Umzug in eine neue Wohnung die geöffneten Bücherkisten betrachtet, kommt er ins Grübeln. Warum nur hat er so viele Bücher gesammelt? Ein Sammler, sagt er, ist an vieles gebunden:
„An ein sehr rätselhaftes Verhältnis zum Besitz […]. Sodann: an ein Verhältnis zu den Dingen, das in ihnen nicht den Funktionswert, also ihren Nutzen, ihre Brauchbarkeit in den Vordergrund rückt, sondern sie als den Schauplatz, das Theater ihres Schicksals studiert und liebt.“
Ich hingegen sah in meinen Bücherstapeln weniger das Schicksal der Bücher als mein eigenes. Wann soll ich das bloß alles lesen? Lese ich nicht generell zu wenig? Sollte ich nicht mehr lesen? Nur wo fange ich an? Panisch schlage ich ein Buch auf. Oder doch ein anderes? Ich ziehe ein Buch aus dem Stapel, der Berg bricht zusammen.
Aber die panische Angst, zu wenig zu lesen, ist keine private. Sie ist ein kollektives Phänomen unserer digitalen Gegenwartsgesellschaft. Einer Gesellschaft, in der alle permanent lesen. Einer Gesellschaft, in der ein Großteil der Bevölkerung Zugang zu Büchern hat und diese lesen kann. Und doch denken wir, das Lesen sei an ein Ende gekommen. Wir sind umgeben von Massen an Büchern und haben den Eindruck, in einer postliterarischen Zeit zu leben. Ganz ähnlich wie die Bewohner der „Bibliothek von Babel“, die vor lauter Büchern kein einziges Buch mehr finden, gar verstehen können. Jorge Luis Borges veröffentlichte seine gleichnamige Erzählung über die düsteren Begleiterscheinungen einer unendlichen Bibliothek im Jahr 1941. Unser Zeitgefühl sagt uns: Die unendliche Bibliothek wird heute Wirklichkeit. In der digitalen Textflut geht uns das Buch abhanden. Wirklich?
Liest man Geschichten über das Bücherlesen, sind dies durchweg Geschichten der Beunruhigung. Unser angstvoller Blick auf das Lesen ist darum nicht verwunderlich. Wenn sich neue Medien des Lesens durchsetzen, ob dies die Schriftrolle, das gedruckte Buch oder der E-Reader sind, verändert sich auch die Art und Weise, wie wir lesen. Zwar liest jeder einen Text anders, aber die mediale Infrastruktur diszipliniert unseren Umgang mit ihm. In einem gedruckten Buch blättern wir, einen digitalen Text scrollen wir.
„Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken“, schrieb der fast erblindete Friedrich Nietzsche 1882 in einem Brief an seinen Freund Peter Gast. Die unheimliche Eigenständigkeit des Mediums, das uns einen Text bereitstellt, wird uns meist dann bewusst, wenn wir ein neues in den Händen halten. Wir machen es uns mit einem Buch auf dem Sofa bequem, schlagen es auf und nichts kann uns länger ablenken. Das materielle Buch als Medium gerät dabei selbst in Vergessenheit, außer es macht sich durch das Gewicht in unseren Händen bemerkbar. Lesen wir aber einen digitalen Text auf dem Smartphone, lädt uns das Gerät zur Abschweifung ein. Klickt man auf einen verlinkten Text, ist es nicht ungewöhnlich, einige Minuten später komplett woanders gelandet zu sein. Wir ärgern uns über das Smartphone als Medium, das perfide an unseren Gedanken mitarbeitet.
Eine kollektive Beunruhigung stellt sich meist dann ein, wenn wir auf neue Art und Weise mit einem Text verbunden werden. Matthias Bickenbach spricht in seinem Essay „Bildschirm und Buch“ von einer „medienhistorischen Schnittstelle“, an der wir uns befinden. Wir können nicht nur auf mehr Texte zugreifen als je zuvor. Wir haben heute auch ein großes Repertoire unterschiedlicher Techniken entwickelt, diese zu lesen. Neben das fokussierte Lesen eines Textes tritt das flüchtige Querlesen mehrerer Texte, neben das individuelle Lesen für sich tritt das kollektive Lesen mit anderen und neben das stille Lesen tritt das Hören eines Textes.
Aber es ist mehr als das. Hinter der Sorge, zu wenig zu lesen, verbirgt sich die tiefe Beunruhigung einer Gesellschaft, die sich vom sozialen Aufstiegsversprechen verabschiedet hat. Bis vor Kurzem einte die Generationen ein unausgesprochener Gesellschaftsvertrag: den Kindern soll es einmal besser gehen. Das Bücherlesen symbolisierte als Kulturtechnik eine soziale Aufwärtsdynamik. In den aufstiegsorientierten Mittelschichten ist es eine zentrale Bildungsaufgabe, die Kinder an das regelmäßige Bücherlesen heranzuführen. Für Bücher gibt es immer Platz im Kinderzimmer. Zum Vorlesen ist immer Zeit. Es kommt dabei weniger darauf an, was, sondern dass überhaupt gelesen wird.
Bücher sind Investitionen in die soziale Zukunft. Umso mehr, wenn soziale Aufstiege mühsamer und soziale Ungleichheiten an den gesellschaftlichen Rändern sichtbarer werden. Die panische Leseförderung der Eltern ist ein Symptom, dass sich das enge Band von Buch und sozialem Aufstieg gelockert hat. Bildungsinvestitionen setzen nicht mehr automatisch eine soziale Aufwärtsmobilität in Gang. Man möchte die Kinder nicht nur an eine wertvolle Freizeitbeschäftigung heranführen, um sie vor den Verlockungen digitaler Angebote zu schützen. Dahinter verbirgt sich die kollektive Sorge, dass mit dem Ende des Lesens auch das Ende des sozialen Aufstiegsversprechens einhergeht.
Die Praxis des Lesens integriert in moderne Gesellschaften, sie führt aber ebenso die Möglichkeit zur sozialen Desintegration vor. Als das Lesen im 18. Jahrhundert in bürgerliche Schichten vordrang, schrieb der Schriftsteller Karl Philipp Moritz das von Hoffnungen und Rückschlägen geprägte Leben des Anton Reiser nieder. Der in vier Teilen zwischen den Jahren 1785 und 1786 erschienene Roman präsentiert uns den Lebensweg Anton Reisers nicht, wie im zeitgenössischen Bildungsroman, als eine lineare Aufstiegsgeschichte hin zur Vervollkommnung. Seine soziale Laufbahn gleicht einer Welterfahrung, in der Ungleichzeitigkeiten nebeneinander stehen, in der sich nichts bewegt und sich doch alles verändert.
Der junge Anton Reiser, der in ein ärmliches, streng pietistisches und von Zwietracht geprägtes Elternhaus geboren wurde, versucht seinem elenden Dasein zu entkommen, indem er in Bücherwelten flüchtet:
„Durch das Lesen war ihm nun auf einmal eine neue Welt eröffnet, in deren Genuß er sich für alle das Unangenehme in seiner wirklichen Welt einigermaßen entschädigen konnte. Wenn nun rund um ihn her nichts als Lärmen und Schelten und häusliche Zwietracht herrschte oder er sich vergeblich nach einem Gespielen umsah, so eilte er hin zu seinem Buche.
So ward er schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine unnatürliche idealische Welt verdrängt, wo sein Geist für tausend Freuden des Lebens verstimmt wurde, die andre mit voller Seele genießen können.“
Die neue, wenn auch fiktive Welt, die sich Anton Reiser im Romanlesen erschließt, entschädigt ihn für die Zumutungen der wirklichen Welt. Doch das Lesen verstärkt gleichzeitig die Spannung, die seinem Leben eingeschrieben ist. Er führt ein doppeltes Leben, ein inneres und ein äußeres. Ein Leben in Büchern, in dem das eigene Schicksal als gestaltbar erfahren wird, und ein Leben in der Wirklichkeit, das durch Disziplinierung und Unterwerfung geprägt ist.
Über das Bücherlesen übt Anton Reiser sich in autonomer Selbstregierung, er existiert losgelöst von seiner beengten Existenz. Doch der Freiheitsgewinn durch das Buch isoliert ihn gleichzeitig von der Gesellschaft. Die Bücher setzen eine soziale Imagination in Gang, die ihn noch härter mit der Ungleichheit der Welt konfrontieren, in die er hineingeboren wurde.
Heute mag das Schicksal Anton Reisers befremdlich wirken. Lesen ist weitgehend demokratisiert, soziale Zugangschancen wurden ausgebaut. In den deutschen Nachkriegsjahrzehnten des 20. Jahrhunderts strebte die Gesellschaft auf der Grundlage eines gesteigerten wirtschaftlichen Wohlstands bis in die 1970er Jahre nach rechtlicher und sozialer Gleichstellung. Ulrich Beck griff in seinem Werk Risikogesellschaft die soziale Mobilität jener Zeit mit dem Bild des „Fahrstuhleffekts“ auf: Für viele ging es aufwärts, auch wenn die Klassenschranken dabei keineswegs abgebaut wurden. Der gestiegene materielle Wohlstand, verbunden mit wachsenden sozialen Rechten, weckte in den unteren Schichten neue Bedürfnisse. Diese umfassten neben dem Auto, Urlaub und Eigenheim auch kulturelle Teilhabe, die zuvor den Ober- und Mittelschichten vorbehalten war.
Dank wirtschaftlicher Prosperität, steigenden Löhnen, einem verbesserten Lebensstandard und einer Ausweitung der Bildung entstand in der Bundesrepublik eine Lesegesellschaft. Das Lesen von Büchern wurde zum Symbol für sozialen Aufstieg und Mobilität. Im sozialistischen Nachbarland verwendete man zur Selbstbeschreibung das Bild des „Leselandes“. Tatsächlich wurde in der DDR die Infrastruktur zur Leseförderung flächendeckend ausgebaut. Allerdings wurde Literatur als bedeutsame Sozialisationsinstanz nicht nur gefördert, sondern zugleich streng kontrolliert. In beiden Ländern aber wurde das Lesen von Büchern eine bedeutungsvolle Alltagsbeschäftigung. Selbst der Aufschwung der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, vermochte daran zunächst wenig zu ändern. Das Bücherlesen hatte sich zu einem regelmäßigen Freizeitverhalten auch bildungsferner Klassen entwickelt.
Wie viel und was man liest, war gleichzeitig Maßstab für den sozialen Status. Lesen war in der Gesellschaft der Gleichen ein Mittel der sozialen Angleichung, das systematisch Differenzen hervorbrachte. Die partielle Nivellierung von Statushierarchien beseitigte eben nicht reale Ungleichheiten. Gerade der egalitäre Anspruch, dass keinem der Zugang zur Literatur verwehrt sein sollte, sensibilisierte für bestehende Ungleichheiten. Verschwinden die großen Unterschiede im Leseverhalten – ob überhaupt zum Buch gegriffen wird –, dann treten die kleinen umso deutlicher hervor: Was gelesen wird und wie gelesen wird. Merve Emre beschreibt, wie sich in den Nachkriegsjahrzehnten in den Hochschulen das Regulativ der „good readers“ verfestigte, die sich die textuellen Tiefenstrukturen in einer dichten Lektüre erschlossen. In Abgrenzung von „bad readers“, die sich leidenschaftlich mit dem Gelesenen identifizierten und von ihm berauschen ließen – wobei letztere zweifelsohne in der Mehrheit waren.
Die Autorin Ulla Hahn hat in ihrer Romanreihe über die aufstrebende Hilla Palm die Figur einer sozialen Aufsteigerin entworfen, einer lesenden Aufsteigerin. Gleichzeitig führt die Figur Hilla Palm die Beharrungskräfte einer Klassengesellschaft vor, in der das Lesen noch als Privileg der Gebildeten galt. Hilla, Tochter eines ungelernten Fabrikarbeiters und einer Putzfrau, liest, nein verschlingt als Kind die deutsche Klassik, Lessing und Schiller. Die gelben Reclam-Hefte verehrt sie mit einer religiösen Ehrfurcht wie die katholische Mutter ihre Devotionalien. Doch in dem vom Mangel geprägten Umfeld gilt das Lesen als eine sinnlose Beschäftigung, die nur Zeit und Energie vergeudet. In dem 2001 erschienenen ersten Roman Das verborgene Wort wird die Gewalt der sozialen Ordnung an der jungen Hilla Palm eindrücklich vorgeführt, als sie es sich zum Lesen in die elterliche Wohnstube begibt:
„Um hinterm Hühnerstall zu sitzen war es zu verregnet, ich hatte es mir im Wohnzimmer bequem gemacht, las mit erhobener Stimme aus Schillers ‚Räubern‘, als die Tür aufging. Der Vater. Viel zu früh. Zu spät, mich aus dem Staube zu machen. Der Vater sah grau und trocken aus, brüchig, versteinert. Nur weg hier. Ich rutschte vom Sofa, wollte mich an ihm vorbeidrücken, als er den Gürtel schon aus der Hose gezogen hatte und auf meine Hand mit dem Reclamheftchen pfeifen ließ. Häs de nix Besseres ze dun, als hie op dä fuule Huck ze lije, schrie er. Das Heftchen fiel mir aus der Hand, heulend drückte ich die gezeichnete Rechte mit der Linken an die Wange, duckte mich untern Tisch. Sah die Hand des Vaters das Heft ergreifen, hörte, wie er es einmal, zweimal zerriß, sah die verschmierten, mit Gummi aus Autoreifen besohlten Schuhe, die Tür knallte hinter ihnen zu.“
Mit seinen Schlägen vollzieht der Vater stellvertretend die soziale Herrschaft, wegen der sich die unteren Klassen dem Notwendigen fügen müssen. Der Lesehunger der Tochter irritiert die Sozialordnung, auch sie soll dem Klassenschicksal nicht entkommen. Das Zerreißen des Heftes ist eine soziale Geste, sich dem Unausweichlichen zu fügen. Symbolisiert doch gerade die immobile Tätigkeit des Lesens in der deutschen Nachkriegsgesellschaft eine soziale Aufwärtsmobilität, welche die Tochter zu einer Fremden in den eigenen Wänden macht. Zwar sitzt sie in der Wohnstube in einer Arbeitersiedlung nahe Köln, doch mit dem Reclam-Heft in ihren Händen überschreitet sie symbolisch die sozialen Grenzen. Am Ende des ersten Bandes besucht sie nach einer trostlosen Lehre trotz Widerstand aus dem Elternhaus ein Aufbaugymnasium. Hilla Palm personifiziert damit einen historischen Wendepunkt, an dem der Lesehunger eng an das soziale Aspirationsstreben gebunden war.
Doch diese Zeit kam in den 1980er Jahren an ihr vorläufiges Ende. Die Klassen fuhren nicht mehr gemeinsam mit dem Aufzug nach oben. Nun befand sich jeder allein auf einer nach unten fahrenden Rolltreppe, gegen die man anlaufen musste. Das Bild, mit der Oliver Nachtwey die kollektive Gefühlslage einer „Abstiegsgesellschaft“ beschreibt, zeichnet eine andere Dynamik sozialer Mobilität. Der soziale Status ist stärker an den flexiblen Einsatz individueller Ressourcen rückgebunden. Man kann sich nicht mehr auf Zugehörigkeiten berufen, alle werden in Rangfolgen der Wertigkeit gestellt, die vordergründig allein der Leistung gehorchen. Parallel wurde der Sozialstaat liberalisiert und soziale Rechte stärker an individuelle Leistungen und damit an Bedingungen geknüpft. Wer seinen Status erhalten möchte, muss flexibel sein und sich beständig neu anpassen. Auf der Rolltreppe stehen zu bleiben bedeutet automatisch, nach unten zu fahren.
Die Lesegesellschaft jener Zeit war geprägt durch ein Nebeneinander von alten und neuen Geschmackspräferenzen. Sie erscheint zugleich beweglich und starr. Auf der einen Seite bestehen Lesemilieus der alten Klassengesellschaft in modernisierter Gestalt fort. Dazu gehörte das kleinbürgerliche Milieu, das am Vertrauten und Soliden orientiert war und Bücher nicht in der Sortimentsbuchhandlung kaufte, sondern im Supermarkt oder in Buchclubs, wo statt dem Experimentellen das Bekannte zu finden war und ist. Wobei nur noch selten gelesen und mehr ferngeschaut wurde. Die Geschmackspräferenzen änderten sich wenig, die praktische Nutzung änderte sich hingegen drastisch.
Auch konservativ-gehobene Milieus hielten angesichts voranschreitender Liberalisierung an traditionalistischen Lektürepräferenzen fest. Man ging in die alteingesessene Buchhandlung vor Ort, konsumierte gern bibliophile Schmuck- oder Gesamtausgaben. Das gemütliche Lesen galt als kleinbürgerlich, man las konzentriert, in der Erwartung, gebildet zu werden. „Literatur“ war ein wertender Kampfbegriff, der gegen den kulturellen Wandel in Stellung gebracht wurde. Gegen den Geschmack der Vielen, der über die Massenmedien bis in die bürgerlichen Wohnzimmer vordrang, wurde das Lesen eine fast widerständige Technik, durch die man sich hervorhob. Obwohl man im Alltag ebenfalls mehr fernsah als las. Nicht unbedingt das Lesen als Alltagspraxis, eher der Buchbesitz in den Bücherregalen markierte den Unterschied zu anderen.
In den aufstiegsorientierten Milieus wurde das Lesen stattdessen dynamisiert und stärker in eine individualisierte Lebensführung eingepasst. Die Buchlektüre symbolisierte weniger das, was man ist, sondern das, was man werden will. Das Milieu der neuen Arbeitnehmerschaft lehnte Konformitätsansprüche zugunsten einer freien und flexibel ausgelegten literarischen Geschmacksbildung ab. Ebenso wie die individualisierte Gesellschaft, die sie vor viele Optionen und Entscheidungen stellte, stand die eigene Lektürewahl vor einer großen Zahl an Alternativen. Das, was einem gefiel, das las man auch. Dabei zeigte sich, was sich schon in der bürgerlichen Gesellschaft abzeichnete: Frauen und Männer lasen anders. Während Frauen gern zu jenen Romanen griffen, die eine identifikatorische Faszination erlaubten, lasen Männer – sofern sie überhaupt Romane lasen – bevorzugt Spannung erzeugende Romane.
In der aufstrebenden Mittelschicht war das Lesen weniger hedonistisch orientiert. Lesen galt eher als eine Investition in den sozialen Status. Die Aufstiegsorientierung übersetzte sich in die Buchlektüre. Man konsultierte allerdings nicht, wie noch die junge Hilla Palm, den Kanon der Bildungseliten. Es gab neue Genres, die den eigenen Aufstiegsaspirationen besser entsprachen. Nicht nur fehlte die Energie zur konzentrierten Lektüre nach einem langen Arbeitstag, man wollte sich überdies anders weiterbilden, nämlich unterhaltend. Sachbücher statteten mit dem nötigen Wissen aus, Ratgeber mit den Techniken der antizipierten Sozialposition. Ein leistungsorientiertes Arbeitsethos schlug sich in den literarischen Geschmackspräferenzen nieder.
Mit den aktuellen Diskussionen um soziale Polarisierung, durch die unsere Gegenwartsgesellschaft in voneinander getrennte Lager gespalten sei, verändert sich auch unser Bild von sozialer Mobilität. Statt eine nach unten fahrende Rolltreppe emporzulaufen, steigen wir in jüngster Zeit in ein altgedientes Beförderungsmittel: den Paternoster. Die einzelnen Kabinen sind hier durch einen Umlauf miteinander verbunden. Während die einen nach oben fahren, geht es parallel für die anderen in derselben Zeit nach unten. In der Sozialdynamik beobachtet Andreas Reckwitz ein Nebeneinander von sozialen Aufstiegen und Abstiegen, neben aufstrebenden Hochqualifizierten wächst die Zahl abgehängter Niedrigqualifizierter. Es sind weniger Bilder der Nivellierung, der Angleichung, sondern jene der Differenzen und Unterschiede, die unsere Wahrnehmung auf Gesellschaft und unsere Stellung in ihr heute prägen. Klasse kehrt als Sortiermechanismus in das soziale Gefüge zurück.
Spiegeln sich die gewachsenen sozialen Gräben aber in unserem Umgang mit Büchern wider, in unseren intimen Präferenzen und Neigungen? Auf eine gebrochene, widersprüchliche Art und Weise. Doch gerade die Bruchlinien sind es, an denen sich soziale Differenzen gut beobachten lassen. Denn die Abstände zwischen jenen, die Bücher lesen, und jenen, die sie theoretisch lesen könnten, dies aber nicht tun, werden größer. Bücher werden von wenig Menschen viel und von immer mehr Menschen nicht mehr gelesen. Parallel hat sich das Spektrum dessen, was und wie wir lesen, stark ausdifferenziert. Mit digitalen Medien steigt die Wahlfreiheit und mit ihr die Variationsbreite. Wir wechseln zwischen dem Buch, dessen Seiten wir umblättern, und dem Smartphone, über dessen Bildschirm wir wischen. Wir lieben Jane Austen und wir lieben Colleen Hoover. Während unser Umgang mit Büchern inklusiver wird, schließt sich auf der anderen Seite der soziale Kreis derjenigen, die lesen. Ist unsere Lesegesellschaft heute gespalten in zwei polare Lager? Das der Lesenden und das der Nichtlesenden?
Während auf der einen Seite das Desinteresse gegenüber dem Bücherlesen zunimmt, wächst auf der anderen Seite die passionierte Identifikation mit dem Buch als materiellem Objekt. Jessica Pressman nennt dieses Phänomen „Bookishness“. Sie geht davon aus, dass die besessene Beschäftigung mit dem Buch das Symptom einer digitalisierten Kultur ist, in der Nähe, Intimität und Authentizität neu verhandelt werden müssen. Das gedruckte Buch wird zu einem Fetischobjekt, auf das bedroht geglaubte Erfahrungen projiziert werden. Der Geruch des Papiers, das haptische Umblättern der Seiten – die gesamte schwere Materialität des Buches gilt als geglückte Resonanzbeziehung in einer digitalen Kultur der Unnahbarkeit.
Der Bedeutungsschwund des Buchs auf gesamtgesellschaftlicher Ebene geht offenbar einher mit einer Aufwertung des Buchs in leseaffinen Sozialmilieus. In der digitalen BookTok-Community wird das Bücherlesen zu einer kollektiven Lebensform und Identität aufgewertet. BookTok-Bestseller rufen in ihrer Buchgestalt aus sanften Pastelltönen und Farbschnitt eine ästhetische Erlebniswelt hervor. Die materielle Form steht für die Intensität, mit der die Bücher gelesen werden. Sie werden obsessiv verschlungen, in einer Nacht durchgelesen. Man kann nicht anders, denn man ist „Book-Addict“. Paradoxerweise ist es gerade die gesellschaftliche Entwertung der kulturellen Praxis des Lesens, die es als geeignete Quelle der Singularisierung auszeichnet.
Unser Umgang mit Büchern ist geprägt von der Gleichzeitigkeit von Öffnung und Schließung, von Demokratisierung und Distinktion. Wir sind toleranter gegenüber Lesevorlieben anderer und fürchten uns eher, als elitär wahrgenommen zu werden. Im Gespräch mit anderen ist man stärker bemüht, Geschmacksunterschiede herunterzuspielen statt den eigenen, den guten Geschmack zu betonen. Damit kommt es zu einer Umkehr unserer Rechtfertigung, warum wir etwas lesen – oder warum wir etwas nicht lesen. Eine starke Verteidigung des männlich dominierten Literaturkanons wird eher auf Stirnrunzeln stoßen als die offen zugegebene Faszination für Fantasy-Romane. Dadurch verschieben sich die sozialen Grenzen, verschwunden sind sie damit keineswegs. Statt der ästhetischen hebt man die eigene moralische Überlegenheit durch den offenen und inklusiven Geschmack hervor.
Ist es überhaupt noch entscheidend für unsere soziale Identität, was wir lesen? In den 1990er Jahren ging man davon aus, dass sich die oberen Statusgruppen durch ein großes Repertoire an genreübergreifenden Kulturinhalten auszeichnet. Diejenigen, die im Paternoster nach oben fuhren, galten als kulturelle Omnivoren, kosmopolitische Allesfresser. Während denjenigen, die nebenan nach unten fuhren, eine einseitige Verkostung von Kulturprodukten unterstellt wurde. Doch ganz so einfach ist es nicht. Zwar konnte man in den aufstrebenden Milieus zu Beginn des neuen Jahrtausends keine klaren Präferenzen für ausgewählte Genres mehr feststellen, doch was sie einte, war ein besonderer Lesestil. Es war egal, was man las, entscheidend war eine intensivierte ästhetische Erfahrung, die ein starkes emotionales Involvement auslöst.
Die ästhetischen Kämpfe, die heute geführt werden, sind also andere, wenn aufstiegsorientierte Milieus grenzüberschreitend lesen. Aufwertungen und Abwertungen werden subtiler, verdeckter kommuniziert. Ist es für das eigene Geschmacksurteil weniger entscheidend, in welchem Genre das gelesene Buch verortet ist, bilden sich innerhalb der Genres Hierarchien. Ich besuchte mit Studierenden eines Seminars eine große Buchhandlung. Statt sich vor den Büchertischen mit den Neuerscheinungen der Gegenwartsliteratur herumzudrücken, versammelte sich der größte Teil vor den Regalen mit Young-Adult-Romanen. Es entflammten leidenschaftliche Streitgespräche über Fourth Wing, einem Weltbestseller von Rebecca Yarros. Die Fantasy-Saga wurde mit anderen abgeglichen, die Studierenden verfügten nicht nur über einen umfangreichen Kriterienkatalog, ebenso gab es ein Rangsystem, in dem die Romane einsortiert wurden. Es wirkte fast wie ein Gespräch unter Literaturkritikern, nur dass die Maßstäbe, was gut und schlecht ist, komplett andere waren. Genreinterne Unterscheidungspraktiken beschränken sich keineswegs auf populäre Genres. Als „neuenMidcult“ bezeichnet der Literaturwissenschaftler und Poptheoretiker Moritz Baßler Literatur, die eine hochkulturelle Wertigkeit prätendiert, ohne es zu sein. Alte Unterscheidungen von High und Low, von Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur, haben ihre Geltungskraft eingebüßt.
Soziale Unterschiede im Lesen zeigen sich hingegen in der Art und Weise, wie wir Bücher in unseren Alltag integrieren, genauer gesagt: integrieren können. Sichtbar wird dies an der Zeit, die wir in eine Buchlektüre investieren; die wiederum abhängig ist von der frei verfügbaren Zeit. Der Überfülle des kulturellen Angebots steht eine gewachsene Zeitknappheit gegenüber. Private Ausgaben für Dienstleistungen, die Menschen mehr freie Zeit verschaffen (durch Kinderbetreuung oder Hilfe im Haushalt), bilden in diesem Sinn kulturelle Klassengrenzen. In den sozialen Medien kommunizierte Leselisten sind nicht nur in der qualitativen Auswahl der Titel ein soziales Klassifikationsmittel, sondern ebenso in der schieren Quantität der angeführten Bücher. Soziale Unterschiede machen sich aber ebenfalls an der Tiefe und Intensität des Literaturkonsums bemerkbar. Neben der Anzahl gelesener Bücher wird die enthusiastische Rezeption hervorgehoben, ein aktives Engagement für Literatur. Man liest nicht nur Literatur, sondern versteht sich als Teil einer literarischen Gemeinschaft.
Die Lesegesellschaft der Gegenwart ist von einem Nebeneinander widersprüchlicher Entwicklungen geprägt. Lesen ist einerseits demokratisiert, andererseits verstärken sich bestehende Ungleichheiten und entwickeln sich andere neu, die Lesende von Nichtlesenden trennen. Die Tatsache, dass Lesen in der Geschichte der Schriftkultur wiederkehrend für Beunruhigung sorgt, verweist auf die Ambivalenz der Kulturtechnik Lesen. Lesen fördert soziale Partizipation und schärft darum das Bewusstsein für Klassendifferenzen.