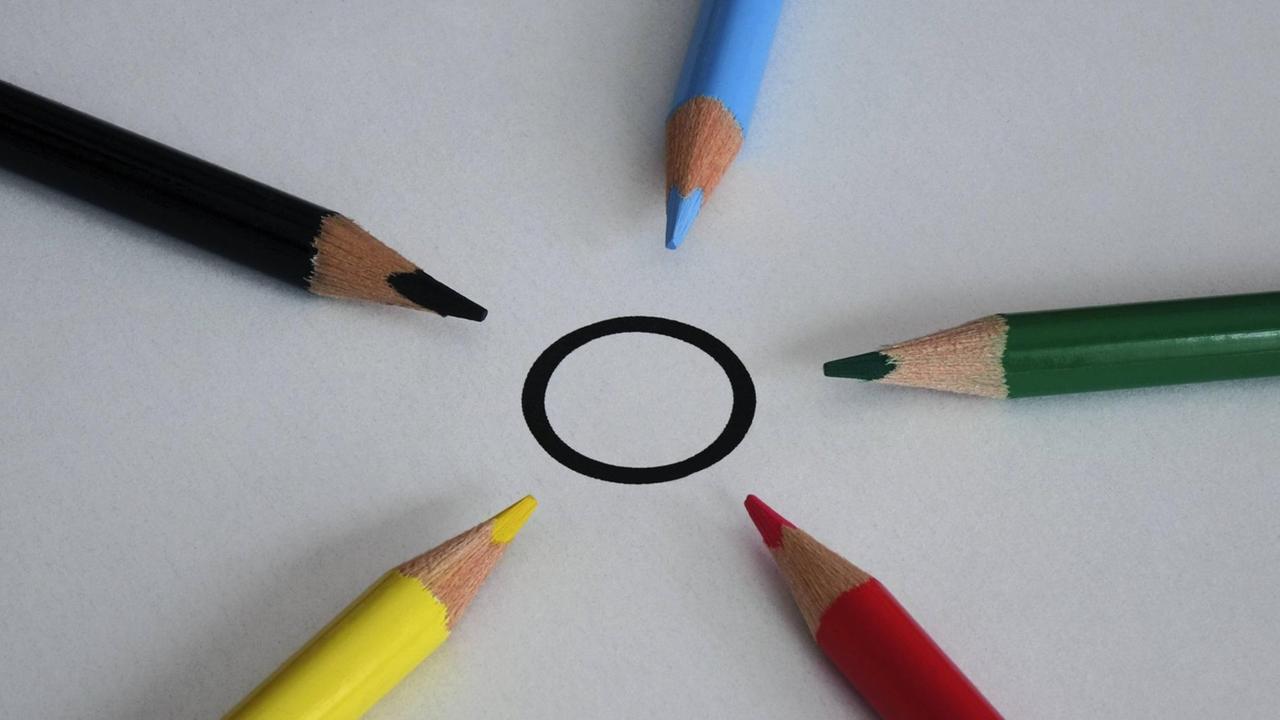Im Januar 1966, nachdem die Verfassungsklage der SPD-geführten Hessischen Landesregierung gegen die geltende Parteienfinanzierung in Karlsruhe eingereicht worden war, stellte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD Gerhard Jahn klar: Immer schon seien die Sozialdemokraten gegen die umfassenden Hilfen aus der Staatskasse gewesen.
"Es geht ja nicht darum, dass der Staat die Parteien trägt, sondern die Parteien sollen ja den Staat tragen."
Und die Parteien wiederum sollten dieser Logik zufolge im Wesentlichen von ihren Anhängern und Mitgliedern getragen werden.
"Und das beinhaltet die Notwendigkeit, dass sie entsprechend ernsthafte Bemühungen und Anstrengungen unternehmen, um ihrerseits aus eigener Kraft erhalten und ihre Arbeit finanzieren zu können. Und das, was der Staat dazu gibt, darf nur eine Ergänzung sein."
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Staat die gesamte Arbeit der SPD, ebenso wie die der Union und der FDP subventioniert: Wer viele Wähler hatte, bekam hohe Zuschüsse.
Bereits 1958 hatte das Bundesverfassungsgericht die daneben noch bestehende Praxis beendet, Zuwendungen an Parteien großzügig steuerlich zu begünstigen, weil dies Parteien mit finanzkräftigen Anhängern bevorzugt hatte. Damit war aber die Frage der Parteienfinanzierung noch nicht abschließend geklärt. Denn die Karlsruher Richter argumentierten damals, dass der Staat zwar nicht verpflichtet sei, politische Parteiarbeit zu bezahlen, dass es ihm aber grundsätzlich freistehe,"für die politischen Parteien finanzielle Mittel von Staats wegen zur Verfügung zu stellen."
Gelder flossen direkt in die Kassen der Parteien
Daraufhin stellte der Bundestag Mittel im Haushalt bereit, die direkt in die Kassen der Parteien flossen – dies allerdings ohne genaue Vorgaben durch ein Parteiengesetz. Bis die Landesregierung in Hessen 1966 klagte mit dem Ziel, ihrem politischen Gegner, der Union, einen Großteil der Geldhähne zuzudrehen, während sie selbst weniger betroffen sein würde. Seit Jahrzehnten nämlich setzten die Sozialdemokraten auf ihre Mitglieder und deren lebenslange, emotionale Bindung zur SPD.
Am 19. Juli 1966 sprach das Bundesverfassungsgericht sein Urteil.
"Es ist mit dem Grundsatz der freien und offenen Meinungs- und Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen nicht vereinbar, den Parteien Zuschüsse aus Haushaltsmitteln des Bundes für ihre gesamte Tätigkeit zu gewähren und die dauernde finanzielle Fürsorge für die Parteien zu einer Staatsaufgabe zu machen."
Allerdings stellten die Karlsruher Richter auch klar, dass nach den Erfahrungen aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft den Parteien nun eine privilegierte Stellung zukam: Sie waren zu einer verfassungsrechtlichen Institution erhoben worden. Da ohne die politischen Parteien Wahlen nicht durchgeführt werden können, wäre es zulässig, wenn der Bund den Parteien den Wahlkampf aus Steuermitteln finanzieren würde. Die unmittelbaren Folgen für die FDP und die Union waren drastisch. Mangels Mitgliedern fehlten plötzlich Einnahmen, so sagte es der Bundesgeschäftsführer der CDU Konrad Kraske Ende Juli 1966:
"Die Situation in der CDU lässt sich gar nicht verharmlosen. Für uns fallen wichtige Mittel aus, die wir, insbesondere für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit verwandt haben. Wir haben diese Arbeit in den letzten Tagen drastisch einschränken müssen und wir werden das auch weiterhin tun, mindestens so lange, bis es uns gelungen ist, ein anderes Finanzierungssystem aufzubauen."
Unter dem Druck der neuen Lage tat der Bundestag, was die Hessische Landesregierung in ihrer Verfassungsklage gefordert hatte: Er verabschiedete im Juli 1967 erstmals ein Parteiengesetz, das auch die Frage der Wahlkampfkostenerstattung aus dem Bundeshaushalt und deren Höhe regelte. Für Union und FDP bedeutete das eine gewisse Linderung, aber noch nicht das Ende der klammen Kassen. Bundesfamilienminister Bruno Heck, CDU, versprach einen Richtungswechsel.
"Wir werden versuchen, wesentlich mehr Mitglieder zu bekommen, und wir werden natürlich versuchen, mehr Spenden zu bekommen."
Doch das Spenden war für Normalverdiener wenig attraktiv: Nur die Hälfte ließ sich steuerlich absetzen und war zudem noch limitiert. Nach dem Urteil von 1966 warben die bürgerlichen Parteien deshalb verstärkt um große Konzerne. Die versprachen sich mit ihrer Spende - neben der Steuerersparnis - einen direkten Einfluss auf politische Entscheidungen. Ein Weg, der zu den großen Spendenskandalen der achtziger und neunziger Jahre führte.