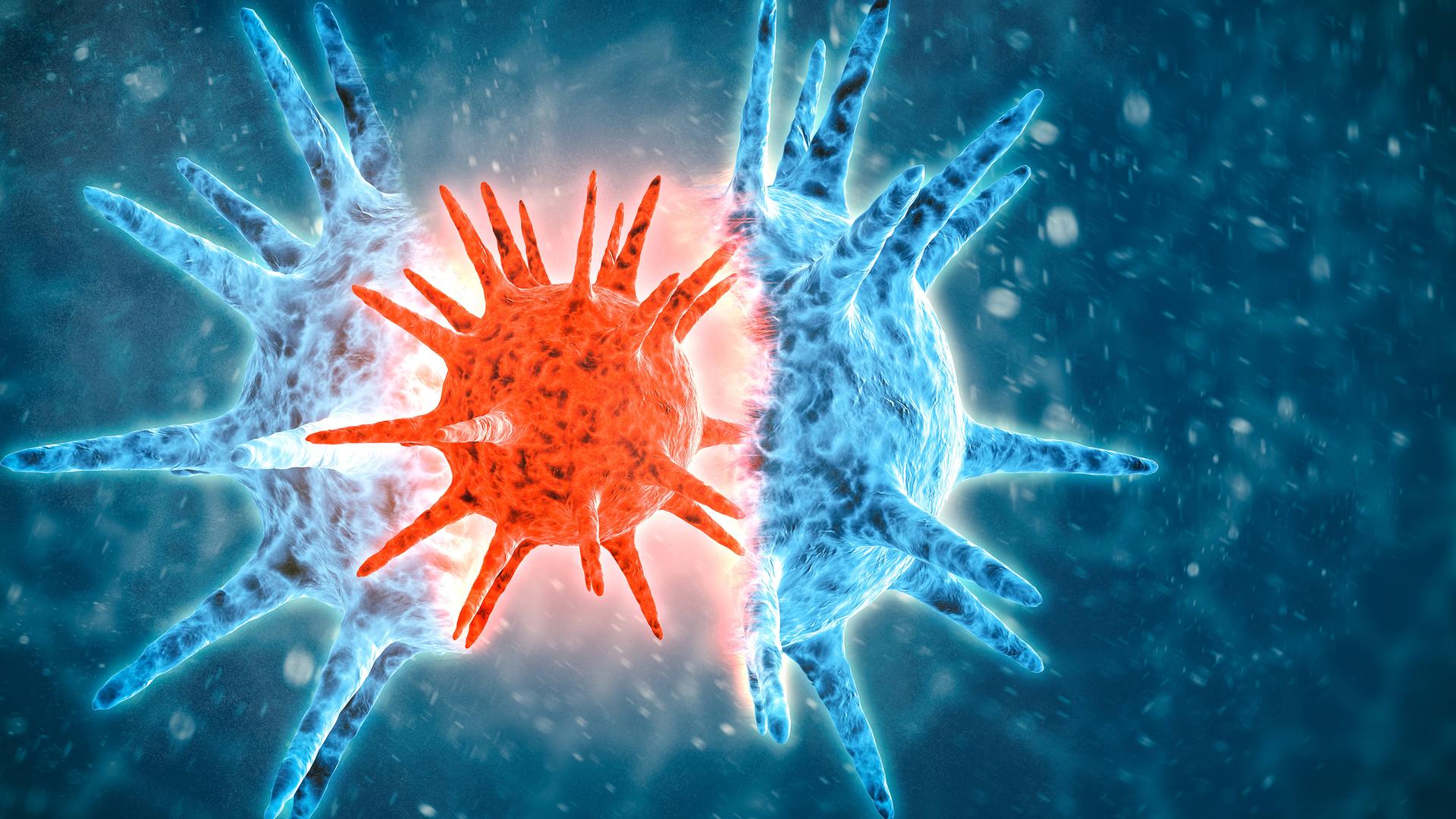Beim EU-Gipfel ab Freitag verhandeln Europas Staats- und Regierungschefs über ein beispielloses Finanzpaket: Rund 1,8 Billionen Euro schwer sind die Vorschläge für den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU. Unter anderem geht es um den Vorschlag der EU-Kommission, 750 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen und das Geld dann in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise zu stecken. Viele Punkte sind noch umstritten - und nötig ist eine einstimmige Entscheidung der 27 Mitgliedstaaten.
Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Gabriel Felbermayr betonte im Interview mit dem Dlf die Wichtigkeit des Sondergipfels für die Europäische Union. Mit dem 750-Milliarden-Programm betrete die Staatengemeinschaft Neuland. Während die Union bislang eher Strukturpolitik betrieben habe, wolle sie nun auch Konjunkturpolitik betreiben, um die Wirtschaft zu stützen und anzukurbeln. Komplett neu sei auch, dass in großem Umfang Geld an den Kapitalmärkten aufgenommen werden solle.
Daher sei es wichtig, "dass die EU die richtigen Weichen stellt. Denn was hier passiert, wird die EU über die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte verändern." Vor allem müsse sichergestellt werden, dass das Geld, in den Ländern, in denen es gebraucht wird, auch tatsächlich die wirtschaftlichen Aussichten verbessert und nicht einfach zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werde. Die Vorschläge der EU-Kommission dazu seien jedoch noch nicht ausreichend.
Lesen Sie hier das komplette Interview im Wortlaut.
Jörg Münchenberg: Herr Felbermayr, wie wichtig ist dieser Gipfel für die Europäische Union?
Gabriel Felbermayr: Es ist ein ganz entscheidender Gipfel, denn mit dem "Next Generation EU"-Programm, mit den angesprochenen 750 Milliarden betritt die EU ja Neuland. Es wird Geld in die Hand genommen, um zu stabilisieren. Die Konjunkturpolitik soll auch in Europa gemacht werden, nicht nur in den Mitgliedsstaaten. Bisher hat Europa ja vor allem Strukturpolitik gemacht, langfristige Dinge finanziert. Das soll sich jetzt ändern. Es soll Geld aufgenommen werden auf den Kapitalmärkten in einem großen Ausmaß. Wir reden da von mehr als fünf Prozent des europäischen Bruttoinlandsproduktes. Auch das etwas komplett Neues. Es ist wichtig, dass die Europäische Union hier die richtigen Weichen stellt, denn was hier passiert, wird die EU über die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte entscheidend verändern.
Münchenberg: Warum tut sich Europa trotzdem so schwer, sich an bestehende Regeln zu halten? Denn genau das fordern ja die sogenannten "sparsamen Vier".
Felbermayr: Es gibt natürlich politische Probleme bei diesen Regeln. Sie sind in den Ländern, wo diese Regeln eingehalten werden müssen, hoch unpopulär. Das haben wir ja im Zuge der Euro-Schuldenkrise gesehen. Wir erinnern uns an die Bilder, die damals durch die Presse gingen, die Troika, die zusammengesetzt war aus Kommission, Weltwährungsfonds und Europäischer Zentralbank, die die Regeln überwachen sollte. Die wurde in Italien, in Griechenland mit großer Skepsis begrüßt. Man lässt sich wenig reinreden.
EU-Finanzpaket: Bislang wenig Mehrwert für Europa
Münchenberg: Entschuldigung! Ist das ein Argument, um zu sagen, weil Regeln unpopulär sind, müssen sie auch nicht mehr eingehalten werden?
Felbermayr: Nein, das ist kein Argument. Das erklärt, warum die Europäische Union hier Schwierigkeiten hat. Aber Sie haben vollkommen recht: Es muss Regeln geben. Es ist kaum den Nettozahlern in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Schweden und so weiter zuzumuten, dass man sagt, ihr überweist einfach mal Geld in die Hauptstädte im Süden und die machen damit was sie wollen. Es muss klar sein, dass dieses Geld einen Mehrwert stiftet, dass es tatsächlich die wirtschaftlichen Aussichten dieser Länder verbessert. Und wenn man jetzt im schlechtesten Fall diese Gelder einfach verwendet zum Stopfen von Haushaltslöchern, dann ist das etwas, das man den Steuerzahlern in den Nordstaaten kaum erzählen kann.

Und es geht um große Summen. Wenn wir den Plan der Europäischen Kommission ansehen, wie er vor den Vorschlägen des Herrn Michel ausgesehen hat, dann würde ja Deutschland etwa vier Prozent seines Bruttoinlandsproduktes in den nächsten Jahren zusätzlich nach Europa überweisen. Für andere Länder ist das ähnlich groß, die Niederlande, Irland sogar noch ein Stück mehr, Luxemburg noch ein bisschen mehr. Das heißt, da wird schon den Steuerzahlern in den Nettozahlungsländern viel abverlangt, und ich denke, es gibt da durchaus ein Recht zu fragen: Was wird mit dem Geld gemacht? Da ist der Vorschlag der Kommission und die Verbesserungsideen von Herrn Charles Michel noch nicht ausreichend.
Das auch aus ökonomischer Perspektive kritisch zu sehen: Da ist wenig an Mehrwert für Europa dabei. Die Überwachungsregeln sind schwach und es kommt das Geld auch zu spät, um wirklich eine Stabilisierung zu leisten. Wir gehen davon aus, dass 70 Prozent der Zahlungen erst ab dem Jahr 2022 wirklich anfallen, und dann sollte doch eigentlich die akute Krise schon vorbei sein. Das heißt, das Geld fließt dann, wenn die Staaten ohnehin wieder wachsen. Es kommt nicht rechtzeitig.
"Wir brauchen auf europäischer Ebene eine Stabilisierungsfunktion"
Münchenberg: Überrascht Sie da die deutsche Position, wenn es jetzt plötzlich heißt, wie auch im Beitrag eben gehört, man soll doch am Ende über den eigenen Schatten springen, sprich ein bisschen die Aufforderung an die "sparsamen Vier", nicht ganz so streng zu sein?
Felbermayr: Ja, das überrascht. Es überrascht auch viele aus dem Ausland, die hier doch eine Kehrtwende in Deutschland sehen. Bisher hat sich Deutschland ja gewehrt gegen schuldenfinanzierte europäische Programme, hat immer auch auf diese Bedingungen, die Konditionalität bestanden. Jetzt geht man hier einen anderen Weg. Ich finde, das ist im Prinzip auch richtig. Ich glaube, wir brauchen auf europäischer Ebene eine Stabilisierungsfunktion, die bisher nicht existiert hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Fehler, die früh gemacht wurden in der Coronakrise, als es Exportkontrollen gab, als man den italienischen Hilferufen nicht wirklich eine politische Antwort entgegengesetzt hat, dass man da auch Fehler wiedergutmachen muss. Ich glaube, dass im März es schon eine Schockwelle gegeben hat, als man gesehen hat, dass Italien Gefahr lief, den Zugang zu den Finanzmärkten zu verlieren, und das, weil diese europäischen Kapazitäten zu klein sind.
Wir brauchen mehr Geld in Brüssel, das denke ich schon, um Krisen ausstabilisieren zu können, und das ist wohl in Berlin angekommen. Deutschland hat überhaupt kein Interesse daran, dass der Binnenmarkt wieder stärker fragmentiert, dass wir neben dem Brexit vielleicht einen Italexit haben. Das wäre für uns verheerend. Deswegen ist das Geld im Grunde gut investiert. Wir müssen aber sehr darauf achten, dass tatsächlich auch ein europäischer Mehrwert daraus entsteht, so dass das Geld nicht nur an die Staaten ausbezahlt wird und dort politischen Nutzen stiftet, sondern dass auch ökonomisch klar wird, Europa betritt mit diesen Mitteln Neuland, wird stabiler, resilienter, und vor allem schafft es Reformen durchzuführen, die am Ende die Wachstumsrate in Europa wieder etwas nach oben bringen.
Große Teile des Geldes für die Zukunftsprojekte einsetzen
Münchenberg: Stichwort Reformen. Wie groß sind da Ihre Hoffnungen, dass diese Reformen tatsächlich auch umgesetzt werden? Denn das ist ja der Vorwurf, der ja immer wieder auch zum Beispiel in Richtung Italien geht, dass man es da dann doch nicht so genau nimmt.
Felbermayr: Das ist durchaus eine begründete Sorge. Es geht um große Summen und wenn diese Summen nicht entsprechend eingesetzt werden, wachstumsfördernd, strukturreformierend eingesetzt werden, dann ist dieses Geld verloren aus europäischer Perspektive. Ich glaube, die Sorge muss man haben. Deswegen ist auch wichtig, dass man bei dem Thema Konditionalität noch einmal grundsätzlich nachdenkt, wie schafft man es, dass damit die Reformanreize auch wirklich groß genug sind, ohne die Länder zu gängeln. Das ist ein schwieriger politischer Balanceakt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man große Teile des Geldes wirklich einsetzt für die Zukunftsprojekte, Klimapolitik und Digitalisierung. Da ist ja der Ratspräsident schon ein Stück weit in diese Richtung gegangen.
Viel schwieriger wird es mit der Frage, die für manche osteuropäische Länder relevant ist: Wie verknüpft man diese Instrumente mit Rechtsstaatlichkeit. Da ist noch vieles unklar. Und was auch noch ganz unklar ist, ist wirklich die Frage, in welcher Art und Weise die Länder dann beitragen können zur Finanzierung. Da gibt es ja Vorschläge, aber auch da wird es Unterschiede geben, wie die einzelnen Mitgliedsstaaten dann am Ende finanziell beitragen zur Rückzahlung dieser Summen.
Wiederaufschwung wird etwas länger dauern
Münchenberg: Herr Felbermayr, lassen Sie uns noch kurz den Blick etwas weiten. Weltweit gibt es ja immer neue Corona-Ausbrüche, gibt es neue Lockdowns, gerade in den USA ist die Lage weiter dramatisch. Haben wir uns alle auch aus Sicht der Volkswirte zu früh gefreut?
Felbermayr: So sieht es aus. Dass in den USA, immerhin der wichtigste Exportmarkt für Deutschland, die zweite Welle so massiv rollt, das haben wir vor sechs Wochen so nicht erwartet. Das ist schon eine Enttäuschung und gerade Deutschland, das so exportorientiert ist, erfährt international hier noch mal deutlich Gegenwind. Es ist auch so, dass in den Schwellenländern, vor allem Brasilien oder auch Indien und Südafrika, die Krise noch überhaupt nicht eingedämmt ist.
Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es mit dem Wiederaufschwung etwas länger dauert, weil auf den internationalen Märkten der Gegenwind für Deutschland vor allem, aber für die anderen Exporteure auch doch deutlich stärker ist. Ein bisschen Lichtblick gibt es aus China. Da sind ja gestern Handelszahlen veröffentlicht worden. Die haben positiv überrascht. Aber am Ende überwiegt jetzt doch die Skepsis, dass die Weltwirtschaft stärker leidet, vor allem, weil große Schwellenländer und die USA stärker in der Krise sind, als wir es noch vor ein paar Wochen gedacht haben.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.