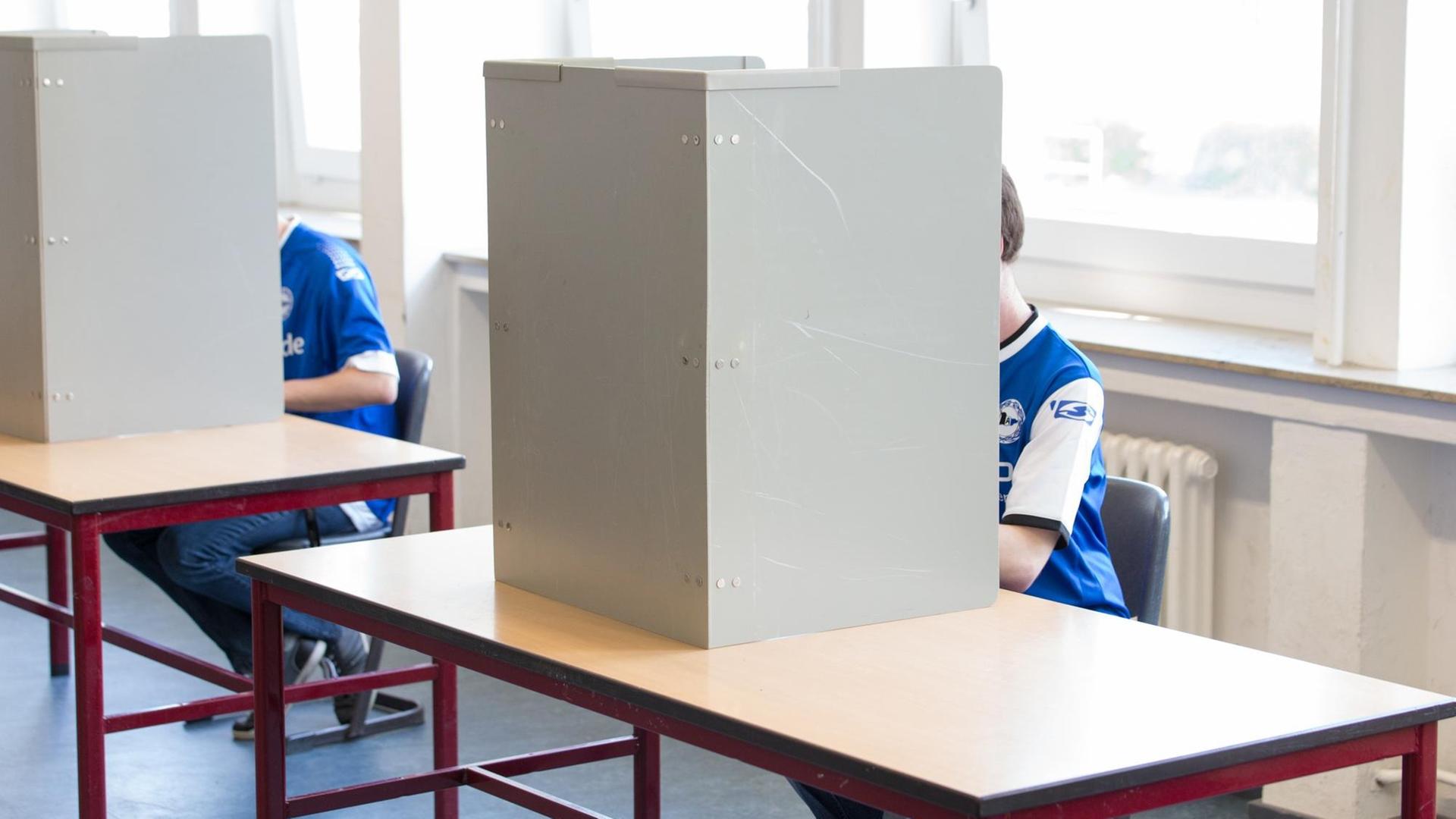
Tageschausprecherin: "Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Bundestagswahl ist die ... offenbar der klare Sieger."
Wieder einmal werden in wenigen Tagen Politiker und Wähler gespannt darauf warten, wie dieser Satz in den Abendnachrichten ausfallen wird. Die Politiker werden sich anschließend bei den Wahlkämpfern ihrer Parteien bedanken und ihren Einsatz loben. Und sie werden betonen, wie gut man es geschafft habe, Wechselwähler zur eigenen Partei herüber zu ziehen oder eben nicht. Dahinter steckt ein Idealbild des Wählers: Er registriert aufmerksam die Programme und Wahlslogans der Parteien und trifft dann eine autonome und bewusste Entscheidung. Trifft das die Realität?
"Ich hatte keine konkrete Vorstellung, was man wählen kann, und in meinem Umfeld gab es Leute, die eine ganz klare Vorstellung hatten und die sich auf eine bestimmte Person auch fixiert hatten und es hat mich überzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich genauso."
Umgebung beeinflusst mehr als Überzeugungen
Gerd W. ging vor mehr als 30 Jahren zum ersten Mal wählen, war dabei aber mehr von seiner Umgebung beeinflusst als von seinen eigenen Überzeugungen. Ein Phänomen, auf das Wahlforscher immer wieder stoßen. Demnach spielt das soziale Umfeld bei den ersten Wahlentscheidungen einen entscheidende Rolle. Und diese frühen Wahlentscheidungen prägen das Wahlverhalten dann häufig jahrzehntelang: Die Mehrheit der Wähler in Deutschland und den westlichen Demokratien wählt konstant parteigebunden.
"Das sind in Deutschland momentan etwa zwei Drittel. Also die Zahl ist weitaus höher als diese allfällige Medienfolklore vom ungebunden Wähler erwarten lässt."
Professor Rüdiger Schmitt-Beck, Politikwissenschaftler an der Universität Mannheim. Er ist einer der Projektleiter der deutschen nationalen Wahlstudie. In ihr werden über mehrere Jahre hinweg repräsentativ ausgewählte Bürger ausgiebig über ihre Wahlentscheidungen und Motive befragt.
"Gehen sie 30,40 Jahre zurück, da waren es noch erheblich mehr, da waren es über 80 Prozent. Also der Rückgang findet statt, ob es ein kontinuierlicher Prozess ist, der sich in alle Ewigkeit fortschreiben wird, das lässt sich schwer sagen, weil es auch nicht kontinuierlich und linear läuft, sondern eher in Phasen. Das momentane Niveau parteigebundener Wähler wurde schon vor einigen Jahren, also um die Jahrtausendwende bereits erreicht und seitdem haben wir eigentlich einen Stillstand."
Wählerbindung bleibt stabil
Obwohl sich traditionelle Milieus wie die Arbeiterschaft oder das christlich-konservative Milieu zurückbilden, bleibt die Parteibindung der Wähler seit dem Jahr 2000 relativ konstant. Auch die Wiedervereinigung hat daran nichts Entscheidendes verändert. Zwar sagen bis heute mehr Ost- als Westdeutsche, dass sie nur eine schwache oder mittlere Parteibindung hätten. Professor Kai Arzheimer von der Universität Mainz warnt aber davor, das zu überschätzen.
"Das war eine Überlegung, die man damals hatte nach der Wiedervereinigung, dass die ostdeutschen Wähler als politisch unbeschriebene Blätter in den Bundestagswahlkampf gegangen sind, ich glaube das hat so nie gestimmt. Also es gab dann auch Mitte der Neunzigerjahre ungefähr neuere Forschungsergebnisse, die zeigten, dass sich die DDR-Bürger, die oft auch westdeutsches Fernsehen hatten, die auch oft familiäre Verbindungen in den Westen hatten, eigentlich sehr gut informiert haben über die westdeutsche Politik und dass es bei manchen sogar so etwas wie eine virtuelle Parteiidentifikation gab, also Parteien, denen sie sich eigentlich nahe fühlten, nur konnten sie niemals für diese Parteien stimmen."
Was bindet Menschen langfristig so stark an eine bestimmte Partei? Einen ersten Hinweis geben Experimente, die Kai Arzheimer seit vielen Jahren in Mainz mit Versuchspersonen durchführt, deren Parteiidentifikation er kennt.
"Wir machen Experimente, wo wir fiktive Kandidaten vorstellen mit identischen Eigenschaften - zweiundvierzig Jahre alt, Diplom-Volkswirt, Abitur an einem bayrischen Gymnasium - das einzige, was sich ändert, ist die angebliche Parteimitgliedschaft und in der Regel werden die Kandidaten der Identifikationspartei deutlich besser bewertet. Man sieht sehr deutlich, dass Kandidaten der jeweils eigenen Partei erheblich sympathischer wahrgenommen werden, intelligenter wahrgenommen werden, kompetenter wahrgenommen werden bei ansonsten identischen Eigenschaften."
Ein warmes Gefühl
Offenbar sorgen Emotionen dafür, dass Kandidaten unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden. Rüdiger Schmitt-Beck kennt viele Aussagen von Wählern, die das bestätigen.
"Wenn ich an meine Partei denke, dann kriege ich da ganz warme Gefühle und wenn es der Partei schlecht geht, dann leide ich". Es ist also ein affektives Phänomen, das gar nicht so politisch ist."
Es ist fast so wie bei der Liebe zu einer Fußballmannschaft. Die Gefühlsareale des Gehirns, die im limbischen System sitzen, beeinflussen maßgeblich, was man wie wahrnimmt und beurteilt. Meist entsteht diese emotionale Prägung für eine bestimmte Partei ziemlich früh im Leben und zwar über den Einfluss durch die Eltern. Manchmal grenzen sich die Kinder von den Eltern ab, aber mehrheitlich folgen sie ihnen erstaunlicherweise. Papa und Mama sprechen positiv über eine Partei, gehen mit ihren Kindern womöglich auf Parteiveranstaltungen und gewöhnen die Kinder so daran, positive Dinge mit dieser zu verbinden: "Das ist unsere Partei, die ist gut für uns und unsere soziale Gruppe."
Natürlich gibt es auch die 30 Prozent der Wähler, die immer wieder mal die Partei wechseln oder sich von ihrer bisherigen Partei abgrenzen. Aber auch Sie wählen nach Kai Arzheimer nicht völlig beliebig.
"Was wir wissen über Wechselwähler, ist, dass ganz oft tatsächlich der Wechsel innerhalb eines Lagers erfolgt, also dass sie Links, Rechts, Mitte sind um es grob vereinfacht darzustellen und dass für sie immer nur zwei oder drei Parteien infrage kommen und dass sie dann zwischen denen wechseln je nach Kandidaten, Themen oder auch ganz wichtig Koalitionsoptionen."
Wechselwähler in der Minderheit
Viele Wechselwähler sind also zum Beispiel CDU-Anhänger, die ab und zu für die FDP stimmen, um sie über die 5 Prozent-Hürde zu hieven. Oder SPD-Wähler machen das gleiche mit der Stimme für die Grünen. Nach Professor Harald Schön von der Universität Mannheim bleiben die Wechselwähler aber auch deshalb in der Minderheit, weil sich die emotionale Parteibindung tief in die Identität der Wähler hineinfrisst.
"Weil man von sich selbst ein positives Selbstbild haben möchte, man fühlt sich der Gruppe zugehörig, also in diesem Fall einer Partei. Und wenn man sich der zugehörig fühlt, dann wird man eher es schwer haben, zu sagen - auch wenn es irgendwelche Skandale oder so was in dieser Partei gibt - mit der möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt nicht, dass man komplett gegenüber der Realität oder den Berichten über die Realität immunisiert wäre, aber es dauert schon, es braucht schon einiges an Informationen, die nicht zum Selbstbild passen, um das herauszufordern."
Der informierte Wahlbürger? Eine Fata Morgana
Der Wechsel zu anderen Parteien wird zusätzlich noch dadurch erschwert, weil viele Bürger sich gar nicht so tiefschürfend mit dem politischen Geschehen beschäftigen. Wie der Wähler Gerd W.
"Das hieße dann, selber sich damit zu beschäftigen: Ist das glaubhaft, was die machen, kann man daraus etwas erwarten oder ist es nur Programm? So weit geht also mein Auseinandersetzen nicht. Ich setze mich sparsam damit auseinander, vielleicht auch aus dem Gefühl, dass ich gar nicht so tief reinkommen kann, um wirklich eine fundierte Aussage, eine abschließende Aussage treffen zu können."
Der rationale und bestens informierte Wahlbürger ist ein Idealbild, das selten erreicht wird, bestätigt Rüdiger Schmitt-Beck.
"Die allermeisten Leute sagen, dass wir in der Politik genau so entscheiden wie in unserem Alltag bei allen möglichen anderen Dingen, die zu entscheiden sind: was wir am Abend machen, welchen Film wir uns angucken, wenn wir ins Kino gehen, was für ein Auto wir kaufen wenn wir ein neues Auto kaufen, bei welchem Bäcker wir unser Brot kaufen usw. Und das bedeutet, wir denken das nicht alles bis ins Letzte durch, wir versuchen die Entscheidung nicht zu optimieren und absolut keinen Fehler zu machen, sondern wir treffen Entscheidungen, die sind gut genug, einigermaßen okay, sodass wir nicht völlig daneben langen, aber möglicherweise auch nicht absolut optimal."
Der kritische Blick auf Sachfragen existiert häufig nur dann, wenn Wähler direkt betroffen sind - ansonsten geht man erst einmal davon aus, dass das, was die eigene Partei sagt, schon richtig ist.
Aber entsteht nicht gerade in einigen Ländern ein Trend, der dieser traditionellen Parteienbindung zuwider läuft? Sind nicht Donald Trump und Emmanuel Macron das beste Beispiel dafür, dass die Wähler sich von den herkömmlichen Parteien abwenden?
Veränderung des Wahlverhaltens besser für Demokratie
Kai Arzheimer von der Universität Mainz relativiert das. Trump sei immerhin Kandidat der Republikanischen Partei gewesen und viele Parteiangehörige hätten ihn zähneknirschend gewählt, um Hilary Clinton zu verhindern.
"Macron ist ein interessanter Fall, weil hier tatsächlich jemand angetreten ist, der sagt er möchte eigentlich Parteispaltungen überwinden. Wir müssen allerdings hier auch zwei Dinge beachten, nämlich erstens, dass das französische Parteiensystem seit Jahrzehnten eigentlich in einer schweren Krise ist und zweitens, dass Macron Präsident geworden ist und die Parlamentswahl gewonnen hat auf der Grundlage einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung. Dass also viele, die sich vielleicht noch mit den Traditionsparteien identifizieren, einfach zu Hause geblieben sind."
Das Wahlverhalten spiegelt immer auch den Zustand einer Gesellschaft und des demokratischen Systems. Wie gut repräsentieren Parteien tatsächlich die Interessen ihrer Wähler? Wann haben sie sich überlebt? Die Tatsache, dass Menschen immer wieder die gleichen Parteien wählen, ist daher nicht unbedingt gleichbedeutend damit, dass sie unpolitisch sind. Trotzdem gehört es zu den Stärken demokratischer Systeme, auch Veränderung und Dynamik zuzulassen. Wahlforscher wie Harald Schön empfehlen daher: geben sie ihre Stimme immer so undogmatisch und selbstständig wie möglich ab.



