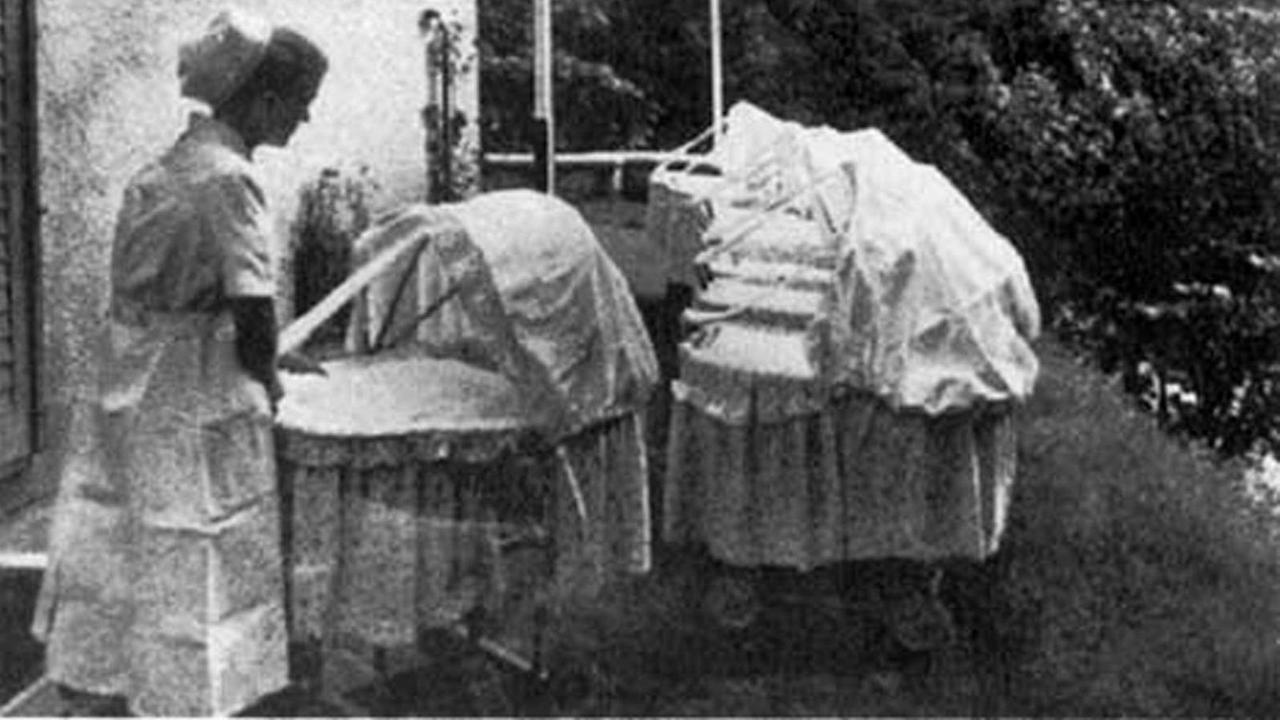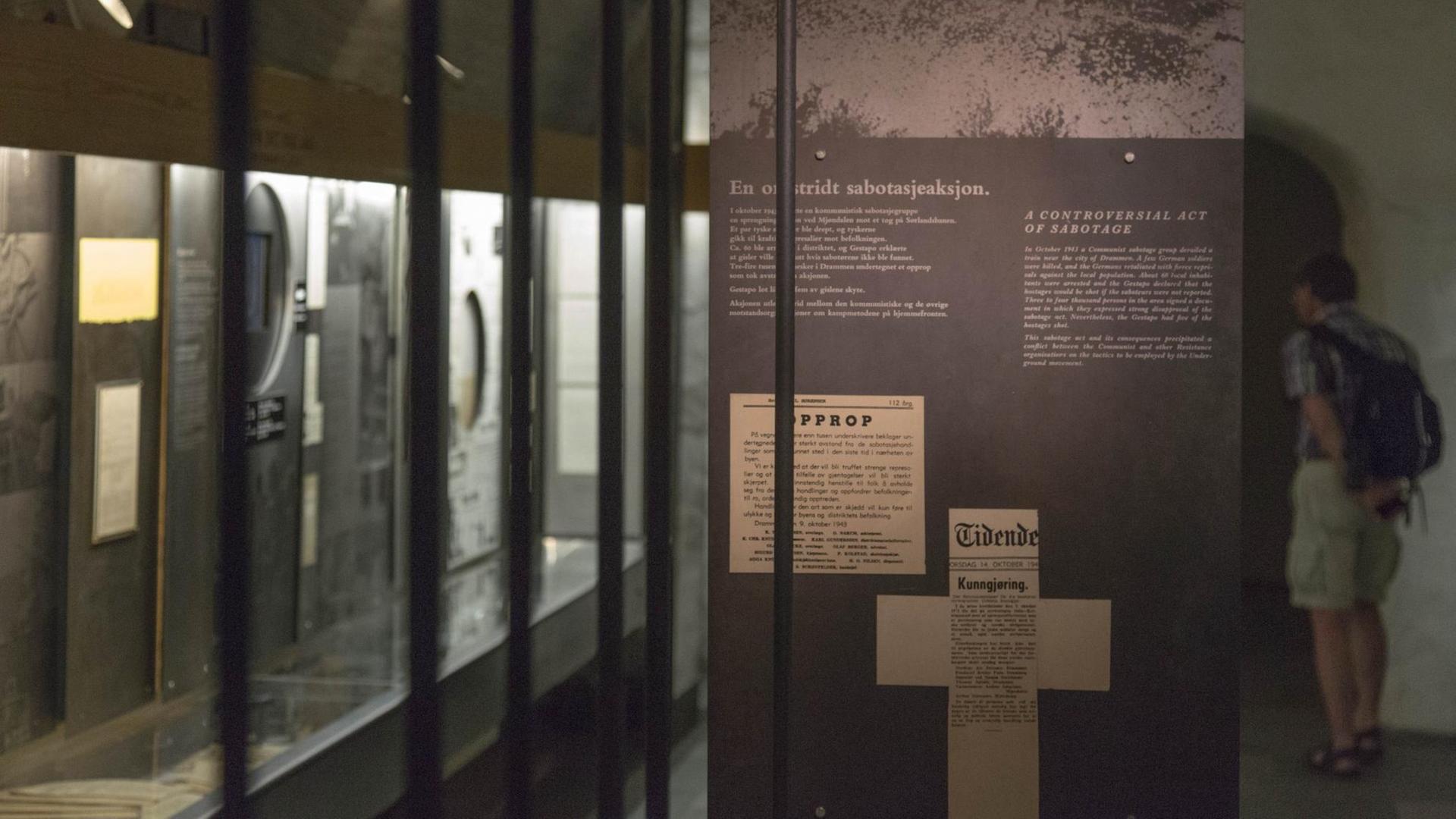
Widerstand gegen das NS-Regime gab es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den besetzten und mit Deutschland verbündeten Ländern. Um den musikalischen Widerstand in Norwegen geht es in einem neuen Buch den Musikwissenschaftlers Michael Custodis – "Music and Resistance".
Große Bandbreite des musikalischen Widerstandes
Custodis sagte im Dlf, dass es eine große Bandbreite des musikalischen Widerstandes gegeben habe – von der großen Komposition, die den Widerstand thematisiere, über das gepfiffene Lied auf der Straße oder Konzerten, die vermeintlich neutral waren, Widerstandskämpfern jedoch als Versammlungsort dienten. "Erstmal geht es darum, politische Opposition zu transportieren und da insbesondere die emotionale Kraft der Musik für zu nutzen."
In der Zeit des Nationalsozialismus sei durch die Rassenideologie das Nordische zu einem Ideal erklärt worden. Norwegen habe dadurch im Zentrum der Ideologie gestanden, so Custodis. Das stieß in Teilen der Bevölkerung auf Widerstand.
Bei seinen Recherchen in einem Archiv in Oslo sei er beispielsweise auf eine Liste von Künstlerinnen und Künstlern gestoßen, "die vertrauensvoll dem Widerstand zuzurechnen sind." Die Liste sei auf Februar/März 1945 zu datieren und beinhalte rund 250 Namen. Diese Namen überhaupt zu haben, sei schon etwas Besonderes gewesen, so der Musikwissenschaftler. Denn Widerstand habe sonst eher im Verborgenen agiert.
"Man nutzt die gemeinschaftsbildende Kraft der Musik"
Der zivile Widerstand in Kunst und Kultur habe im Gegensatz zum militärischen Widerstand mehr dazu gedient, die Moral aufrechtzuerhalten. "Man nutzt die gemeinschaftsbildende Kraft der Musik, um eine bestimmte Zeit zu überstehen." Dafür habe man in Norwegen sehr viele Beispiele gefunden – auch im ländlichen Raum. "Plötzlich ist die Musik ein Schlüssel, um ein Alltagsleben in einer Diktatur wesentlich anschaulicher zeichnen zu können als man das bisher konnte."
Perspektive der Opfer hat berührt
Am meisten berührt habe ihn bei seiner Arbeit die Perspektive der Opfer, sagt Custodis. "Wenn man merkt, dass insbesondere jüdische Künstlerinnen und Künstler Norwegen erst als Fluchtland entdecken oder auch vorher schon da waren. (…) und dann plötzlich da von der deutschen NS-Okkupation überrascht werden."