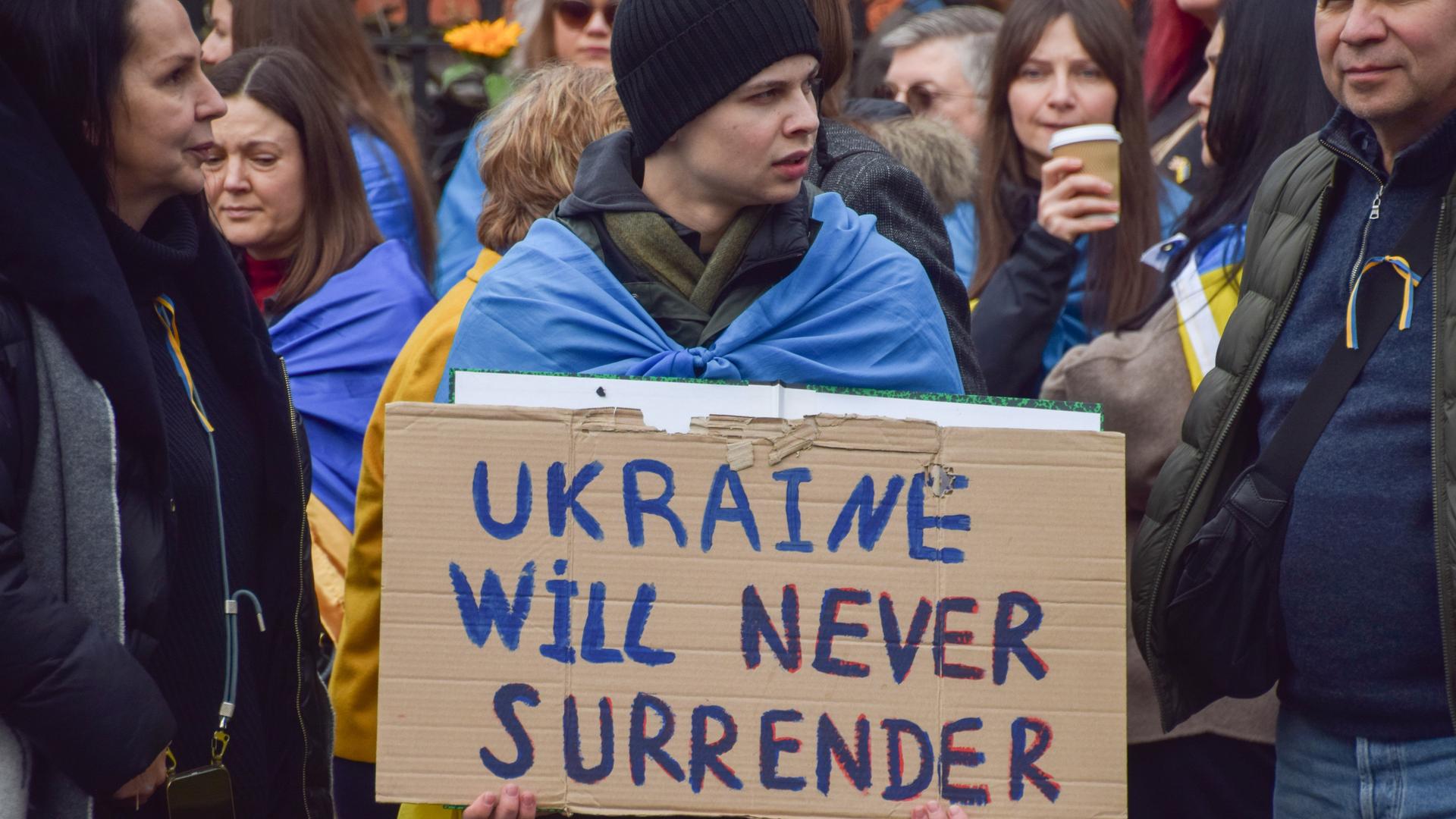Es ist ein ganz konkreter Fall, der zu der Gesetzesänderung vor zwei Jahren geführt hat. Die 17-jährige Frederike von Möhlmann wird 1981 vergewaltigt und ermordet. Ein Verdächtiger wird freigesprochen. Die spätere Auswertung von DNA-Proben, die so in den frühen 1980er-Jahren noch nicht möglich war, weist wieder auf denselben Verdächtigen. Der Prozess kann ihm nicht mehr gemacht werden, schließlich gilt der Grundsatz, dass niemand wegen derselben Sache mehrmals verfolgt werden darf.
Ein Prinzip des Rechtsstaats
Das nur unbefriedigend zu nennen, wäre untertrieben. Und trotzdem war die Gesetzesänderung ein Fehler, mit der die Große Koalition in den letzten Tagen ihres Bestehens versuchte, in solchen Fällen ein neues Verfahren zu ermöglichen. Trotzdem war schon die damalige breite Kritik berechtigt. Trotzdem ist es gut, dass das Bundesverfassungsgericht diese Gesetzesänderung jetzt gekippt hat.
Denn – getrieben durch den schlimmen Fall – hatte die Gesetzesänderung einen ganz zentralen Rechtsgrundsatz infrage gestellt. Das Verbot der Mehrfachverfolgung, das auf Griechen und Römer zurückgeht und in den meisten Rechtsstaaten zum Grundgerüst gehört, schützt mit Rechtssicherheit und Rechtsfrieden abstrakte Prinzipien.
Schutz vor Ungerechtigkeit
Die im konkreten Fall einer gefühlten Ungerechtigkeit gegenüberzustellen, scheint allzu kühl. Aber diese Prinzipien sind nicht nur abstrakt, sie haben Gründe. Sie schützen nicht nur davongekommene Mörder. Sie schützen auch den zurecht Freigesprochenen, der nicht sein Leben lang unter dem Fallbeil der möglichen Wiederaufnahme stehen soll. Sie schützen den gesellschaftlichen Frieden. Sie schützen – auch darauf weisen die Verfassungsrichter hin – Hinterbliebene, die nicht in der steten Ungewissheit leben müssen. Und nein, das ist nicht zynisch. Das ist eine Realität des Rechtsstaats.
Heute weisen zwei der acht Verfassungsrichter darauf hin, dass schon jetzt dieser Grundsatz, das Verbot der Mehrfachverfolgung, ausgefranste Ränder hat. Wenn etwa das Geständnis des Freigesprochenen die Wiederaufnahme ermöglicht. Aber das ist kein Grund, das Prinzip nicht zu verteidigen. Im Gegenteil. Es zeigt, dass Grenzen schwer zu ziehen sind, wenn man anfängt mit Ausnahmen.
Es braucht Regeln
Vor allem aber hat die Mehrheit der Richter recht, die – überspitzt formuliert – sagt: Wer anfängt, auf das unbefriedigende Ergebnis des Strafverfahrens abzustellen, der kann sich die Regeln für das Verfahren sparen.
So weh das tun mag. Wahrheit und Gerechtigkeit sind hehre Ziele. Im Strafverfahren sind sie nicht immer zu erreichen. Das wissen auch die Verfassungsrichter – und zwar alle acht.
Deshalb sind sie sich auch völlig einig darin, dass die Gesetzesänderung im konkreten Fall ohnehin keine Wirkung entfalten konnte. Weil sie gegen das Verbot rückwirkender Strafgesetze verstößt. So schwer das sein mag, es ist völlig klar: Grundsätze fallen nicht, weil das Ergebnis im konkreten Fall schwer zu ertragen ist.