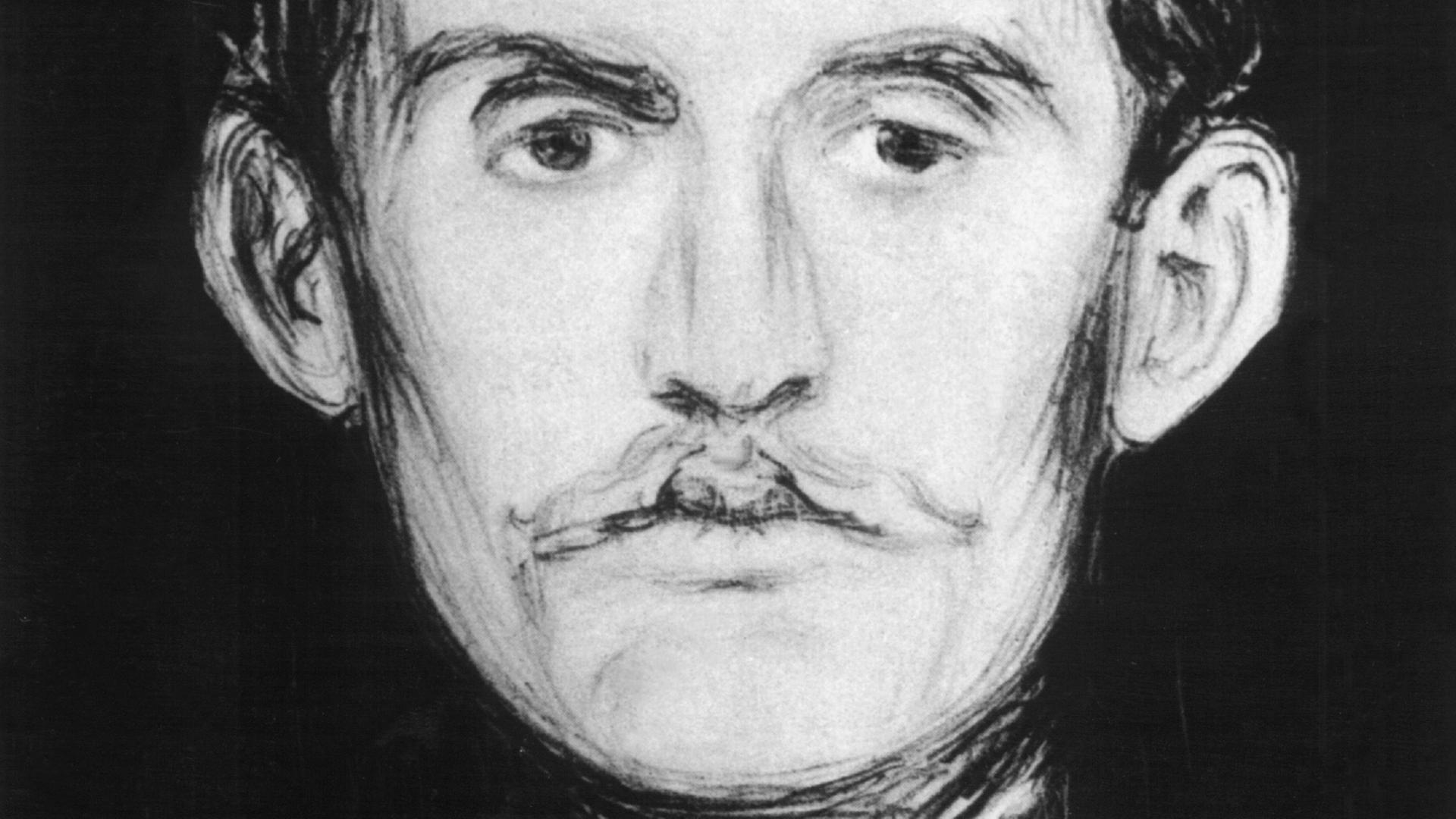Auf einem großen schwarzen Sockel aus stabiler Pappe stehen verloren einige Skulpturen herum. Da begegnen sich Picassos kleine "Eule", eine Keramik aus dem Jahr 1952, und der ebenso kleine "Vogel" des Bildhauers Hans Uhlmann: eine Stahlskulptur aus derselben Zeit, die auf wenige Linien und Flächen im Raum reduziert ist. Keramische "Eule" und stählerner "Vogel", in Gestalt der beiden Objekte scheinen Figuration und Abstraktion miteinander zu plaudern. Daneben eine bronzene "Daphne" von Renée Sintenis aus dem Jahr 1930 neben einem modernen Designerstuhl von Isa Genzken und einem "Waschbecken" von Claes Oldenburg – einem jener schlaffen Objekte aus Vinyl, mit denen der Pop-Künstler in den 1960er-Jahren berühmt geworden war.
Die Nymphe könnte sich soeben vom Stuhl erhoben haben oder aus dem Bad gekommen sein. Dann steht da, eine Ecke weiter, einsam vor einer schwarzen Wand, tatsächlich eine Bronze namens "Frau auf dem Weg zum Bad" von Aristide Maillol. Und in die lockeren erzählerischen Verbindungen zwischen den Figuren mischen sich kunsthistorische Erinnerungen – etwa an den Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe, der ähnlich mit einem bronzenen Frauenakt bestückt war.
Humorvolle Anordnung der Skulpturen
Solche Assoziationen sind möglich, wenn auch nicht zwingend. Klar ist allerdings dies: Kaum ein Museumsdirektor würde seine Sammlung so luftig und spielerisch präsentieren wie Heimo Zobernig im Kölner Museum Ludwig. Dort durfte der Wiener Maler und Bildhauer ins Depot greifen und sich bei der Auswahl alle Freiheiten nehmen. Seine Wahl fiel auf gerade mal neun Skulpturen, die Zobernig auf den dunklen Podesten und im Raum versammelt. Ein gewisser Humor prägt diese Zusammenkunft. Dazu Zobernig selbst:
"Die Ironie war sicherlich als junger Künstler vielleicht mehr präsent, sozusagen als eine philosophische Denkungsart, die einfach zeigt, dass man irgendwie auch distanzfähig ist. Also, dass man über sein eigenes Tun auch nachdenken und zurücktreten kann – und es eben auch der Lächerlichkeit aussetzen kann. Dazu braucht es ja auch eine gewisse Überwindung, wie ernst man sich selber nimmt. Das ist jetzt in diesem Fall nicht das Thema."
Vielleicht nicht das Thema, aber eine besondere Vorgeschichte haben auch die Einbau-Elemente. Sie gehen auf Zobernigs Beitrag im österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig 2015 zurück, wo sie konkret auf den vorgefundenen Ort bezogen waren. Im Innenraum verkleideten sie die markanten Rundbögen des Pavillons und machten aus dem historistischen Ausstellungshaus kurzerhand eine streng rechtwinklige, modernistische Architektur. Dann wanderten diese Formen ins Kunsthaus Bregenz und hingen dort als autonome Skulptur unter der Decke. Schließlich wurde Zobernig ins Museum Ludwig eingeladen, und nun verwendet er die Elemente aus Karton als Display für die Skulpturen der Sammlung.
"Die Ortsbezogenheit, das war etwas von Anfang an, das mich interessiert hat, was ich aber eben auch von Anfang an in Frage gestellt habe, weil da ja etwas ganz Seltsames mit den Dingen passiert, dass sie Geschichte mitnehmen – seien sie durchaus lesbar durch die Spuren oder die Verletzungen, die sie erfahren, aber es gibt ja auch sozusagen etwas Unsichtbares, das den Dingen und den Kunstwerken haften bleibt."
Eine kleine, pointenreiche Sammlungspräsentation
Ein paar Schrammen haben sie unterwegs ins Rheinland abbekommen, aber die soll man ja auch ruhig sehen. Von der ortsspezifischen Intervention in Venedig zur autonomen Skulptur in Bregenz zum Ausstellungsdesign in Köln: Zobernig rührt damit an grundlegende Fragen der Moderne, an der er sich seit Jahrzehnten abarbeitet und die er auf seine Weise in die Gegenwart hinüberrettet. Ganz taufrisch ist dieser Rettungsversuch nicht mehr. Erstaunlich aber, wie ergiebig Zobernig das 20. Jahrhundert noch immer ausschlachtet. Was von der Kölner Ausstellung vor allem bleibt, ist eine kleine, pointenreiche Sammlungspräsentation.