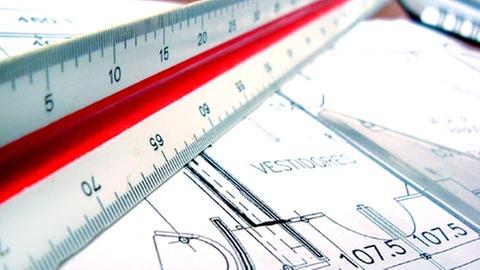Morgen (9.12.2010) wollen die Spitzen von Union und FDP im Koalitionsausschuss erneut über ein Gesamtkonzept zur Zuwanderung ausländischer Fachkräfte beraten. Schon jetzt werden händeringend gut ausgebildete Fachleute gesucht. Weil sie fehlen, hapert es in vielen Betrieben an Innovationen; es mangelt an wettbewerbsfähigen Produkten; es leidet die Qualität. Letztes Jahr hätten 15 Milliarden Euro mehr erarbeitet werden können, schätzt das Institut der Deutschen Wirtschaft. Und absehbar wird es kaum besser werden. Bis 2015, so heißt es in einem Koalitionspapier, werden in Deutschland eine Million Fachkräfte mit Hochschulabschluss fehlen, sogar 1,3 Millionen Fachkräfte mit beruflichem Abschluss. Eine mögliche Lösung könnten hoch qualifizierte Zuwanderer sein.
Doch genau darüber sind sich die Politiker in Berlin nicht einig. Die FDP will mehr spezialisierte Fachkräfte im Land haben. Dazu will sie die Hürden absenken. Bisher dürfen Spezialisten einwandern, wenn sie nachweisen können, gut - mindestens 66.000 Euro pro Jahr - zu verdienen. Die FDP will den Zuzug ab 40.000 Euro möglich machen. CDU und CSU halten dagegen an der bisherigen Marke fest. Die Liberalen wollen Kriterien für Zuwanderung außerdem nach einem Punktekatalog bewerten. Die Union lehnt diesen als bürokratisches Monstrum ab. Die CSU will stattdessen zuallererst eine bessere Qualifizierung von Arbeitslosen. Außerdem heißt es in einer Studie des Bundesfamilienministeriums: Arbeitgeber würden zu wenig in das Potenzial ihrer Mitarbeiter über 50 investieren.
Mehrfach hat die Koalition dieses Thema aufgeschoben. Morgen nun will die Regierung ein Gesamtkonzept verabschieden. Denn: Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Allerdings auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel in Thüringen. Hier wartet man ab, getreu dem Motto: Das kriegen wir schon hin - auch ohne Zuwanderer. Hier werden andere Fragen diskutiert. Fragen beispielsweise, wie junge Arbeitnehmer gewonnen und qualifiziert werden können, wie man ältere Mitarbeiter dem Unternehmen lange erhält und gering Qualifizierte ins Arbeitsleben holt.
"Ich glaube, dass es Bereiche gibt, in denen wir ohne Zuwanderung nicht werden auskommen können."
"Es wird gerade im Bereich der hoch qualifizierten Arbeitskräfte zu Bedingungen kommen, dass man auch auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sein könnte."
"Ja, also aktuell spielen sie keine Rolle. Wir werden auch keine einwerben. Glaub ich jedenfalls nicht, dass wir das tun."
"Der andere Punkt ist: wie kann man die eigenen Potenziale nutzen? Und da würde ich dann eigentlich ehrlich gesagt dann auch den Schwerpunkt setzen wollen."
Wenn ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Regierungsbeamter und ein Vertreter der Arbeitsagentur in Thüringen über Zuwanderung reden, klingt es bemerkenswert verhalten. Nun ja, dieses Thema werde nun einmal gesellschaftlich breit diskutiert, entschuldigen sie sich. Und wo der Fachkräftebedarf doch gerade in den neuen Bundesländern weit größere Löcher reißen kann als in den alten, wolle man sich dieser Thematik auch nicht verschließen. Aber Priorität habe es nicht, heißt es immer wieder.
Differenzierter sehen das Vertreter der Sozialbranche. Sie müssen nämlich früher noch als andere Wirtschaftsbereiche über Fachpersonal aus dem Ausland nachdenken. Aber auch sie wissen, dass eine aktive Zuwanderungspolitik - um es einmal vorsichtig auszudrücken - keinen gesellschaftlichen Rückhalt hätte. Christine Fiedler von der Thüringer Parität:
"Ich denke, wir sollten uns schon auch trauen, das Thema Zuwanderung als ein moderner werdendes Land Thüringen in den Blick zu nehmen."
Viele soziale Einrichtungen tun sich - trotz Leidensdruck - noch schwer, über Zuwanderung nachzudenken. Aber die Front bröckelt mit jeder Fachkraft, die geht.
Ein Mittwochmorgen im Pflegeheim Sophienhaus in Weimar. Drei ältere Damen sitzen apathisch mit gesenktem Kopf an Tischen. Die Pflegerin räumt nebenan in der Gemeinschaftsküche das Kaffeegeschirr in die Spülmaschine. Es ist die Wohngruppe für Demenzkranke. Der Bedarf an Pflegeeinrichtungen wächst. Die demografische Entwicklung in Deutschland beschert der Sozialbranche eine sichere Zukunft mit stabilem Wachstum. Die Pflegefachkräfte dagegen machen sich rar.
"Es klemmt immer öfter. Also: Du kannst nicht aus einer Reihe von Bewerbungen bewusst ein Mitarbeiterpotenzial entwickeln, sondern ganz oft entscheidet der Zufall der Verfügbarkeit von Mitarbeitern über die Stellenbesetzung."
Martin Gebhardt ist der Leiter des Bereichs Altenhilfe des Diakonieverbundes Weimar-Bad Lobenstein, der Chef von 750 Beschäftigten, die in den ambulanten und stationären Einrichtungen seiner Firma in Mittel- und Ostthüringen arbeiten. Er sagt, der Fachkräftemangel, der in anderen Wirtschaftszweigen erst in fünf Jahren erwartet werde, sei in seinem Sektor längst Alltag. Bei ihm sind überwiegend Frauen beschäftigt: Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Heilerziehungspflegerinnen, Sozialpädagoginnen, Geronto-Pädagoginnen. Während er sich vor zehn Jahren unter den Bewerberinnen noch die Besten auswählen konnte, ist er heute froh über jede halbwegs qualifizierte Bewerbung.
"Und es gibt auch Regionen, in denen wir eigentlich überhaupt keine Fachkräfte bekommen. Da gibt es niemanden auf dem Markt. Und dann müssen wir immer warten, bis wieder eine Bewerbung eingeht. Und das heißt dann konsequent, dass man nur fragt: Kann man sich den vorstellen oder geht es gar nicht."
Die langfristige Perspektive kann den Diakonie-Mann nicht optimistisch stimmen. Die Zahl der Renteneintritte wird sich absehbar verdoppeln, die Zahl der Berufsanfänger halbieren.
Der Grund: Mit der Wende kamen in den dann neuen Ländern aufgrund der massiven Verunsicherung deutlich weniger Kinder zur Welt. Erst wurden Kindergärten geschlossen, dann Schulen, dann fehlten Lehrlinge und Studierende, und nun kommen die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt.
Zweites Manko: Die neuen Länder leiden unter einer ungebremsten Abwanderung. Junge, gut ausgebildete Absolventen ziehen aus Thüringen weg, zum Beispiel nach Bayern und Baden-Württemberg. Vor allem junge Frauen wandern ab. Und mit ihnen das Arbeitskräftepotenzial für pflegerische Berufe. Die Sozialwirtschaft, hier das Beispiel Thüringen, ist also das Paradebeispiel für Fachkräftemangel.
In einer Stuhlreihe sitzen drei ältere Damen und warten auf die Ergotherapie. Der Pfleger kommt, fährt mit ihnen im Fahrstuhl in die untere Etage zum Bastelraum, macht dort mit ihnen kleinere Arbeiten und geleitet sie freundlich zurück. Das ist das Ereignis des Vormittages.
"Ich hol Sie dann ab. Nicht wegrennen, ja?"
Altenpflege ist eine Branche mit Zukunft. Wer hier einsteigt, kann sich seinen Arbeitgeber aussuchen.
"Wir haben natürlich darauf reagiert. Wir haben seit Jahren ganz intensiv unseren Fuß drin bei der Ausbildung. Und das wirkt sich natürlich dahin gehend positiv aus, dass junge Leute sagen: Aha, hier haben wir eine Chance. Die machen dann auch ein Praktikum eventuell oder ein Vorjahr, oder arbeiten ein halbes Jahr als Pflegekraft, um dann eine Ausbildungsstelle zu bekommen, um damit in der Region gehalten zu werden."
Die Ausbildung verbessern, Azubis an die Ausbildungsbetriebe binden, dies ist auch eine Strategie der freien Wirtschaft. Die Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel arbeitet intensiv mit Schulen zusammen, um frühzeitig für sich zu werben. Viele Jugendliche wissen vor der Berufswahl oft nicht, worauf sie sich einlassen. Mehr als jeder fünfte bricht die Ausbildung ab. Die Diakonie Weimar hat sich deswegen entschieden, zu investieren. Sie will Auszubildende bei der Stange halten.
"Wir haben dazu jetzt extra eine Koordinatorin eingesetzt im Unternehmen, die die Praxisanleiter und die Einrichtungen unterstützt bei dieser Tätigkeit, eine gute Ausbildung zu gewährleisten. Am Wichtigsten ist ja die Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen."
Wer dabei ist, kann aber trotzdem über den Tellerrand blicken und sehen, was woanders gezahlt wird. 50 Prozent mehr, 70, sogar 100 Prozent mehr in den alten Bundesländern. Dem Thüringer Bereichsleiter fehlen dann die Argumente: Weiche Standortfaktoren seien ja da. Kindergartenplätze, Freizeitwert etc. Bei der Bezahlung aber muss Martin Gebhardt passen. Sein Unternehmen zahlt nicht einmal den öffentlichen Tarif. Er sagt, der Preiskampf werde durch die Pflegekassen vorgegeben. Sie würden als Messlatte immer den günstigsten Anbieter wählen.
"Wenn wir mit den Pflegekassen verhandeln, werden wir gegebenenfalls auch mit solchen Preisen verglichen, und die sagen: 'Guck doch mal an, die brauchen auch nicht mehr Geld.' Das war bisher das Spiel der letzten Jahre, das muss aufhören."
Der Geschäftsführer der Diakonie hält für seine Branche einen Mindestlohn von zehn bis zwölf Euro pro Stunde für ein adäquates Zeichen, das die Politik eigentlich setzen sollte.
Die Betreuung von Demenzkranken ist aufwendig. Auf 70 Bewohnerinnen und Bewohner kommen 60 Beschäftigte. Der Chef würde gerne über neue Berufsbilder diskutieren. Und über den Pflegebegriff: Lieber bloß einmal waschen pro Tag, statt zweimal, dafür einmal mit dem Bewohner spazieren gehen. Das kann auch jemand, der keine Pflegeausbildung hat. Zum Beispiel die sogenannten gering Qualifizierten.
"Die Überraschung ist bei vielen, die eine Weile in der Pflege arbeiten, manchmal auch erst in der Hauswirtschaft, dass sie merken, dass ihnen das doch Spaß macht und dass sie sich dann weiterentwickeln. Und das ist gerade für alle die, die noch am überlegen sind, ein guter Weg."
Wissenschaftler werben für das sogenannte Schornsteinprinzip, bei dem alle eine Stufe höher klettern durch Qualifizierung. Michael Behr, Arbeitsmarktexperte im Thüringer Wirtschaftsministerium:
"Wir brauchen zukünftig - gerade wenn in Größenordnungen Ingenieure, Hochqualifizierte weggehen, brauchen wir im Prinzip eine Art Upgrading-Kultur, wo die Facharbeiter zu Ingenieuren gemacht werden. Und das würde uns praktisch auch die Möglichkeit geben, die gegenwärtig blockierten Beschäftigungspotenziale bei den Un- und Angelernten zu nutzen."
"Wir haben ein irres Beispiel gefunden,"
sagt Frank Schiemann vom Institut für sozialökonomische Strukturanalysen, kurz SÖSTRA,
"wo ein allerdings größerer Familienbetrieb eine Gruppe von neun An- und Ungelernten qualifiziert hat auf Facharbeiterberufe. Innerbetrieblich, mit Unterstützung der Agentur übrigens, und die Facharbeiter gleichzeitig parallel mit der Unterstützung eines entsprechenden Bildungsträgers der Branche zu Technikern und Meistern qualifiziert hat."
Für die Altenpflege sieht Martin Gebhardt vom Diakonieverbund Weimar-Bad Lobenstein dieses Prinzip als sehr tragfähig an. Viele gering Qualifizierte sind ortsgebunden, würden also nicht so schnell abwandern. Die Agentur für Arbeit unterstütze solche Maßnahmen. Ohne diese Rückendeckung würde es auch nicht gehen. Außerdem tue vielen das Signal gut, dass der Arbeitgeber gern in sie investiert. Das motiviert.
"Unser oberstes Ziel ist zur Zeit, Strukturen zu schaffen, die es den Mitarbeitern attraktiv macht, bei uns zu arbeiten. Dass sie einfach merken: Wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist das Firmenklima. Und das ist ein Weg."
Ein anderer ist dem sehr ähnlich. Er ist die Qualifizierung dessen, was man die stille Reserve nennt. Das sind die interessierten und teils hoch motivierten Ehrenamtlichen, die ohnehin schon zum Beispiel in der Pflege von dementen Angehörigen Wissen und Fähigkeiten erworben haben, und die - zum Beispiel nach dem Tod der Mutter - durchaus willens und in der Lage wären, in der Altenpflege noch etwas Geld zu verdienen. Michael Behr vom Thüringer Wirtschaftsministerium hebt diese Gruppe als Potenzial vor allem der neuen Bundesländer hervor.
"Erstens geht es darum, vielen Thüringern, die erwerbstätig sein wollen, die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Da haben wir erhebliche brach liegende auch stille Reserven. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch da. Wir haben Potenziale auch bei den älteren Frauen, die wir so nicht in Westdeutschland haben, die weiterhin erwerbstätig sein wollen, auch lange."
Was die Diakonie in Weimar überlegt und praktiziert, ist symptomatisch für die Thüringer Wirtschaft. Eine Studie im Auftrag des Erfurter Wirtschaftsministeriums bestätigt, dass die meisten Betriebe das Fachkräfteproblem erkannt haben und dass sie vor Ort Potenziale entdecken, die einfach nur genutzt werden müssen. Die Thüringer Unternehmen sind demnach zuversichtlich, das Fachkräfteproblem lösen zu können. Frank Schiemann von SÖSTRA nennt Beispiele.
"Das sind in erster Linie natürlich die im Land selber ausgebildeten Jugendlichen, aber eben auch die Hoch- und Fachhochschulabsolventen, es sind aber auch die arbeitslos gemeldeten Erwerbspersonen, die sich bisher immer noch in dieser Situation fühlen, nicht gebraucht zu werden am Arbeitsmarkt. Und die Frage ist, wie man sie mobilisieren kann."
Die Arbeitsmarktexperten werden nicht müde zu betonen, dass Arbeitgeber Geld und Ideen darauf verwenden müssen, die vorhandenen und neu entdeckten potentiellen Fachkräfte zu schulen. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen dafür maßschneidern. Der Prozess, hier die geeigneten Instrumente zu finden, habe gerade erst begonnen.
Zurück ins Pflegeheim der Diakonie in Weimar. Der Bereichsleiter Altenpflege, Martin Gebhardt, hat bereits viel getan, um Fachkräfte zu werben und zu halten. Aber er weiß, dass dies nicht ausreichen wird. Diskutiert sein Unternehmen über Zuwanderung? Ja, aber nur ganz zaghaft.
"Ein Schritt, den wir jetzt lange vorbereitet haben, ist der Einsatz von Fachkräften aus dem osteuropäischen Raum. Wir haben uns bisher da immer sehr zurückhaltend verhalten. Haben uns aber inzwischen entschieden, das strukturiert auszuprobieren. Wir haben gerade zwei Krankenschwestern aus dem Baltikum, die jetzt im Rahmen ihrer Sprachkurse die Anerkennung für Thüringen bekommen werden."
Die Arbeitsmigration innerhalb der Europäischen Union sieht Martin Gebhardt nur kurzfristig als Lösung an. Langfristig sei sie europapolitischer Unsinn. Denn absehbar würden die Fachkräfte auch in ihren Heimatländern gebraucht, und dann könnten es sich die Einrichtungen in Polen, Tschechien und Co. nicht mehr leisten, ihre Frauen - und wie beschrieben sind es ja überwiegend Frauen - ziehen zu lassen.
Während hier also im Sozialbereich bereits Nägel mit Köpfen gemacht werden, sträubt sich die freie Wirtschaft in Thüringen noch gegen den Gedanken der Zuwanderung. Gerade einmal zehn Prozent der Firmen nennen dieses Stichwort, wenn sie gefragt werden, was sie planen, gegen den drohenden Fachkräftemangel zu tun. Aber da auch erst unter Punkt sieben. Vorher wollen sie ältere Arbeitnehmer länger im Unternehmen halten, in Weiterbildung investieren, bessere Bedingungen schaffen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Ausbildung verbessern, Teilzeitarbeit ermöglichen und rationalisieren, sagt Arbeitsmarktforscher Frank Schiemann.
"Aus unserem Dafürhalten ist es eigentlich eher so, dass diese Problematik sehr breit in der öffentlichen Diskussion ist. Wenn man sich die anderen Potenziale anschaut, die im Land, die in der Region vorhanden sind, dann denke ich mal, ist in dem Bereich der Diskussion schon fast Genüge getan. Das mag aber durchaus, sag ich mal, in verschiedenen Qualifikations- und Berufsbereichen auch bestimmten Regionen des Landes unterschiedlich sein."
Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig von der SPD hält angesichts der Zahl von prognostizierten 200.000 Fachkräften, die innerhalb der nächsten zehn Jahre dem kleinen Freistaat fehlen werden, dagegen. Er spricht das Thema auf einer Veranstaltung vor Unternehmern vorsichtig an.
"Wer in den nächsten Jahren Fachkräftebedarf hat, wird auch eines tun müssen: Er wird offen sein müssen für Zuwanderung. Ich sage das ganz deutlich. Und zwar Zuwanderung aus den alten Bundesländern. Aber wir brauchen auch die gezielte Zuwanderung von Qualifizierten aus der Europäischen Union oder aus anderen Teilen."
Das Wirtschaftsministerium weiß, dass es behutsam vorgehen muss. Aber genau genommen müsste es laut sagen: Gerade die Regionen in Thüringen, die sich am meisten sträuben, haben den höchsten Bedarf an ausländischen Fachkräften. Strukturschwache Gebiete haben nicht das Arbeitskräftepotenzial, das sie bräuchten. Aber: Es gibt in Thüringen zum Beispiel schlicht keine Tradition darin, mit Migranten zu leben. So sagt es der Arbeitsmarktexperte aus dem Wirtschaftsministerium Michael Behr.
"Wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass wir in den neuen Bundesländern regelrecht einen Prozess der ethnischen Homogenisierung haben. Nirgendwo in der OECD ist der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte so gering, wie heute in den neuen Bundesländern. Selbst zu DDR-Zeiten war der Anteil ausländischer Arbeitnehmer höher, als das jetzt der Fall ist."
Damals waren Arbeiter aus "Bruderländern" wie Moçambique und Vietnam in der Volkswirtschaft der DDR eingeplant. Doch die mussten nach der Wende wieder gehen. Heute ist der Unterschied West-Ost in den Unternehmen schlicht sichtbar.
"Sie sehen, dass manche Branchen in Westdeutschland ohne Ausländer gar nicht funktionieren würden, und wir gucken uns hier Metall verarbeitende Unternehmen oder Automobilunternehmen an und wir sehen nicht einen einzigen Ausländer, keine anderen Hautfarben - das ist ein irritierendes Bild."
Thüringen hat einen Ausländeranteil von rund zwei Prozent - man darf es gern wiederholen: zwei Prozent, nicht zwanzig. Umgekehrt proportional verhält sich dazu die gesellschaftliche Wahrnehmung. Je weniger ausländische Zuwanderer da sind, desto fremdenfeindlicher die Stimmung. Wer wollte also jetzt lauthals Forscher und Entwickler mit erkennbar anderer Hautfarbe einladen? Viktor Bernecker vom Thüringer Verband der Wirtschaft appelliert deshalb :
"Wenn es gelingt, dass wir eine glaubwürdige Willkommenskultur in Deutschland aufbauen für qualifizierte und integrationswillige Menschen mit Migrationshintergrund, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn natürlich gibt auch da Potenziale, die wir gut brauchen können."
Der Verband der Thüringer Wirtschaft verweist darauf, dass gute wirtschaftliche Argumente alleine nicht ausreichten, eine gezielte Zuwanderung auch gesellschaftlich zu tragen. Michael Behr vom Thüringer Wirtschaftsministerium wird deshalb nicht müde, die Rahmenbedingungen zu erklären. Wohl wissend, dass politische Entscheidungen eine Akzeptanz der Wähler brauchen:
"Wir dürfen nicht eines tun, nämlich in der Bevölkerung das Gefühl erwecken, dass wir lieber fitte Ausländer haben wollen, bevor wir uns um die Menschen in Thüringen kümmern, die vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung und Qualifizierung benötigen, um wieder vollwertige Arbeitskräfte zu sein."
Doch genau darüber sind sich die Politiker in Berlin nicht einig. Die FDP will mehr spezialisierte Fachkräfte im Land haben. Dazu will sie die Hürden absenken. Bisher dürfen Spezialisten einwandern, wenn sie nachweisen können, gut - mindestens 66.000 Euro pro Jahr - zu verdienen. Die FDP will den Zuzug ab 40.000 Euro möglich machen. CDU und CSU halten dagegen an der bisherigen Marke fest. Die Liberalen wollen Kriterien für Zuwanderung außerdem nach einem Punktekatalog bewerten. Die Union lehnt diesen als bürokratisches Monstrum ab. Die CSU will stattdessen zuallererst eine bessere Qualifizierung von Arbeitslosen. Außerdem heißt es in einer Studie des Bundesfamilienministeriums: Arbeitgeber würden zu wenig in das Potenzial ihrer Mitarbeiter über 50 investieren.
Mehrfach hat die Koalition dieses Thema aufgeschoben. Morgen nun will die Regierung ein Gesamtkonzept verabschieden. Denn: Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Allerdings auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel in Thüringen. Hier wartet man ab, getreu dem Motto: Das kriegen wir schon hin - auch ohne Zuwanderer. Hier werden andere Fragen diskutiert. Fragen beispielsweise, wie junge Arbeitnehmer gewonnen und qualifiziert werden können, wie man ältere Mitarbeiter dem Unternehmen lange erhält und gering Qualifizierte ins Arbeitsleben holt.
"Ich glaube, dass es Bereiche gibt, in denen wir ohne Zuwanderung nicht werden auskommen können."
"Es wird gerade im Bereich der hoch qualifizierten Arbeitskräfte zu Bedingungen kommen, dass man auch auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sein könnte."
"Ja, also aktuell spielen sie keine Rolle. Wir werden auch keine einwerben. Glaub ich jedenfalls nicht, dass wir das tun."
"Der andere Punkt ist: wie kann man die eigenen Potenziale nutzen? Und da würde ich dann eigentlich ehrlich gesagt dann auch den Schwerpunkt setzen wollen."
Wenn ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Regierungsbeamter und ein Vertreter der Arbeitsagentur in Thüringen über Zuwanderung reden, klingt es bemerkenswert verhalten. Nun ja, dieses Thema werde nun einmal gesellschaftlich breit diskutiert, entschuldigen sie sich. Und wo der Fachkräftebedarf doch gerade in den neuen Bundesländern weit größere Löcher reißen kann als in den alten, wolle man sich dieser Thematik auch nicht verschließen. Aber Priorität habe es nicht, heißt es immer wieder.
Differenzierter sehen das Vertreter der Sozialbranche. Sie müssen nämlich früher noch als andere Wirtschaftsbereiche über Fachpersonal aus dem Ausland nachdenken. Aber auch sie wissen, dass eine aktive Zuwanderungspolitik - um es einmal vorsichtig auszudrücken - keinen gesellschaftlichen Rückhalt hätte. Christine Fiedler von der Thüringer Parität:
"Ich denke, wir sollten uns schon auch trauen, das Thema Zuwanderung als ein moderner werdendes Land Thüringen in den Blick zu nehmen."
Viele soziale Einrichtungen tun sich - trotz Leidensdruck - noch schwer, über Zuwanderung nachzudenken. Aber die Front bröckelt mit jeder Fachkraft, die geht.
Ein Mittwochmorgen im Pflegeheim Sophienhaus in Weimar. Drei ältere Damen sitzen apathisch mit gesenktem Kopf an Tischen. Die Pflegerin räumt nebenan in der Gemeinschaftsküche das Kaffeegeschirr in die Spülmaschine. Es ist die Wohngruppe für Demenzkranke. Der Bedarf an Pflegeeinrichtungen wächst. Die demografische Entwicklung in Deutschland beschert der Sozialbranche eine sichere Zukunft mit stabilem Wachstum. Die Pflegefachkräfte dagegen machen sich rar.
"Es klemmt immer öfter. Also: Du kannst nicht aus einer Reihe von Bewerbungen bewusst ein Mitarbeiterpotenzial entwickeln, sondern ganz oft entscheidet der Zufall der Verfügbarkeit von Mitarbeitern über die Stellenbesetzung."
Martin Gebhardt ist der Leiter des Bereichs Altenhilfe des Diakonieverbundes Weimar-Bad Lobenstein, der Chef von 750 Beschäftigten, die in den ambulanten und stationären Einrichtungen seiner Firma in Mittel- und Ostthüringen arbeiten. Er sagt, der Fachkräftemangel, der in anderen Wirtschaftszweigen erst in fünf Jahren erwartet werde, sei in seinem Sektor längst Alltag. Bei ihm sind überwiegend Frauen beschäftigt: Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Heilerziehungspflegerinnen, Sozialpädagoginnen, Geronto-Pädagoginnen. Während er sich vor zehn Jahren unter den Bewerberinnen noch die Besten auswählen konnte, ist er heute froh über jede halbwegs qualifizierte Bewerbung.
"Und es gibt auch Regionen, in denen wir eigentlich überhaupt keine Fachkräfte bekommen. Da gibt es niemanden auf dem Markt. Und dann müssen wir immer warten, bis wieder eine Bewerbung eingeht. Und das heißt dann konsequent, dass man nur fragt: Kann man sich den vorstellen oder geht es gar nicht."
Die langfristige Perspektive kann den Diakonie-Mann nicht optimistisch stimmen. Die Zahl der Renteneintritte wird sich absehbar verdoppeln, die Zahl der Berufsanfänger halbieren.
Der Grund: Mit der Wende kamen in den dann neuen Ländern aufgrund der massiven Verunsicherung deutlich weniger Kinder zur Welt. Erst wurden Kindergärten geschlossen, dann Schulen, dann fehlten Lehrlinge und Studierende, und nun kommen die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt.
Zweites Manko: Die neuen Länder leiden unter einer ungebremsten Abwanderung. Junge, gut ausgebildete Absolventen ziehen aus Thüringen weg, zum Beispiel nach Bayern und Baden-Württemberg. Vor allem junge Frauen wandern ab. Und mit ihnen das Arbeitskräftepotenzial für pflegerische Berufe. Die Sozialwirtschaft, hier das Beispiel Thüringen, ist also das Paradebeispiel für Fachkräftemangel.
In einer Stuhlreihe sitzen drei ältere Damen und warten auf die Ergotherapie. Der Pfleger kommt, fährt mit ihnen im Fahrstuhl in die untere Etage zum Bastelraum, macht dort mit ihnen kleinere Arbeiten und geleitet sie freundlich zurück. Das ist das Ereignis des Vormittages.
"Ich hol Sie dann ab. Nicht wegrennen, ja?"
Altenpflege ist eine Branche mit Zukunft. Wer hier einsteigt, kann sich seinen Arbeitgeber aussuchen.
"Wir haben natürlich darauf reagiert. Wir haben seit Jahren ganz intensiv unseren Fuß drin bei der Ausbildung. Und das wirkt sich natürlich dahin gehend positiv aus, dass junge Leute sagen: Aha, hier haben wir eine Chance. Die machen dann auch ein Praktikum eventuell oder ein Vorjahr, oder arbeiten ein halbes Jahr als Pflegekraft, um dann eine Ausbildungsstelle zu bekommen, um damit in der Region gehalten zu werden."
Die Ausbildung verbessern, Azubis an die Ausbildungsbetriebe binden, dies ist auch eine Strategie der freien Wirtschaft. Die Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel arbeitet intensiv mit Schulen zusammen, um frühzeitig für sich zu werben. Viele Jugendliche wissen vor der Berufswahl oft nicht, worauf sie sich einlassen. Mehr als jeder fünfte bricht die Ausbildung ab. Die Diakonie Weimar hat sich deswegen entschieden, zu investieren. Sie will Auszubildende bei der Stange halten.
"Wir haben dazu jetzt extra eine Koordinatorin eingesetzt im Unternehmen, die die Praxisanleiter und die Einrichtungen unterstützt bei dieser Tätigkeit, eine gute Ausbildung zu gewährleisten. Am Wichtigsten ist ja die Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen."
Wer dabei ist, kann aber trotzdem über den Tellerrand blicken und sehen, was woanders gezahlt wird. 50 Prozent mehr, 70, sogar 100 Prozent mehr in den alten Bundesländern. Dem Thüringer Bereichsleiter fehlen dann die Argumente: Weiche Standortfaktoren seien ja da. Kindergartenplätze, Freizeitwert etc. Bei der Bezahlung aber muss Martin Gebhardt passen. Sein Unternehmen zahlt nicht einmal den öffentlichen Tarif. Er sagt, der Preiskampf werde durch die Pflegekassen vorgegeben. Sie würden als Messlatte immer den günstigsten Anbieter wählen.
"Wenn wir mit den Pflegekassen verhandeln, werden wir gegebenenfalls auch mit solchen Preisen verglichen, und die sagen: 'Guck doch mal an, die brauchen auch nicht mehr Geld.' Das war bisher das Spiel der letzten Jahre, das muss aufhören."
Der Geschäftsführer der Diakonie hält für seine Branche einen Mindestlohn von zehn bis zwölf Euro pro Stunde für ein adäquates Zeichen, das die Politik eigentlich setzen sollte.
Die Betreuung von Demenzkranken ist aufwendig. Auf 70 Bewohnerinnen und Bewohner kommen 60 Beschäftigte. Der Chef würde gerne über neue Berufsbilder diskutieren. Und über den Pflegebegriff: Lieber bloß einmal waschen pro Tag, statt zweimal, dafür einmal mit dem Bewohner spazieren gehen. Das kann auch jemand, der keine Pflegeausbildung hat. Zum Beispiel die sogenannten gering Qualifizierten.
"Die Überraschung ist bei vielen, die eine Weile in der Pflege arbeiten, manchmal auch erst in der Hauswirtschaft, dass sie merken, dass ihnen das doch Spaß macht und dass sie sich dann weiterentwickeln. Und das ist gerade für alle die, die noch am überlegen sind, ein guter Weg."
Wissenschaftler werben für das sogenannte Schornsteinprinzip, bei dem alle eine Stufe höher klettern durch Qualifizierung. Michael Behr, Arbeitsmarktexperte im Thüringer Wirtschaftsministerium:
"Wir brauchen zukünftig - gerade wenn in Größenordnungen Ingenieure, Hochqualifizierte weggehen, brauchen wir im Prinzip eine Art Upgrading-Kultur, wo die Facharbeiter zu Ingenieuren gemacht werden. Und das würde uns praktisch auch die Möglichkeit geben, die gegenwärtig blockierten Beschäftigungspotenziale bei den Un- und Angelernten zu nutzen."
"Wir haben ein irres Beispiel gefunden,"
sagt Frank Schiemann vom Institut für sozialökonomische Strukturanalysen, kurz SÖSTRA,
"wo ein allerdings größerer Familienbetrieb eine Gruppe von neun An- und Ungelernten qualifiziert hat auf Facharbeiterberufe. Innerbetrieblich, mit Unterstützung der Agentur übrigens, und die Facharbeiter gleichzeitig parallel mit der Unterstützung eines entsprechenden Bildungsträgers der Branche zu Technikern und Meistern qualifiziert hat."
Für die Altenpflege sieht Martin Gebhardt vom Diakonieverbund Weimar-Bad Lobenstein dieses Prinzip als sehr tragfähig an. Viele gering Qualifizierte sind ortsgebunden, würden also nicht so schnell abwandern. Die Agentur für Arbeit unterstütze solche Maßnahmen. Ohne diese Rückendeckung würde es auch nicht gehen. Außerdem tue vielen das Signal gut, dass der Arbeitgeber gern in sie investiert. Das motiviert.
"Unser oberstes Ziel ist zur Zeit, Strukturen zu schaffen, die es den Mitarbeitern attraktiv macht, bei uns zu arbeiten. Dass sie einfach merken: Wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist das Firmenklima. Und das ist ein Weg."
Ein anderer ist dem sehr ähnlich. Er ist die Qualifizierung dessen, was man die stille Reserve nennt. Das sind die interessierten und teils hoch motivierten Ehrenamtlichen, die ohnehin schon zum Beispiel in der Pflege von dementen Angehörigen Wissen und Fähigkeiten erworben haben, und die - zum Beispiel nach dem Tod der Mutter - durchaus willens und in der Lage wären, in der Altenpflege noch etwas Geld zu verdienen. Michael Behr vom Thüringer Wirtschaftsministerium hebt diese Gruppe als Potenzial vor allem der neuen Bundesländer hervor.
"Erstens geht es darum, vielen Thüringern, die erwerbstätig sein wollen, die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Da haben wir erhebliche brach liegende auch stille Reserven. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch da. Wir haben Potenziale auch bei den älteren Frauen, die wir so nicht in Westdeutschland haben, die weiterhin erwerbstätig sein wollen, auch lange."
Was die Diakonie in Weimar überlegt und praktiziert, ist symptomatisch für die Thüringer Wirtschaft. Eine Studie im Auftrag des Erfurter Wirtschaftsministeriums bestätigt, dass die meisten Betriebe das Fachkräfteproblem erkannt haben und dass sie vor Ort Potenziale entdecken, die einfach nur genutzt werden müssen. Die Thüringer Unternehmen sind demnach zuversichtlich, das Fachkräfteproblem lösen zu können. Frank Schiemann von SÖSTRA nennt Beispiele.
"Das sind in erster Linie natürlich die im Land selber ausgebildeten Jugendlichen, aber eben auch die Hoch- und Fachhochschulabsolventen, es sind aber auch die arbeitslos gemeldeten Erwerbspersonen, die sich bisher immer noch in dieser Situation fühlen, nicht gebraucht zu werden am Arbeitsmarkt. Und die Frage ist, wie man sie mobilisieren kann."
Die Arbeitsmarktexperten werden nicht müde zu betonen, dass Arbeitgeber Geld und Ideen darauf verwenden müssen, die vorhandenen und neu entdeckten potentiellen Fachkräfte zu schulen. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen dafür maßschneidern. Der Prozess, hier die geeigneten Instrumente zu finden, habe gerade erst begonnen.
Zurück ins Pflegeheim der Diakonie in Weimar. Der Bereichsleiter Altenpflege, Martin Gebhardt, hat bereits viel getan, um Fachkräfte zu werben und zu halten. Aber er weiß, dass dies nicht ausreichen wird. Diskutiert sein Unternehmen über Zuwanderung? Ja, aber nur ganz zaghaft.
"Ein Schritt, den wir jetzt lange vorbereitet haben, ist der Einsatz von Fachkräften aus dem osteuropäischen Raum. Wir haben uns bisher da immer sehr zurückhaltend verhalten. Haben uns aber inzwischen entschieden, das strukturiert auszuprobieren. Wir haben gerade zwei Krankenschwestern aus dem Baltikum, die jetzt im Rahmen ihrer Sprachkurse die Anerkennung für Thüringen bekommen werden."
Die Arbeitsmigration innerhalb der Europäischen Union sieht Martin Gebhardt nur kurzfristig als Lösung an. Langfristig sei sie europapolitischer Unsinn. Denn absehbar würden die Fachkräfte auch in ihren Heimatländern gebraucht, und dann könnten es sich die Einrichtungen in Polen, Tschechien und Co. nicht mehr leisten, ihre Frauen - und wie beschrieben sind es ja überwiegend Frauen - ziehen zu lassen.
Während hier also im Sozialbereich bereits Nägel mit Köpfen gemacht werden, sträubt sich die freie Wirtschaft in Thüringen noch gegen den Gedanken der Zuwanderung. Gerade einmal zehn Prozent der Firmen nennen dieses Stichwort, wenn sie gefragt werden, was sie planen, gegen den drohenden Fachkräftemangel zu tun. Aber da auch erst unter Punkt sieben. Vorher wollen sie ältere Arbeitnehmer länger im Unternehmen halten, in Weiterbildung investieren, bessere Bedingungen schaffen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Ausbildung verbessern, Teilzeitarbeit ermöglichen und rationalisieren, sagt Arbeitsmarktforscher Frank Schiemann.
"Aus unserem Dafürhalten ist es eigentlich eher so, dass diese Problematik sehr breit in der öffentlichen Diskussion ist. Wenn man sich die anderen Potenziale anschaut, die im Land, die in der Region vorhanden sind, dann denke ich mal, ist in dem Bereich der Diskussion schon fast Genüge getan. Das mag aber durchaus, sag ich mal, in verschiedenen Qualifikations- und Berufsbereichen auch bestimmten Regionen des Landes unterschiedlich sein."
Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig von der SPD hält angesichts der Zahl von prognostizierten 200.000 Fachkräften, die innerhalb der nächsten zehn Jahre dem kleinen Freistaat fehlen werden, dagegen. Er spricht das Thema auf einer Veranstaltung vor Unternehmern vorsichtig an.
"Wer in den nächsten Jahren Fachkräftebedarf hat, wird auch eines tun müssen: Er wird offen sein müssen für Zuwanderung. Ich sage das ganz deutlich. Und zwar Zuwanderung aus den alten Bundesländern. Aber wir brauchen auch die gezielte Zuwanderung von Qualifizierten aus der Europäischen Union oder aus anderen Teilen."
Das Wirtschaftsministerium weiß, dass es behutsam vorgehen muss. Aber genau genommen müsste es laut sagen: Gerade die Regionen in Thüringen, die sich am meisten sträuben, haben den höchsten Bedarf an ausländischen Fachkräften. Strukturschwache Gebiete haben nicht das Arbeitskräftepotenzial, das sie bräuchten. Aber: Es gibt in Thüringen zum Beispiel schlicht keine Tradition darin, mit Migranten zu leben. So sagt es der Arbeitsmarktexperte aus dem Wirtschaftsministerium Michael Behr.
"Wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass wir in den neuen Bundesländern regelrecht einen Prozess der ethnischen Homogenisierung haben. Nirgendwo in der OECD ist der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte so gering, wie heute in den neuen Bundesländern. Selbst zu DDR-Zeiten war der Anteil ausländischer Arbeitnehmer höher, als das jetzt der Fall ist."
Damals waren Arbeiter aus "Bruderländern" wie Moçambique und Vietnam in der Volkswirtschaft der DDR eingeplant. Doch die mussten nach der Wende wieder gehen. Heute ist der Unterschied West-Ost in den Unternehmen schlicht sichtbar.
"Sie sehen, dass manche Branchen in Westdeutschland ohne Ausländer gar nicht funktionieren würden, und wir gucken uns hier Metall verarbeitende Unternehmen oder Automobilunternehmen an und wir sehen nicht einen einzigen Ausländer, keine anderen Hautfarben - das ist ein irritierendes Bild."
Thüringen hat einen Ausländeranteil von rund zwei Prozent - man darf es gern wiederholen: zwei Prozent, nicht zwanzig. Umgekehrt proportional verhält sich dazu die gesellschaftliche Wahrnehmung. Je weniger ausländische Zuwanderer da sind, desto fremdenfeindlicher die Stimmung. Wer wollte also jetzt lauthals Forscher und Entwickler mit erkennbar anderer Hautfarbe einladen? Viktor Bernecker vom Thüringer Verband der Wirtschaft appelliert deshalb :
"Wenn es gelingt, dass wir eine glaubwürdige Willkommenskultur in Deutschland aufbauen für qualifizierte und integrationswillige Menschen mit Migrationshintergrund, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn natürlich gibt auch da Potenziale, die wir gut brauchen können."
Der Verband der Thüringer Wirtschaft verweist darauf, dass gute wirtschaftliche Argumente alleine nicht ausreichten, eine gezielte Zuwanderung auch gesellschaftlich zu tragen. Michael Behr vom Thüringer Wirtschaftsministerium wird deshalb nicht müde, die Rahmenbedingungen zu erklären. Wohl wissend, dass politische Entscheidungen eine Akzeptanz der Wähler brauchen:
"Wir dürfen nicht eines tun, nämlich in der Bevölkerung das Gefühl erwecken, dass wir lieber fitte Ausländer haben wollen, bevor wir uns um die Menschen in Thüringen kümmern, die vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung und Qualifizierung benötigen, um wieder vollwertige Arbeitskräfte zu sein."